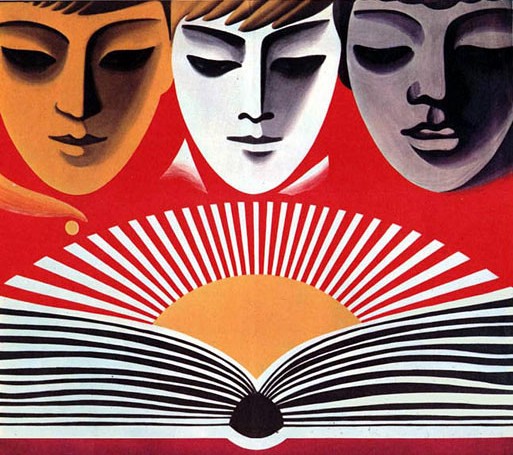Menü | Home › Partei & Verband › weltanschauliche Grundlagen unseres Eingreifens in Partei und Verband › Positionspapier des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) vom
SDS Hochschuldenkschrift
Vorbemerkungen der Redaktion
(zur 1.Auflage)
Die vorliegenden Texte fassen den Diskussionsbeitrag sozialistischer Studenten zur gegenwärtigen Auseinandersetzung um die Reform und Demokratisierung der Hochschule zusammen.
Die Analyse kann weder den Anspruch erheben vollständig zu sein, noch können die an sie geknüpften Folgerungen absolute Verbindlichkeit für sich fordern.
Dieser Beitrag entstand in Arbeitsgruppen des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Die Ergebnisse ihrer Diskussionen wertete ein Redaktionsgremium aus und entwickelte sie in eigener Verantwortung weiter.
Wirklichkeit der Hochschule und Bestrebungen zu ihrer Reform sind zu einem komplexen Problem geworden. Sinnvolle Anregungen zu einer Lösung sind nur in ausführlicher und kritischer Auseinandersetzung zu gewinnen. Deshalb mußte dieser Diskussionsbeitrag die Form einer längeren Denkschrift erhalten.
Unsere Untersuchung zielt auf das Verhältnis von Hochschule und Demokratie: Die Hochschule als Teil der Gesellschaft kann sich der Alternative unserer historischen Lage nicht entziehen. Entweder wirkt sie mit an der dynamischen Weiterentwicklung zur sozialen Demokratie und der Demokratisierung der Gesellschaft, oder sie wird Instrument in einer Entwicklung zu autoritären Gesellschaftsformen. Im zweiten Fall müßte sie vollends den ihr eigenen Anspruch der Aufklärung aufgeben: Mündigkeit und Selbstbestimmung der Menschen in einer vernünftigen, freien Gesellschaft zu verwirklichen.
Berlin, im September 1961
0. Einleitung:
Hochschule und Gesellschaft
In der jüngsten Vergangenheit erging an die Universität immer wieder die Aufforderung, sich als Institution in der Gesellschaft und in ihrer Verantwortung für die Gesellschaft zu begreifen. Ein solches Selbstverständnis muß die Erkenntnis einschließen, daß die Universität von der Gesellschaft ausschließlich nach ihrer Leistung eingeschätzt wird und daß ihr konkrete Aufgaben gestellt werden. Bei dem gegenwärtigen Stand der industriellen Entwicklung sind dies:
- die Erarbeitung verwertbarer Forschungsergebnisse und
- die Ausbildung wissenschaftlich qualifizierter Fachleute.
Diese Aufgabenstellung zieht die liebgewordene Fiktion einer zweckfreien Forschung als einer Leitung „spielerische Muße“ grundsätzlich in Zweifel. Die Universität tritt in die Nähe des für den Markt arbeitenden Produktionsbetriebes. Damit müssen aber auch jene Leitbilder überprüft werden, die die deutsche Universität zu Beginn des 19. Jahrhunderts geistig und organisatorisch geprägt haben.
Das Prinzip „Einsamkeit und Freiheit“ ist immer wieder als die „soziale Idee“ der klassischen deutschen Universität hervorgehoben worden. Man muß dem, wenn man von der Humboldtschen Reform ausgeht, die „Einheit von Forschung und Lehre“ als Methode der Bildung des Gelehrten und schließlich die „Autonomie der Universität“ als institutionelle Voraussetzung zur Seite stellen. Davon hat sich insbesondere die „Einheit von Forschung und Lehre“ als produktives Prinzip erwiesen. Die beiden anderen Grundsätze waren Ausdruck des Versuchs der Reformer, gegenüber dem spätabsolutistischen Staat einen Raum sozialer Freiheit zu schaffen, in dem sie die Verwirklichung ihrer Ideen für denkbar hielten.
Der aufgeklärt-absolutistische Staat verlangte für seine rationell gestaltete Herrschaftsapparatur nützliche Forschungsergebnisse und einsetzbare Staatsdiener. Gegenüber diesem Anspruch erhoben die Reformer die Forderung nach Autonomie der Universität als der Bedingung, die dem einzelnen in „Einsamkeit und Freiheit“ die Selbstverwirklichung im Sinne ihres Bildungsideals ermöglichen sollte.
Das Ideal der Aufklärung, die Autonomie des Menschen, erfährt hier die für das deutsche Denken jener Zeit eigentümliche Verengung auf den privaten Bereich. Das Bürgertum, das seinen Anspruch auf politische Selbstbestimmung nicht verwirklichen kannte, erstrebte einen Raum individueller Freiheit, und seine Philosophen verstanden die Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit nur noch als Selbstverwirklichung des denkenden Subjekts in der spekulativen Philosophie.
Indem sich die Universität auf die Auseinandersetzung mit dem absolutistischen Staat konzentrierte, trat die sich vom Staat emanzipierende bürgerliche Gesellschaft, der ganze Bereich von Produktion und Erwerb, nicht in ihren Gesichtskreis. Von da aus findet die häufig kritisierte Gesellschaftsblindheit der deutschen Universität ihre historische Erklärung.
Die alten Leitbilder, mit denen die Freiheit der Universität dem Staat gegenüber begründet worden war, verloren ihre Wirkungskraft im Laufe der industriellen Entwicklung; denn die Ansprüche an die Universität kamen nun gerade aus jenem Bereich der Produktion und des Erwerbs, den die Universität glaubte, vernachlässigen zu können.
In der industriellen Güterproduktion konzentrierte sich jetzt der Bedarf an Forschungsergebnissen und wissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften. Die Großproduktion setzte sich durch und die rationelle Organisation des Produktionsablaufs mit wissenschaftlichen Mitteln wurde notwendig.
Auch und gerade der Anspruch des Staates an die Universität verschob sich allmählich. Hatte bisher der Hauptakzent seines Interesse auf der Ergänzung und rationellen Gestaltung seines Herrschafts-Apparates gelegen, so trat er nun durch die Gründung technischer Hochschulen, natur- und wirtschafts-wissenschaftlicher Fakultäten, als Produzent der in der Gesellschaft benötigen wissenschaftlich ausgebildeten Fachkräfte auf. Diese Entwicklung, die einherging mit der Monopolisierung des Bildungswesen durch den Staat, hieß aber die rein staatlichen Funktionen überschreiten. Bedeutete sie doch nichts anderes, als den Versuch, aus dem Produktions- und .Tauschgefüge der Gesellschaft einen Teilbereich herauszunehmen und zu regulieren. Der Staat übernahm also gesellschaftliche Funktionen, die den heutigen Eingriffen in das Marktgefüge entsprechen.
Dieser Entwicklung gegenüber mußten die klassischen Prinzipien der Universität als Begründung ihrer Freiheit wirkungslos werden. Ein Staat, der mit dem Anspruch auftrat, im Interesse des „Gemeinwohls“ zu handeln, der seine Forderungen als gesellschaftliche Notwendigkeiten vertrat, konnte nicht mehr mit dem Hinweis auf seinen „zunächst durchaus selbstsüchtigen“ Charakter (Schleiermacher) abgewehrt werden. Die Universität konnte solche „Notwendigkeiten“ nicht einfach abweisen, wollte sie nicht als gesellschaftsfeindlich gelten.
Kennzeichnend für diese Entwicklung war die zunehmende Anpassung des Universitätsbetriebes in seinen Teilbereichen an die aus der Gesellschaft kommenden Anforderungen. Die Forderung nach einer zweckfreien wissenschaftlichen Forschung als Mittel der Bildung des Gelehrten mußte gegenstandslos werden, als die Gesellschaft nicht mehr den universal gebildeten Gelehrten, sondern den spezialisierten Wissenschaftler verlangte. Die Universität entsprach dem gesellschaftlichen Prozeß der fortschreitenden Arbeitsteilung durch Aufnahme neuer Fachwissenschaften, durch Übernahme spezieller Berufsausbildung und schließlich durch ständige Ausweitung des nur reproduzierten Wissensstoffes.
Die Erfordernisse der gesellschaftlichen Entwicklung führten zu einer wachsenden faktischen Zweckrichtung des Universitätsbetriebs, die Freiheit durch die formale Autonomie des Betriebes ersetzte.
Mit der Behauptung, ihr Bemühen um Wahrheit sei zweckfrei, hatte sich die Universität der Möglichkeit begeben, die an sie herantretenden Ansprüche der Gesellschaft auf ihre Notwendigkeiten hin zu überprüfen.
Damit lieferte sie aber die Ergebnisse dieses zweckfreien Strebens an beliebige Zwecke aus.
„Leistungen deutschen Forschergeistes“ und „deutsche Akademiker“ wurden so durch politische und gesellschaftliche Macht unbegrenzt manipulierbar. Die Behauptung, „es nicht gewollt zu haben“, wird so gesehen aus einer immer wiederholten blassen Entschuldigung zum Schuldgeständnis der deutschen Universität.
Die Selbstauslieferung der Universität an den Nationalsozialismus, ihre „Brauchbarkeit“ als Instrument seiner Rechtfertigung während des „Dritten Reiches“ ist hierfür gewiß das prägnanteste, keinesfalls aber das einzige Beispiel.
Dieser Prozeß der Anpassung der Universität, wie er spätestens nach dem zweiten Weltkrieg in seinen Auswirkungen auf allen Teilbereichen der Hochschule sichtbar geworden ist, hat zu einer völligen Sinnentleerung der klassischen Prinzipien geführt.
Gerade weil diese Prinzipien in der Realität kein Entsprechung mehr fanden, erstarten sie zu leeren Formeln. Sie wurden bestenfalls zur Ausdrucksform romantischer Abkehr von der Wirklichkeit, meist aber zum diskreten Schleier für handfeste Teilinteressen innerhalb und außerhalb der Universität. Von daher wird verständlich, daß aus dem insgesamt so kritischen „Blauen Gutachten“ des Studienausschusses für Hochschulreform von 1948 seither nur noch das Wort von der „im Kern gesunden Tradition der deutschen Universität“ mit der Inbrunst eines Glaubenssatzes wiederholt wird.
Darüber hinaus dient das „Bildungsideal“ der deutschen Universität heute zur Begründung des überhöhten Sozialprestiges der deutschen Akademikerschaft und trägt damit zur Stärkung eines antidemokratischen Potentials in unserer Gesellschaft bei.
In seiner krassesten Form äußert sich dies in Vorstellungen, die die Akademiker ohne weiteres zur „geistigen Elite“ erheben und sie einer „ungebildeten Masse“ gegenüberstellen. Aus dieser Unterscheidung wird dann die Legitimation zur Führung eben jener „unmündigen“ Masse abgeleitet - ein Vorgehen, das autoritären Praktiken nicht mehr allzu fern steht. Zwar brauchen solche autoritären Dispositionen nicht unbedingt auch wirksam zu werden; wo sie jedoch mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zusammentreffen, die sie begünstigt und aktiviert, können sie sich leicht in Form autoritärer Herrschaft politisch verhängnisvoll auswirken.
Aus alledem wäre zu folgern: Alle Versuche, den Bildungsgedanken heute formal zu reaktivieren, wie sie sich etwa im Begriff des „Erziehungsauftrags der Universität“ äußern, müssen als teilweise gutwillige, aber doch zwecklose Versuche eines „Kurieren, am untauglichen Objekt“ angesehen werden. Im Begriff der „außerwissenschaftlichen Erziehung“ wird Bildung zu dem völlig rational nicht mehr greifbaren, zu einem der Wissenschaft fremden Prinzip, mit dem die Tore der Universität für alle in der Gesellschaft herrschenden oder akzeptierten ideologischen Erziehungsbestrebungen geöffnet werden sollen. Akzeptiert die Universität die Aufgabe, ihre Studenten nach einem solchen bewußt außerwissenschaftlichen Ideal zu bilden, so fällt sie ab von dem Wissenschaft eigentlich erst begründenden Prinzip der Rationalität und wird Mittel der offenen ideologischen Indoktrination.
Ihre Aufgabe in der Gesellschaft fände diese Universität unzweifelhaft als „vornehmstes“ Mittel der Rechtfertigung und Zementierung der bestehenden Verhältnisse.
Will die Universität nicht in dieser Weise vom Prinzip der Rationalität und damit von der selbstgestellten Aufgabe der Wahrheitsfindung abfallen, ihre Wissenschaftlichkeit aufgeben und sich zum Instrument einer Gegenaufklärung machen, so muß sie sich über den Charakter ihres Tuns neu verständigen.
Nun kommt der Universität In der spätkapitalistischen Gesellschaft eine doppelte Funktion zu. Ihre „Produktion“ für den gesellschaftlichen Markt, die Ausbildung qualifizierter Arbeitskraft und die Bereitstellung verwertbarer Forschungsergebnisse dient zunächst dem Gesamtinteresse der Gesellschaft auf ständige Steigerung der Leistungsfähigkeit ihres Produktions- und Distributionsapparates.
Anderseits dient in dieser Gesellschaft jede nur denkbare Form der Perfektionierung dieses Leistungsapparates zugleich der Absicherung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die ihrerseits seinem rationalen Einsatz im Dienste der Menschen im Wege stehen.
Ob sie es will oder nicht - die Universität nimmt mit ihrer Arbeit Einfluß auf die gesellschaftliche Entwicklung und auf die sozialen und politischen Machtverhältnisse.
Sie steht damit im Spannungsfeld der widerstreitenden gesellschaftlichen Tendenzen, im Bereich des Widerspruchs zwischen Demokratie und autoritärer Ordnung, zwischen Fortschritt und Stagnation. Die Entwicklung der deutschen Universität in den letzten 150 Jahren hat gezeigt, daß sie sich einer solchen gesellschaftlichen Auseinandersetzung nie hat entziehen können und immer dort zum Apologeten der Reaktion werden mußte, wo sie ihre Neutralität glaubte nachdrücklich feststellen zu können.
Die Autonomie der Universität heute darf sich also nicht erschöpfen in einer formalen Neutralität, die sich aus einer juristischen Unabhängigkeit vom Staate ableitet.
Die Autonomie der Universität muß Inhaltlich neu begründet werden als Freiheit von der Manipulierung durch gesellschaftliche Partialinteressen.
Dies aber erfordert die Lösung von der Vorstellung, Arbeit an der Universität, sei es Studium, Lehre oder Forschung, sei zweckfremdes Bemühen In einem Raum sozial privilegierter spielerischer Muße.
An ihre Stelle muß das Engagement an die aufklärerische Zielvorstellung der Autonomie des Einzelnen treten, verbunden mit dem Wissen, daß dieses Ziel nur zu verwirklichen ist in einer freien, humanen und vernünftigen Gesellschaft, „in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entfaltung aller ist.“
Erst aus einem solchen Engagement wird es für die Universität möglich, ihre Funktion in der Gesellschaft immer wieder kritisch zu reflektieren und jene Distanz zu den gesellschaftlichen Ansprüchen zu gewinnen, die es verhindert, daß die Wissenschaft der Selbstrechtfertigung der jeweiligen Machthaber dient.
Wenn hier bisher von „der Universität“ und „der Wissenschaft“ gesprochen wurde, so kann und soll dies nicht darüber hinwegtäuschen, daß Arbeitsteilung und ein hoher Grad von Spezialisierung wie in der Gesellschaft so auch in der Wissenschaft zu Notwendigkeiten geworden sind, die durch eine romantische Rückwendung zur „Einheit der Wissenschaften“ nicht rückgängig gemacht werden können.
Die Einsicht, daß die Wissenschaft heute ihre Spezialisierung nicht aufgeben kann und soll, muß vielmehr zum Ausgangspunkt für die Überwindung eines bornierten, nur auf ein Spezialgebiet eingeengten wissenschaftlichen Denkens werden. Sie muß zur Einsicht in die notwendige Beschränktheit der Spezialmethoden führen und kann so erst den Wissenschaftler freisetzen für eine Verantwortung, die sich nicht mehr mit dem verfestigten Resultat aus der Erforschung eines begrenzten Fachgebietes begnügt, sondern dieses Resultat in der Praxis auf seine Wahrheit hin überprüft.
Dies bedeutet aber nichts anderes als die permanente Kritik des Verhältnisses von Einzelwissenschaft und Gesellschaft. Jeder wissenschaftlich Gebildete muß seine jeweiligen Ergebnisse um der Wahrheit willen messen am gesellschaftlichen Prozeß, in dem diese Teilergebnisse erst ihren Stellenwert erhalten. Die Universität kann diese Aufgaben nicht dadurch aufheben, daß sie in der Soziologie oder Politologie Spezialwissenschaften mit dem Anspruch auf ein Aussagemonopol zu Staat und Gesellschaft bereitstellt. Vielmehr unterliegen gerade auch diese Wissenschaften als Spezialdisziplin der Notwendigkeit der Selbstreflexion, weil gerade sie sich unreflektiert betrieben für eine Manipulation im Interesse der Herrschenden in besonderem Maße anbieten.
Gewinnt die Universität durch Selbstreflexion die Distanz von den gesellschaftlichen Partialinteressen zurück, so erlangt jener historische Bildungsanspruch neues Gewicht, der sich auf die Aufklärung menschlicher Lebensverhältnisse richtet.
Denn wie sie nicht darauf verzichten kann, ihre Forschungsergebnisse an der gesellschaftlichen Praxis zu überprüfen, so muß sie ihr Engagement an die Humanität auch an die durch sie ausgebildeten wissenschaftlichen Fachkräfte vermitteln.
Dieses Bildungsziel ist kein der Wissenschaft fremdes, es ist vielmehr die historische Voraussetzung und Erbschaft von Wissenschaft überhaupt:
KRITISCHE RATIONALITÄT IM DIENSTE DES MENSCHEN zu sein.
I. Forschung, Lehre und Studium
I.1 Wissenschaft als Arbeitsprozeß in der Hochschule
„Die Wissenschaft“ verstanden als ein System aufeinander bezogener menschlicher Tätigkeiten, ist ein vergesellschafteter Arbeitsprozeß mit ganz spezifischen Arbeitsformen. Als ein solcher Prozeß ist sie untrennbar verbunden mit bestimmten gesellschaftlichen Einrichtungen, ihren konkreten Arbeits- und Organisationsformen. Diese aber können nicht isoliert von den je herrschenden Arbeitsverhältnissen im Rahmen der gesamten Gesellschaftsordnung betrachtet werden.
Der Gegenstand dieser Denkschrift ist die wissenschaftliche Arbeit von Hochschullehrern und Studenten in der Hochschule. Das konstitutive Prinzip der wissenschaftlichen Hochschule und im besonderen Maße der deutschen Universität seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ist die Einheit von Forschung und Lehre. Die moderne deutsche Universität ist im Unterschied zu den weit stärker in der lateinisch-mittelalterlichen Tradition stehenden Universitäten Westeuropas nicht eine gesellschaftsoffene „Kultur-Universität“, mit dem Schwerpunkt in der Einheit von Kulturtradition und Berufsvorbildung (1), sondern sie ist die auf sich konzentrierte „Wissenschafts-Universität“, eine produktive, bei aller Tradition der Lehre ständig an den Grenzen zum Unerforschten arbeitende Hochschule, deren Strukturprinzipien gerade im 19. Jahrhundert dazu beitrugen, ungeahnte geistige Energiequellen zu erschließen.
Diese um die Wende von 18. zum 19. Jahrhundert sich endgültig vollziehende historische Weichenstellung muß als Grundtatsache bei allen Versuchen zur Reform dieser Universität in Rechnung gestellt werden. Hinter der zweifelhaft gewordenen „Idee der deutschen Universität“, einen Begriff von „Einsamkeit und Freiheit“, der zu ihrer zunehmenden Gesellschaftsblindheit führen mußte, steht aber ihr eigentlich produktives Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre.
Sofern die Einheit von Forschung und Lehre nicht nur verwaltungsmäßig verstanden wird, ergeben sich weitreichende Konsequenzen für die konkreten Arbeits- und Organisationsformen in der Hochschule.
Die Tätigkeit der Hochschullehrer und Studenten in der wissenschaftlichen Hochschule ist dann als ein zwar vielfach gegliederter, aber einheitlicher Arbeitsprozeß zu verstehen, an dem Dozenten, Assistenten und Studenten in unterschiedlichen Funktionen beteiligt sind. Dieser Gesamtprozeß ist auf zwei Ergebnisse hin orientiert: Die Erarbeitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und die Formung und Entwicklung der geistigen Kräfte der daran beteiligten Studenten und Wissenschaftler.
Beide Ergebnisse sind an sich nie starr zu fixieren - wissenschaftliche Erkenntnis ist nie endgültiges Ergebnis, Ausbildung des Menschen durch wissenschaftliche Erkenntnis ist nie vollendet. Dennoch wird beides für die aktuellen Bedürfnisse der Gesellschaft umgesetzt in konkrete, meßbare Arbeitsergebnisse: das verwertbare, nützliche Forschungsergebnis und die einsetzbare, wissenschaftlich qualifizierte Arbeitskraft. Aus der Funktion dieser Arbeitsprodukte der Hochschule in der Gesellschaft ergeben sich wiederum Konsequenzen für den Sinn und die Verhältnisse der wissenschaftlichen Arbeit in der Hochschule. Aber zunächst interessiert nur die eigentliche Struktur des Gesamtprozesses der Wissenschaft in der Hochschule, ohne die Rückwirkung der durch ihn produzierten Ergebnisse und ihres bestimmten gesellschaftlichen Charakters.
Die Einheitlichkeit der verschiedenen Seiten des Gesamtprozesses der Wissenschaft und der Bildung in der Hochschule, die gegenseitige Durchdringung von Forschung, Lehre und Studium oder von Forschungs- und Ausbildungsprozeß, bestätigt sich aus der Perspektive des Hochschullehrers wie auch des Studenten:
Die Forschungsarbeit in der Hochschule scheint sich zunächst nur im Kreise der Hochschullehrer, isoliert von den Studenten abzuspielen. Aber durch die gleichzeitige Tätigkeit der Forscher als Lehrer der Studenten wird deren Studium zutiefst mitgeprägt. Die Lehre bleibt nicht Vermittlung von wissenswertem Stoff, sondern sie wird zur Selbstdarstellung der wissenschaftlichen Arbeit des Forschers. Nicht nur das fixierte Ergebnis, das Faktenmaterial wird übermittelt, sondern der Weg, die Methode seiner Erarbeitung durch einen Menschen soll sichtbar gemacht, nachvollzogen und kritisch in Frage gestellt werden. Die Methode der Lehre durch den Forscher macht den Studenten stärker die lebendige Dymanik wissenschaftlicher Arbeit bewußt und stärkt seine Fähigkeit zum kritischen Urteil. Der Forscher wiederum wird gezwungen, die Methode und das Ziel seiner Arbeit in ihrer Selbstdarstellung ständig selbstkritisch zu überprüfen und der Kritik durch die Studenten auszusetzen.
Umgekehrt hat auch die Tätigkeit des Studenten nur scheinbar den Charakter der bloßen ‚Aneignung‘, der Aufnahme und Reproduktion eines dargebotenen ‚Stoffes‘ mit dem Ziel der Erarbeitung der eigenen wissenschaftlichen Qualifikation. Denn ein echtes Studium ist zugleich auch mittelbare, z.T. unmittelbare Beteiligung an der Erarbeitung von Forschungsergebnissen.
Die kritische Fragestellung der Studenten in der wissenschaftlichen Diskussion (z.B. im Seminar) und die ständige Verpflichtung des Forschers zur Darstellung und Vermittlung von Arbeitsergebnissen, haben eine gewissermaßen auslösende Funktion bei der Erarbeitung von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Durch die Sammlung und Aufbereitung von Faktenmaterial, durch die Neufassung und kritische Prüfung des bisherigen Forschungsstandes kann die Arbeit von Studenten zur unmittelbaren Voraussetzung der Gewinnung neuer Forschungsergebnisse werden. Schließlich ist es auch nicht ausgeschlossen, daß Studenten selbst in einzelnen Fragen unmittelbar zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen vorstoßen.
Das heißt aber: Ebenso wie der Professor nicht nur Lehrer ist, so ist in der Hochschule der Student nicht nur Schüler. Beide sind vielmehr dem Selbstverständnis der Hochschule nach als ‚Kommilitonen‘, als gemeinsam Fragende und Suchende am wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß beteiligt. Studieren und Forschen sind nicht prinzipiell verschiedene, sondern nur graduell unterschiedliche Tätigkeiten. Das Ziel des Studiums soll es eigentlich sein, das Forschen zu lernen, um es in der gesellschaftlichen und beruflichen Praxis anzuwenden.
Die Grundlage dieser gegenseitigen Durchdringung von Forschung, Lehre und Studium als drei Seiten eines einheitlichen Prozesses bildet jedoch die spezifische Form der Vergesellschaftung der Wissenschaft in der Hochschule.
Forschen und Studieren ist nicht spielerische, individuelle Entfaltung oder Kontemplation Einzelner in einem Raum privilegierter Muße, sondern eine Tätigkeit, die ein besonderes Maß von Selbstdisziplin, planendes und methodisches Handeln voraussetzt und sich erst in der kritischen Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlich arbeitenden Menschen verwirklicht.
Die Forschungsarbeit eines Hochschullehrers muß sich daher der Kritik seiner Kollegen und Schüler stellen und ihren Beitrag mitverarbeiten. Von dem Grad der gegenseitigen Information, Kritik und Kooperation sind Zustandekommen und Bedeutung neuen Arbeitsergebnisse abhängig. Diese Bedingung wird durch die unaufhaltsam steigende Spezialisierung in der wissenschaftlichen Arbeit noch immer weiter zugespitzt.
Ebenso besteht auch das Studium nicht nur in der individuellen Aneignung von wissenschaftlichen Erkenntnissen z.B. im Dialog mit einem wissenschaftlichen Lehrer oder mit rein individueller wissenschaftlicher Leistung, sondern es wird erst fruchtbar durch die Beteiligung an der kritischen Auseinandersetzung und durch die bewußte Zusammenarbeit mit anderen Studenten in Arbeitsgruppen und Seminaren. Der Student erreicht sein Ziel, die Ausbildung seiner eigenen geistigen Fähigkeiten, erst in dem Maße, wie er über die individuelle Aneignung hinauswächst zur aktiven Beteiligung an der Entwicklung der Fähigkeiten und Kenntnisse anderer Studenten. In der Form der gegenseitigen wissenschaftlichen Selbsterziehung der Studenten verwirklicht sich wiederum eine nur graduell verschiedene, primitive Stufe der Einheit von Forschung und Lehre.
Die prinzipielle Einheitlichkeit der verschiedenen Seiten des Erkenntnis- und Bildungsprozesses und die Weise seiner Vergesellschaftung in der Hochschule bedingen einander:
Das neuzeitliche im weitesten Sinne anti-dogmatische, kritisch-aufklärerische Wissenschaftsverständnis betrachtet alle wissenschaftliche Erkenntnis nie als fertiges Ergebnis, als Lehre vom Katheder, die Studenten als Lernende nur entgegenzunehmen hätten, sondern nur als einen situations- und subjekt-gebundenen Beitrag unter anderen, als eine vorübergehende Phase in einer ständig anhaltenden Diskussion voller produktiver Widersprüche.
Am Zustandekommen dieses prinzipiell vorläufigen ‚Diskussionsergebnisses‘ sind aber die Studenten nicht als passives Publikum der streitenden ‚Heroen‘ beteiligt, sondern als aktive, kritische Diskussionspartner und Fragesteller, deren Beitrag nur graduell von dem der Professoren verschieden ist. Die wissenschaftliche Leistung der Hochschule wird von der geistigen Aktivität aller beteiligten Gruppen - der akademischen Lehrer, ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter und ihrer Studenten - getragen.
Die prinzipielle Einheitlichkeit aller Formen der Erarbeitung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnis in der Hochschule setzt eine Form der Zusammenarbeit voraus, in der sich alle Beteiligten, die erfahrenen wie die unerfahrenen, die jüngeren wie die älteren gleichrangig gegenüberstehen, keiner dem anderen Befehle erteilen, Meinungen aufzwingen darf, in der gerade deshalb alle auf intensive Information, Diskussion und Kooperation angewiesen sind.
Der ungehinderten Entfaltung einer so verstandenen Arbeit der Wissenschaftler und Studenten stehen allerdings in der gegenwärtigen Hochschule starke Barrieren entgegen, die durch die gesellschaftlichen Verhältnisse bedingt sind:
Es handelt sich dabei nicht nur um die akute materielle Notsituation der Wissenschaft und der Hochschule, die dadurch eingetretene Überfüllung, Anonymität und Kontaktlosigkeit, sondern die Gründe liegen tiefer.
Das schwerste Hemmnis der Entfaltung eines freien Studiums und einer freien Forschung bildet das geistige ‚Klima‘ der heutigen Universität, das besondere Bewußtsein der Wissenschaftler und Studenten, das durch die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse erzeugt wird. Es kann aus der Betrachtung nicht ausgesschlossen werden, welche Funktion die Arbeitsergebnisse der Hochschule in der historischen Situation, unter den je herrschenden allgemeinen Arbeitsverhältnissen annehmen.
In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung nehmen aber die verwertbaren Forschungsergebnisse und die ausgebildete, einsetzbare Arbeitskraft den Charakter von Waren an, eine Tatsache, die nicht ohne Rückwirkungen auf das Bewußtsein der Hochschullehrer und der Studenten bleiben kann, die diese ‚Ware‘ produzieren. Denn in der bürgerlichen Waren-Gesellschaft treten die verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Zusammenhangs dem Einzelnen als bloßes Mittel für seine Privatzwecke entgegen. (2)
Für den Hochschullehrer wird die Erarbeitung und Vermittlung von Forschungsergebnissen zugleich zu einem mehr oder weniger einträglichen Geschäft, daß sich in den vielfältigsten Formen abspielt - Kolleggeldeinnahmen, Prüfungsgebühren, Verträge mit privaten oder staatlichen Geld- und Auftraggebern, Honorare für Gutachten, Publikationen. Im Interesse dieses Geschäfts fühlen sich Professoren nur allzu genötigt, unliebsame wissenschaftliche und damit ökonomische Konkurrenten von der Habilitation oder Berufung möglichst auszuschalten oder sich die Arbeitsergebnisse ihrer Assistenten und studentischen Hilfskräfte anzueignen und unter eigenem Namen zu verkaufen. Aber auch die Arbeit der abhängigen Dozenten und Assistenten muß notwendigerweise auf den möglichst einträglichen Verkauf ihrer Fähigkeiten und Arbeitsergebnisse unter Ausschaltung von Konkurrenten gerichtet sein. Es ist nicht verwunderlich, daß unter solchen Arbeitsverhältnissen an eine offene gegenseitige Kritik, an intensive kollegiale Zusammenarbeit für gemeinsame wissenschaftliche Aufgaben oft nicht zu denken ist.
Auch die Studenten arbeiten an der Qualifizierung einer ihnen gehörenden Ware, ihrer Arbeitskraft, für die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Sie meinen durch ihre zumeist abhängige und unsichere wirtschaftliche Lage dazu gezwungen zu sein, ihr Studium so schnell wie möglich und so eng wie möglich auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes ausgerichtet abschließen zu müssen, ohne sich - wie einige wenige Privilegierte - den Luxus einer vertieften wissenschaftlichen Bildung leisten zu können.
Sicherlich liegt nicht immer ein objektiver Zwang zu solcher Haltung vor, doch das geistige Gesamtklima der Universität in dieser Gesellschaft macht sie eigentlich selbstverständlich.
Die materielle Notsituation der deutschen Hochschulen inmitten der kapitalistischen „Überfluß-Gesellschaft“ bei gleichzeitig steigendem Bedarf an wissenschaftlich ausgebildeten Arbeitskräften und Forschungsergebnissen macht dieses ‚Arbeitsklima‘, die dem humanen Sinn der Wissenschaft Hohn sprechenden Arbeitsverhältnisse noch drückender, indem sie die ökonomische Konkurrenz innerhalb der Hochschule noch verschärft.
Diese Verhältnisse haben vielfach bereits zu dem Auseinanderfallen des im Prinzip einheitlichen Arbeitsprozesses der Hochschule in einen reinen Forschungsprozeß und einen davon isolierten Ausbildungsprozeß geführt. Durch diese falsch verstandene, bei der äußerlichen Notlage allerdings naheliegende ‚Arbeitsteilung‘ verändert sich aber der Charakter beider Prozesse selbst. Forschung wird vollends zum Privatzweck, zum Privileg einer kleinen Elite, ohne Beziehung zur wissenschaftlichen Bildung, zur Aufklärung durch die wissenschaftliche Erkenntnis, Ausbildung zerfällt in eine von ihren konkreten Adressaten gelöste Lehre, in die bloße Übermittlung von Stoff an eine anonyme, „gesichtslose“ Masse, und in die mechanisch-rezeptive Konsumtion, die individuelle Aneignung des Stoffes durch Hörer, die sich davon eine höhere Bezahlung beim Verkauf ihrer ‚akademisch‘ aufgewerteten Arbeitskraft nach Abschluß des Studiums erhoffen.
I.2 Zum Begriff des Studiums
Der Gesamtprozeß wissenschaftlicher Arbeit der Hochschullehrer und Studenten kann trotz seiner unterstellten und immer wieder angestrebten Einheitlichkeit in zwei verschiedenen Perspektiven, von seinen beiden Ergebnissen her betrachtet werden: aus der Sicht der in Forschung und Lehre sich entfaltenden Wissenschaft und aus der des in diesen Rahmen eingeordneten Studiums.
Forschung wird nicht nur an den Hochschulen betrieben, sondern z.T. systematischer an anderen Insitutionen. Auch die wissenschaftliche Lehre ist nicht das Privileg der Universitäten, sondern sie erfolgt z.B. auch durch wissenschaftliche Gesellschaften und Akademien, die sich an die wissenschaftliche Öffentlichkeit wenden oder durch Forschungsanstalten, die wissenschaftliche Nachwuchskräfte ausbilden.
Die wissenschaftlichen Hochschule ist dagegen vorrangig als Ort der wissenschaftlichen Ausbildung und Bildung von Nachwuchskräften für gesellschaftlich wichtige Funktionen in der Praxis anzusehen.
Nachdem die Hochschule bereits aus der Sicht der Wissenschaft betrachtet wurde, die den einheitlichen Rahmen der Arbeit aller Beteiligten setzt, soll nun das Studium im weitesten Sinne, die Gesamtheit des Bildungs- und Ausbildungsprozesses in der Hochschule gesondert behandelt werden.
Um konkrete Wege zur Reform der Ziele und Formen des Studiums aufzuweisen, ist es zunächst erforderlich, den Begriff des wissenschaftlichen Studiums als einer spezifischen Form der Ausbildung, aber auch der Erziehung, in seinen verschiedenen Aspekten - Bildung, Lernen, Berufsvorbildung - herauszuarbeiten.
Der besondere Charakter der Hochschulausbildung gegenüber allen anderen Formen der Bildung und Ausbildung - an allgemeinbildenden Schulen, höheren Fachschulen, in der Erwachsenenbildung - ergibt sich aus ihrem Anspruch, wissenschaftliche Ausbildung zu sein. Das Studium ist nach dem Selbstverständnis der modernen deutschen Universität als Ausschnitt aus dem Gesamtprozeß der wissenschaftlichen Arbeit in der Hochschule anzusehen. Durch direkte teilhabe oder lebendigen Kontakt zu dem nie abreißenden wissenschaftlichen Erkennungsprozeß sollen die Studenten ihre geistigen Kräfte und Fähigkeiten entwickeln. Durch Hingabe an die Sache, die Wissenschaft, sollen sie sich selbst, ihre kritische Urteilskraft und ihr für die Praxis relevantes Wissen produzieren. Das neuzeitliche erkenntniskritische Wissenschaftsverständnis, demzufolge jede wissenschaftliche Erkenntnis als Erkenntnis eines bestimmten Subjekts in einer historischen Situation prinzipiell nur als ‚Diskussionsbeitrag‘ gilt und ständig in Frage zu stellen ist, verlangt aber, daß auch der Student nichts ungeprüft und unkritisch hinnimmt, sondern sich in eigener geistiger Initiative ein kritisches Urteil bildet. Die Wissenschaftlichkeit des Studiums besteht darin, daß der Student am Prozeß seiner Ausbildung nicht wie der Schüler oder der Absolvent einer Fachschule vorwiegend als passives Objekt, sondern als produktiv selbständiges Subjekt beteiligt ist.
An der Ausbildung in der Oberschule oder in der höheren Fachschule, wo bestimmte ausgewählte und popularisierte Ergebnisse der Wissenschaft vermittelt werden, sind die Schüler deshalb vorwiegend als passive Hörer und Lernende beteiligt, weil sie nicht so weit in die Dinge eindringen können, daß sie wie die Studenten es tun sollten, den Entstehungsprozeß bestimmter wissenschaftlicher Erkenntnisse nachvollziehen und kritisch beurteilen könnten.
Sie müssen diese Ergebnisse vielmehr im wesentlichen unkritisch hinnehmen, denn sie sind dem Ziel ihrer Ausbildung zufolge nur Mittel oder Medium für andere Zwecke, im Rahmen der Vermittlung einer höheren Allgemeinbildung und der grundlegenden Übung geistiger Kräfte und Begabungen bzw. zum Erwerb von speziellen Fachkenntnissen und Techniken im Rahmen der Berufsausbildung.
Im Mittelpunkt der Ausbildung der Studenten steht dagegen das Bemühen, in den Entstehungsprozeß wissenschaftlicher Ergebnisse selbst tiefer einzudringen, weil nur so ihre Bedeutung im Gesamtzusammenhang der Wissenschaft - aber auch ihre Relevanz in der Berufspraxis und für die Gesellschaft zu verstehen ist, und weil nur so neue Probleme der Praxis aufgrund wissenschaftlicher Methoden und Ergebnisse zu bewältigen sind.
Dieser Charakter des Studiums hat sich nicht nur durchgesetzt, weil ein theoretischer Anspruch auf kritisch-aufklärerische Wissenschaftlichkeit es verlangte, sondern weil auch die immanente Entwicklung der Fachwissenschaften, die ständige Verfeinerung ihrer Methoden und Techniken und das lawinenartige Anwachsen des grundlegenden Wissensbestandes die Hineinnahme des Studenten in den wissenschaftlichen Arbeitsprozeß selbst erzwingen, da sonst in einer bestimmten Phase der Entwicklung die Ergebnisse dieses Prozesses überhaupt nicht mehr verstanden und in der Berufspraxis angewendet und genutzt werden könnten.
Die Höherentwicklung der Wissenschaft erzwingt ständig die Vertiefung und weitere ‚Verwissenschaftlichung‘ der Hochschulausbildung.
Die zunehmende Verwissenschaftlichung aller Bereiche der Praxis in der modernen industriellen Zivilisation zieht wiederum zwangsläufig immer mehr Berufswege in den Rahmen der wissenschaftlichen Ausbildung hinein. Ein Student, der in der Hochschule nicht gelernt hat, selbständig und aus eigener Initiative in wissenschaftliche Probleme seines Faches einzudringen, ist auch für die entscheidenden Positionen in der Praxis einer von wissenschaftlichen Methoden geprägter Industriegesellschaft ungeeignet und sinkt, wenn er nicht in bestimmte reine Herrschaftspositionen gelangt, zum bloßen Funktionär ab. Die Aufrechterhaltung und weitere Vertiefung der Wissenschaftlichkeit des Studiums ist daher eine objektive gesellschaftliche Notwendigkeit.
Es ist eine andere Frage, ob und in welcher Form sich diese Notwendigkeit in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Wissenschafts- und Nachwuchsförderung und um die Ziele und Formen des Studiums durchzusetzen vermag.
I.2.1 Akademische Freiheit des Studiums
Ein echtes wissenschaftliches Studium ist nur bei Wahrung von bestimmten ‚Arbeitsverhältnissen‘ möglich, die sich im Rahmen der modernen deutschen Universität in der Form der besonderen akademischen Freiheit des Studenten ausgeprägt haben.
Akademische Freiheit umfaßt für den Studenten vor allem das Recht der freien Wahl des Studienortes, des Studienfaches, des akademischen Lehrers und der einzelnen Lehrveranstaltungen - als Ausfluß seiner Freiheit zu kritischer Haltung gegenüber allen Forschungsergebnissen und Lehrmeinungen der Fakultäten und akademischen Lehrer. Strebt der Student diese kritische Urteilsfähigkeit und geistige Selbstständigkeit nicht an, so wird seine akademische Freiheit sinnlos, denn sie findet ihre Rechtfertigung und konkrete Sinngebung in der engen Bindung des Studenten an den wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß. Die akademische Freiheit ist nicht nur negative Freiheit von äußeren Zwangsgesetzen, sondern sie ist eindeutig durch das Ziel des Studiums und den Zweck der Hochschule positiv bestimmt, als Freiheit zum sinnvollen wissenschaftlichen Arbeiten.
Das kann aber keinesfalls bedeuten, daß irgendeine Instanz feststellen könnte, der Student habe seine akademischen Freiheitsrechte ‚verwirkt‘ Akademische Freiheit muß das Risiko der Freiheit zum Irrtum einschließen. Eine paternalistische Attitüde, die den Studenten wohlmeinend vor der Verirrung zu bewahren trachtet, hat hinterrücks den Raum akademischer Freiheit bereits verlassen.
Die Chance zum sinnvollen Gebrauch der akademischen Freiheit setzt eine bewußte Organisation und freie Planung des Studiums voraus, damit dem Studenten der sinnvolle Gebrauch seiner Freiheit ermöglicht und bewußt nahegelegt wird. Die Gestaltung und Planung des Studiums darf jedoch nur unter aktiver Mitwirkung und Mitbestimmung der Studenten erfolgen, die sich in Arbeitsgruppen und Fachschaften zusammenschließen, ohne dabei dem Einzelnen eine bestimmte Methode oder Richtung des Studiums aufzuzwingen.
Die akademische Freiheit der Studenten ist nicht nur verknüpft mit der Verpflichtung zum sinnvollen Gebrauch dieser Freiheit, sondern ebenso mit dem Recht und der Pflicht zu aktiver und gleichberechtigter Mitwirkung an der Gestaltung des Studiums in Zusammenarbeit mit den Kommilitonen und den akademischen Lehrern.
Eine derartige Studiengestaltung ist gegenwärtig durch die den Prinzipien kritischer Rationalität feindlichen Arbeitsverhältnisse und die ihnen entsprechenden Bewußtseinslagen in vieler Hinsicht erschwert. Das geistige Klima der Universität in der gegenwärtigen Gesellschaft - die Käuflichkeit des Intellekts als ‚Ware‘ auf dem akademischen Arbeitsmarkt die Verdinglichung des Wissens zum Stereotyp, zur bloßen Parole des „know how“ - nicht nur die unzumutbaren äußeren Arbeitsbedingungen (der Mangel an Arbeitsplätzen, Lernmitteln und Lehrkräften und die Routine eines autoritär wirkenden Unterrichtsbetriebs) - haben dazu geführt, daß der Student in der bloß passiven Rolle des ‚Wissenschafts-Konsumenten‘ steckenbleibt, der sich in verantwortungsloser „akademischer Freiheit“ aus einer planlos angebotenen Stoff-Fülle das heraussucht, was ihm für das spezielle Berufsziel, unmittelbar nützlich erscheint. Der Studienzweck wird zum reinen Privatzweck, das Studieren zu einem bloßem „Machen von Karrieren“ über die Bürokratie. (Marx) (3)
Doch gerade damit verfehlt der Student selbst das Ziel einer fundierten fachwissenschaftlichen Berufsvorbildung. Er entwickelt sich nicht einmal zum selbständig arbeitenden und kritisch urteilenden wissenschaftlich ausgebildeten Fachmann, sondern nur zum wissenschaftsfremden halbgebildeten Funktionär, der nur auf Anweisung von oben tätig wird und die Probleme der Praxis nicht mit den Methoden und Ergebnissen der Wissenschaft in eigener Initiative zu bewältigen vermag.
Wo aber der Anspruch auf „akademische Freiheit“ aufrechterhalten werden muß, um nicht der Minderheit, die sie trotz aller Behinderungen zu nutzen versteht, zu schaden, gleichzeitig aber die psychologischen und sozialen Voraussetzungen eines sinnvollen freien Studiums der meisten Studenten zerstört sind, da entleert sich der Begriff der akademischen Freiheit zum sachfremden sozialen Privileg, zum „vornehmsten“ Mittel der Gewinnung eines höheren Sozialprestiges, das gegen „Fachschultendenzen“ ins Feld geführt wird, weil diese nicht dem angeblichen geistigen Niveau und Anspruch er „Minorität der Führungskräfte“ gerecht werden. Dem faktischen Privileg des Zugangs zur Universität, das heute immer noch bestimmte soziale Schichten innehaben, entspricht der Anspruch auf einen angeblich „akademischen“, freien Lebensstil der Studenten, der äußerlich im krassen Gegensatz steht zu den unfreien Arbeitsverhältnissen ihrer Altersgenossen in den Betrieben und Fachschulen, die streng nach dem Leistungsprinzip arbeiten müssen.
I.2.2 Rezeptives Lernen und produktives Studieren
Weil faktisch immer weniger Studenten in der Lage sind, das soziale „Status-Symbol“ Akademische Freiheit zu einem echten Gestaltungsprinzip ihres Studiums zu machen, das auf die Sache, nämlich die Wissenschaft, und nicht auf den Stand der „akademischen Führungskräfte“ funktional bezogen ist, reduziert sich ihr Studium auf die mechanische, rezeptive ‚Aneignung‘ von speziellem Wissens-Stoff und Techniken, in der oft trügerischen Erwartung, dadurch die eigne intellektuelle ‚Kapazität‘ für den Verkauf auf dem Arbeitsmarkt besser ‚anzureichern‘.
Der Anspruch ‚standesgemäßer‘ akademischer Freiheit - als Schein nach außen aufrechterhalten -, wird in der Praxis des Studiums nicht mehr eingelöst: So sind in der Realität der heutigen Hochschulausbildung schon ganze Bereiche oder Abschnitte des Studiums faktisch in der Form des Unterrichts an Fachschulen organisiert, allerdings ohne deren Leistungsfähigkeit und Systematik zu erreichen. Denn die Aufrechterhaltung des weitgehend sinnentleerten Prinzips der akademischen Freiheit, verstanden nur noch als Freiheit von Leistungskontrolle und Studienplanung, verhindert oft gerade die rationelle Gestaltung des Studiums in der Art einer guten Fachschulausbildung und macht damit den Studenten nur zu einem schlechten Fachschüler.
Bei der Untersuchung dieses fachschulartigen Bereichs innerhalb der wissenschaftlichen Hochschule muß allerdings deutlich zwischen den rein äußerlichen, sachfremden und den wissenschaftsimmanenten Bedingungen seiner Entstehung unterschieden werden.
Es handelt sich einmal um die Tendenz, auf Grund kurzsichtiger Forderungen von Berufsverbänden und staatlichen Instanzen immer mehr Bestandteile des direkten Berufstrainings ebenfalls in der Hochschule anzusiedeln und die angeblich zu theoretischen und praxisfernen Züge des Studiums in den Hintergrund zu drängen. Diese in der Studienpraxis vielfach längst vollzogene Tendenz findet in dem akademischen „Konjunktur-Klima“ auch durchaus eine Resonanz unter der Studentenschaft.
Dahinter stehen z.T. ganz handfeste gesellschaftlich-politische Interessen von Machtgruppen, die bei einer „theoretischen“ Vertiefung des Studiums eine in ihrem Sinne unerwünschte Bewußtseinslage der Studenten befürchten.
Ein wesentlicher, durchaus sachfremder Grund der Verschulung des Studiums ist aber auch in der „Autoritätsstruktur“ der gegenwärtigen Universität zu suchen, auf deren historische Ursachen in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden kann. (Vgl. dazu Kapitel III, Akademische Freiheit und soziale Demokratie):
„Die Realität der Universität, weniger, was ihre akademischen Selbstverwaltungsorgane angeht als vielmehr ihr Unterrichtsbetrieb, d.h. das Verhältnis von Lehrer und Schüler im Unterrichtsbetrieb, widerspricht total, Einzelausnahmen mögen die Regel bestätigen, der Idee, auf die sich die Universität beruft. Die Universität ist in ihrem Unterrichtsvollzug und damit auch in der Gestaltung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses mehr und mehr Lernschule geworden, was die Ausgestaltung eines autoritären Lernprinzips zur Konsequenz hat.“ (4)
Die in den Unterrichtsveranstaltungen eingeübte Verhaltensweise, Lehrmeinungen und Arbeitsergebnisse des jeweiligen akademischen Lehrers ohne Diskussion unkritisch hinzunehmen, ohne Vergleiche mit anderen Lehrmeinungen und Methoden zu ziehen, transfomiert sich nicht nur in die gesellschaftlichen Verhaltensweisen der Studenten, sondern bestimmt auch ihr Verhältnis zur Wissenschaft überhaupt: Wissenschaft stellt sich ihnen nicht mehr dar als ein lebendiger Problemzusammenhang, als Prozeß ständiger Fragestellung, Kritik und Kooperation, sondern als eine Anhäufung „fertiger“ Ergebnisse im Sinne von „Tatsachen“, die in der Form des speziellen Informationswissens oder des allgemeinen Bildungswissens „gewußt“, nicht reflektiert werden.
Die aktuelle Notlage der deutschen Hochschulen - die Überfüllung der Seminare und Übungen, die Routine der Massenabfertigung der Studenten durch überlastete Dozenten, die sich durch den Eindruck der „Unnahbarkeit“ und durch die Barriere der Assistenten vor dem Massenandrang der Studenten zu schützen suchen, um sich einen „Raum der Freiheit“ zu bewahren - treibt das strukturbedingte autoritäre Lernprinzip nur noch auf die Spitze, weil nun selbst Professoren mit einer anderen Konzeption der Lehre, die eigentlich gegen den Strom schwimmen wollen, mitgerissen werden. (5)
Andererseits ist in den meisten wissenschaftlichen Fachrichtungen die selbständig-kritische Durchdringung wissenschaftlicher Probleme und Zusammenhänge nur dem möglich, der vorweg und laufend sich einen Grundbestand an systematisch erlernbarem Wissen und die genaue Kenntnis grundlegender Methoden und technischer Hilfsmittel erarbeitet. Das zeigt sich am deutlichsten in den Anfangstufen des naturwissenschaftlichen Studiums, beim Vorphysikum der Mediziner, bei den Kursen zur Erlernung und Übung von Sprachen in den philologischen Fächern.
Da es nicht Aufgabe der höheren allgemeinbildenden Schule sein kann, ihre Schüler wie an den Fachschulen systematisch speziellen Wissensstoff für die einzelnen wissenschaftlichen Ausbildungswege lernen zu lassen, bleibt die Lösung dieser Aufgabe den Universitäten und Hochschulen überlassen.
Im Unterschied zu dem vom Standpunkt der wissenschaftlichen Arbeit und Methodik her gesehen weitgehend toten Wissen, das die Studenten ansammeln, weil sie sich davon versprechen, in der Berufspraxis konkurrenzfähiger zu sein, handelt es sich hier um ein eng auf die wissenschaftliche Fragestellung und Arbeit bezogenes funktionales Wissen, nicht um ein Auswendiglernen einer Fülle von Fakten oder um antiquarisch-enzyklopädisches „Bildungswissen“.
Die Vermittlung einer solchen funktionalen Stoff- und Methodenkenntnis kann die Universität nur zum Teil anderen Institutionen - etwa Höheren Fachschulen, Sprachinstituten - überlassen. Das systematische Lernen dieses Grundlagenwissens muß im Bewußtsein der Studenten auf die wissenschaftliche Problematik ihres Faches bezogen bleiben.
Doch auch aus der inneren Entwicklung der Fachwissenschaften selbst kann die Gefahr der Verzerrung des Studiums zur mechanischen Stoff-Akkumulation erwachsen. Eine Form der Wissenschaft, die selbst sich im bloßen Sammeln, Registrieren und Klassifizieren ‚positiver‘ Fakten erschöpft, die Spezialisierung ohne Tiefgang betreibt und damit eine ganze Dimension der Wissenschaft praktisch negiert, kann nur eine gleichartige Deformierung des Studiums herbeiführen. Auch in negativer Hinsicht bleibt das Studium eng mit dem jeweiligen Niveau der wissenschaftlichen Arbeit verknüpft. Eine Wissenschaft, die es als „unwissenschaftlich“ denunziert, nach dem Sinn und Rechtsgrund jener „Fakten“ zu !ragen, die ihr als Material und Lebenszweck dienen, bildet aber auch keinen vielversprechenden Hintergrund für Bemühungen um die geistige Erziehung und Bildung junger Menschen.
„Die rein konstatierenden, philologischen Studien leisten Hilfsarbeiten, sie sind nützlich und unerläßlich, doch bleiben die Gelehrten im positivistischen Sinn, nach Nietzsches Wort bloß Angestellte der Wissenschaft. Sie sind also für die Wissenschaft, die Wissenschaft ist aber nicht für sie da. Wenn das von ihnen Festgestellte am Leben des Geistes teilhaben soll, muß es in theoretische Gedanken eingezogen werden, die nicht ausschließlich an das spezielle Fachgebiet gefesselt sind.“ (6)
I.3 Der Bildungs- und Erziehungsanspruch der Hochschule
Der Charakter des Studiums wird aber nicht nur durch seine Bezogenheit auf die Wissenschaft und die von ihr mitgeprägte Berufspraxis bestimmt, sondern ebenso durch die natürliche Tatsache, daß der Student noch ein junger Mensch ist, der sich in einer offenen Durchgangssituation befindet - von der festen Bindung in Schule und Elternhaus zur künftigen Einordnung in die Berufspraxis, ihre psychologischen oder direkt autoritären Fesseln. Die Offenheit der Lebenssituation und die relative Freizügigkeit der studentischen Existenz eröffnen die Chance, in dieser Zeit so intensiv wie es später niemals mehr möglich sein wird, die Persönlichkeit des Studenten zu prägen, Weichen zu stellen, die sein ganzes weiteres Leben mitbestimmen. Um so wichtiger wird es, danach zu fragen, welche Einflüsse in dieser Situation die Oberhand gewinnen.
I.3.1 Das klassische Bildungsideal der Universität
Gemäß dem klassischen Selbstverständnis der Universität Humboldts und Fichtes sollte in ihr allein die in „Einsamkeit und Freiheit“ geübte und erlernte Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Erkenntnis eine veredelnde Wirkung bei der Formung der menschlichen Persönlichkeit hervorbringen: „Bildung des Menschen durch Wissenschaft; durch eine Wissenschaft, welche nicht als ausgebreitetes Dogma, sondern als Einheit von Forschung und Lehre besteht.“ (7)
Das Studium wurde verstanden als ein ständiger Prozeß der freien individuellen Selbstentfaltung, zur Selbsterkenntnis des Menschen durch die schöpferische Methode des Erkennens der Welt, ein Prozeß, der auf sokratische Weise vom Lehrer in Gang zu setzen sei. Für den spekulativen Idealismus führt der freie Durchbruch des höheren Geistes der wissenschaftlichen Erkenntnis von selbst zur erfüllten Individualität, als Teilhabe am Selbstvollzug des Absoluten. (8)
In diesem Prozeß stehen sich Professoren und Studenten nicht wie Erzieher und Erziehungsobjekte gegenüber, sondern die akademischen Lehrer sind Fragende und Suchende wie ihre Studenten, mit denen sie in einem produktiven Dialog der Kritik und Selbstkritik stehen. In bewußter Abwendung von der alten zunftmäßig patriarchalischen Universität, dem schulmäßigen studium generale der Artisten-Fakultät mit ihren unmündigen Zöglingen, behandelte die klassische deutsche Universität ihre Studenten hartnäckig - im Zweifelsfalle auch gegen ihren Willen -als erwachsene Menschen. Sie ist ihrem Grundgedanken gemäß verpflichtet, daran festzuhalten, soll nicht die Freiheit der Wissenschaft selbst Schaden nehmen. Mit der Befreiung der Universität aus dem Gestrüpp des antiquierten Dogmas und zünftlerischer Privilegien zur Universität einer kritisch-rationalen Wissenschaft ging notwendig die Vertreibung der schulmäßigen Erziehung aus ihrem Hause einher. Mit der Methode der Bildung war auch die Stellung des Studenten in der Universität eindeutig und dauerhaft festgelegt. Die Selbstentfaltung der Persönlichkeit durch den höheren Geist der wissenschaftlichen Erkenntnis vollzieht sich auf höchst individuelle Weise, weshalb die akademische Freiheit des Studiums seine Grundvoraussetzung ist.
Die Aufgabe des studiums generale, der pädagogischen Vorbereitung zum Studium, übernahm die höhere allgemeinbildende Schule, während selbst der Begriff der ‚Pädagogik‘ für die Hochschule der erwachsenen Studenten als nicht sachgemäß erschien. (9)
I.3.2 Außerwissenschaftliche Erziehung?
Erst in der weitverzweigten Hochschulreformbewegung nach dem ersten und verstärkt nach dem zweiten Weltkrieg wurden wieder Stimmen laut, die aus dem inzwischen eingetretenen Wandel der Struktur und gesellschaftlichen Funktion der Universität (Vgl. Einleitung, Hochschule und Gesellschaft) glaubten, andersartige Konsequenzen ziehen zu müssen als jene, die allein den Bildungswert der wissenschaftlichen Erkenntnis in den Mittelpunkt stellten.
Diesen Bestrebungen war und ist gemeinsam der Ruf nach einer wie auch immer verstandenen außerwissenschaftlichen Erziehungsaufgabe der Universität gegenüber ihren Studenten, im Sinne einer Ergänzung der „in ihrem Kern als gesund“ betrachteten Universität Humboldts, so wie es Hermann Heimpel zuletzt verbindlich formuliert hat:
„Reform der bejahten idealistischen Universität kann also immer nur heißen: Ergänzung. Alle Hochschulreform ist somit ergänzende, den Kern bewahrende Reform. Sie ist … im Grunde beschlossen in der Überzeugung, daß zu den beiden Wesensmerkmalen von Forschung und Lehre die Erziehung als drittes Wesensmerkmal der Hochschule gefügt werden solle. Indem dabei Erziehung nicht gemeint ist als die im Sinne des Idealismus wirkende Menschenformung durch die wissenschaftliche Wahrheit selbst, sondern indem unter Erziehung verstanden wird eine außerhalb der Wissenschaft erstrebte pädagogische Einwirkung auf die Studenten, liegt in dieser Hinzufügung eines besonderen Erziehungsauftrages zu den alten Hochschulaufgaben der eigentliche revolutionäre Kern aller Hochschulreform.“ (10)
Zur Rechtfertigung derartiger Forderungen wird auf zwei unbestreitbare Tatsachen verwiesen:
– Die Änderung der sozialen Zusammensetzung der Studentenschaft bzw. des sozialen Hintergrundes, dem sie entstammen.
– Der seit Humboldts Zeiten eingetretene Wandel der Wissenschaft und ihrer Stellung in der Gesellschaft.
Der Hinwies auf die erstgenannte Entwicklung bleibt noch an der Oberfläche, wenn konstatiert wird, daß die Universität heute „mit einer großen Zahl von jungen Leuten zu rechnen hat, bei denen man den Impuls zur Selbstbildung durch Wissenschaft nicht voraussetzen oder erwarten kann. “ (11) Die soziale Umschichtung im Mittelstand (der zusammen mit der Oberschicht nach wie vor fast ausschließlich das soziale Einzugsfeld der Universität darstellt) im Gefolge des ersten Weltkrieges hat dazu geführt, daß weitaus weniger Studenten aus einem durch die Tradition der Einheit von Besitz und Bildung geprägten Elternhaus kommen. Zugleich hat aber der Ausbau des Schulwesens mit der Einbeziehung weiterer mittelständischer und kleinbürgerlicher Schichten in den Bereich der Oberschulbildung nicht Schritt gehalten, sondern ist das Niveau der Hochschulreife gesunken. „Ungeeignete“ Abiturienten strömen auf die Universitäten.
Doch dagegen ließe sich immerhin einwenden: erstens, daß die Mängel des Unterrichts in der Oberstufe vor dem Abitur tunlichst zu beseitigen seien; zweitens, daß auch Humboldt und Fichte vor ähnlichen Schwierigkeiten standen, als es noch nicht die relativ breite Schicht eines aufsteigenden Bildungsbürgertums gab, als noch mehr arme Stipendiaten unter den Studenten waren als gegen Ende des Jahrhunderts (12) und als das öffentliche höhere Schulwesen noch nicht voll aufgebaut war. Dennoch entwarfen sie eine Universität für eine Minderheit besonders geeigneter und vorbereiteter Studenten, aber ohne zugleich die Mehrzahl der weniger geeigneten und eigentlich ungeeigneten durch ein Prüfungssystem auszuschließen.
„Es ist keineswegs so, daß um 1810, um 1890, um 1914 oder 1931 „die“ Studenten dem Maß der Universität und Hochschule entsprochen hätten. Wie in allen Berufen war stets nur 1/3 der Studentenschaft dem geforderten Maß von vornherein entsprechend, 1/3 gehörte im Grunde nicht auf die Universitäten und Hochschulen, 1/3 wurde zu echten Studenten, wenn die entsprechenden Anforderungen dadurch an dieses Drittel gestellt wurden, daß Form und Maß der Universität nicht auf sie, sondern auf das eigentlich erste Drittel berechnet war“. (13)
Zum Kern der Problematik stößt dagegen der zweite Hinweis vor, der erst kürzlich von Helmut Schelsky konsequent dargestellt wurde:
„In der wissenschaftlichen Zivilisation kann sich die Wissenschaft nicht mehr vom praktischen Leben abgrenzen, sondern sie reicht in vielerlei Abstufungen unmittelbar bis in die letzte praktische Tätigkeit. Damit ist die Wissenschaft zur Substanz des praktischen Handelns heute selbst geworden und daher an sich keineswegs mehr Trägei einer sich über das praktische Leben und seine Zweckanforderungen erhebenden Bildung. Diese Grundprämisse der deutschen Universitätsidee und Bildungsvorstellung muß fallengelassen werden. Wissenschaft und Bildung haben ein grundsätzlich anderes Verhältnis zueinander angenommen als zur Zeit Humboldts.“ (14)
Die von der Philosophie des Idealismus durchdrungene Wissenschaft wurde zur „Wissenschaft als Beruf“ (Max Weber), die „Hohe Schule“ zum „Wissenschafts-Betrieb“. Der Ruf nach der außerwissenschaftlichen Erziehung der Studenten aber ist das Eingeständnis der Tatsache, daß in der heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit Bildung im idealistischen Sinne eines Humboldt, Fichte, Schelling oder Schleiermacher nicht mehr lebensfähig ist.
Damit erweist sich explicite der inhaltlich fiktive Charakter einer Bildungsidee, die glaubte, die Befreiung des Menschen zur schöpferisch sich entfaltenden autonomen Person schon erreicht zu haben mit dem Ideal des Gelehrten, der im spekulativen Akt aus den grob-materiellen Niederungen der Gesellschaft in eine lichte Sphäre geistiger Freiheit hinübertritt; ein Bildungsideal, das nur zu deutlich die Züge einer vergeistigten Ersatz-Revolution des deutschen Besitz- und Bildungsbürgertums an sich trägt, das den Anspruch auf politische Selbstbestimmung nicht zu verwirklichen vermochte. Die Ersatzlösung der außerwissenschaftlichen Erziehung als ein Allheilmittel für alle Mängel der Hochschulbildung bezeichnet den Endpunkt einer Entwicklung der Beziehung von Universität und Gesellschaft in Deutschland, in deren Verlauf auch die geistige ErsatzRevolution sich schließlich verflüchtigte und zu einem leeren „Bildungsideal“ verkam, das nur noch eine dekorative Funktion zur Fundierung des Sozialprestiges des Akademikerstandes in einer restaurativen Gesellschaft hat.
Das der Wirklichkeit des Wissenschaftsbetriebes entfremdete Bildungsideal der Humboldtschen Universität tritt dieser Universität heute von außen entgegen als Bestandteil einer ideologischen „akademischen Weltanschauung“. (15)
Dieser Rückblick auf den historischen Gesellschaftszusammenhang, in dem die deutschen Universität steht, macht deutlich, daß die „revolutionäre“ Forderung nach außerwissenschaftlicher Erziehung und Bildung der Studenten nicht nur deshalb erhoben wird, um die Studenten in einer veränderten sozialen Umwelt wieder an den Kern des freien wissenschaftlichen Studiums heranzuführen. Dieser im Grunde ‚restaurativ-revolutionäre‘ Angriff auf den traditionellen Charakter und Sinn des Studiums erhält vielmehr seinen Hauptantrieb aus politisch-weltanschaulichen Motiven in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Denn in den variantenreichen Erziehungs- und Bildungsleitbildern, die in den letzten Jahrzehnten aufgestellt wurden, werden Ziele verfolgt, die weit über das ursprüngliche Bildungsziel der Universität hinausgehen.
I.3.3 Die Erziehungsleitbilder
Im Rahmen der Bemühungen um die außerwissenschaftliche „dritte Aufgabe der Universtität“ (Heimpel) werden gegenwärtig verschiedene, z.T. konkurrierende ‚Erziehungsleitbilder‘ vertreten, die sich in der Praxis des ‚Bildungstriebs‘ naturgemäß nicht so plastisch abzeichnen:
– Die allgemein-menschliche Erziehung zu allseitiger Entwicklung der menschlichen Person durch Pflege des Musischen, der Leibesübungen und der Geistesbildung.
– Eine akademische Standes-Erziehung in Anknüpfung an entleerte und formalisierte bildungshumanistische Traditionen oder Erziehungsziele der Korporationen.
– Die demokratische Gemeinschaftserziehung, unter Übernahme angel-sächsischer Traditionen, zur Einübung partnerschaftlicher, sozialer Verhaltensweisen.
– Pflege der Allgemeinbildung durch studium generale als spezifische Form der Erwachsenenbildung in Fortsetzung der bildungshumanistischen Tradition des deutschen Gymnasiums, aber einschließlich politischer Bildung.
– Politische Bildung als Weiterentwicklung der ‚Staatsbürgerkunde‘ in der Schule, zur Wissensvermittlung, verbunden mit der Erzeugung politischen Engagements.
I.3.4 Allgemein-menschliche Erziehung
Das Leitbild der allseitigen menschlichen Erziehung ist in seinen Zielen und Methoden die intensivste Form der außerwissenschaftlichen Erziehung. Derartige Bestrebungen knüpfen z.T. an die Bildungskonzeption des Kultusministers C. H. Becker für die von ihm geschaffenen Pädagogischen Akademien an, deren damalige Bildungsziele nun auf die Universitäten übertragen werden sollen. Becker entwickelte seinen Bildungsbegriff in der Kritik an dem angeblich zu einseitig intellektuellen Bildungsideal der Universitäten. Er setzte dem „das nicht wissenschaftlich zu begründende, sondern aus dem wirklichen Sein des Menschen praktisch gesetzte Ideal einer harmonisch alle menschlichen Kräfte entwickelnden Gesamtpersönlichkeit“ entgegen, aus der „Sehnsucht nach einem neuen Menschenbild“, das schließlich auch das aus dem Idealismus stammende Universitätsideal umgestalten sollte. (16)
Obwohl nach dem zweiten Weltkrieg schon in den ersten Jahren zu erkennen war, daß die grundlegende geistige Erneuerung des deutschen Bildungswesens ausbleiben würde, wurde nun vielfach ein Anspruch auf Formung der Gesamtpersönlichkeit des Studenten erhoben. Darin kam aber nur das Abgleiten der Hochschulreformdiskussion auf ein Nebengleis zum Ausdruck. Sie wandte sich vom angeblich „gesunden Kern“ der Hochschule - der Vorherrschaft der Ordinarien, dem autoritären Lehrprinzip - ab und der „bildungsunwilligen, bildungsfähig“, „gesichtslosen Masse“ der Studenten zu. (17) Diesen orientierungslosen Studenten sollte „die notwendige menschliche Führung und Förderung“ zuteil werden. Aber bald schon glaubte man, den Anspruch nicht durchhalten zu können, der im „Blauen Gutachten“ von 1948 aufgestellt wurde: daß das „mächtigste Erziehungsmittel der Hochschule die aktive Beziehung des Lehrers zur neu zu findenden Wahrheit ist“, sondern eine nun außerwissenschaftlich genannte Erziehung zur Gesamtpersönlichkeit mit sittlichem und politischem Verantwortungsgefühl sollte wenigstens für eine Minderheit der Studenten durch Tutoren in Wohnheimen verwirklicht werden.
Als Ersatz für die ausgebliebene Umgestaltung im Kern der Hochschule sollte wenigstens an der Peripherie und für einen Teil der Studenten der neue pädagogische Auftrag der Hochschule, die „Führung und Erziehung der Studenten über das Fachliche hinaus“ (Hofgeismarer Kreis) vollzogen werden
I.3.4 Wohnheim - College - Campus als Erziehungsmittel
So wird bis heute der Bau von Studentenwohnheimen nicht so sehr aus praktisch-sozialpolitischen Erfordernissen, zur Bewältigung der Wohnungsnot der Studenten, forciert, sondern um die studentischen Massen wieder in „kleine organische Zellen zurückgliedern“ zu können (18), um eine spezifisch akademische ‚Heimatmosphäre‘ mit bestimmten Bildungszielen zu schaffen. Ihren bisherigen Höhepunkt erreichten diese Bestrebungen, die vom Deutschen Studentenwerk und dem Wohnheimbeauftragten der WRK maßgeblich vorangetrieben wurden, in den Vorstellungen über die Gestaltung der vom Wissenschaftsrat empfohlenen neuen Universitäten nach dem College- oder dem Campus-Modell.
In dem Plan zur Gründung einer Universität in Bremen von H. W. Rothe wird z.B. ein geschlossenes System der Hochschule als Erziehungsstätte, die perfekte „Heimuniversität“ entwickelt. Die neue Universität soll in der Form eines geschlossenen und abgeschlossenen Campus in enger Verbindung mit zahlreichen Studentenwohnheimen errichtet werden, in denen zunächst nur alle Studenten der ersten Semester, eigentlich, im Endziel, jedoch alle Studenten wohnen sollen. Die Universitätsheime sollen nicht den Typus des offenen und freien Heimes entsprechen, denn „die Festlegung von ‚Leitideen‘, z.B. das ‚Politische‚ das ‚Musische‘, das ‚Sportliche‘, unter die gleichsam das Leben, in einzelnen Heimen treten könnte, dürfte die neue Universität nicht dem Zufall überlassen.“, sie soll eine „Gesamtkonzeption für die innere Gestaltung ihrer Studentenwohnheime“ verbindlich machen. (19) Das Leitbild: … die „harmonisch alle menschlichen Kräfte entwickelnde Persönlichkeitsbildung, … sittliche Verantwortung … gegenüber Staat und Gesellschaft“ (20) Nach den Vorstellungen des Wohnheimbeauftragten der WRK soll für je 30 bis 35 Heimwohner ein Tutor eingesetzt werden.
Das Modell der Erziehungs- oder Heimuniversität stellt den bisher konsequentesten Angriff auf die Mündigkeit der Studenten und die akademische Freiheit dar. Die Studentenschaft wird sich energisch und mit begründeten Argumenten gegen diese ‚Hochschulreform nach rückwärts‘ zur Wehr setzen müssen, in enger Verbindung mit den im positiven Sinne ‚unversitäts-konservativen‘ Professoren.
Die College-Erziehung entspricht eigentlich einer Gesellschaftsordnung, in der sich ein homogenes soziales Erziehungsleitbild auf Grund eines einheitlichen Menschenbildes durchgesetzt hat (z.B. das des „gentleman“ im alten England oder das Menschenbild der sowjetischen Universität). In unsere pluralistisch-antagonistischen Gesellschaft wirkt es dagegen wie ein Relikt der mittelalterlichen Universität, die es, vor allem in dem vorgeschalteten studium generale, zudem mit viel jüngeren Studenten zu tun hatte. Sie gehört vor allem in eine Form der ‚Universitätserziehung‘ mit wesentlich stärkerer Studienkontrolle ohne akademische Freiheit. Dieses Erziehungssystem, das in England relativ bruchlos aus der ständischen in die Klassengesellschaft überführt wurde und zusammen mit den „Public Schools“ eine Hauptstütze der Klassenherrschaft bildete, widerspricht selbst in der abgewandelten Form der Heimuniversität zutiefst dem Bildungssystem einer dem Anspruch nach sich demokratisierenden Gesellschaftsordnung. Diese dürfte den Akademiker eigentlich nicht als Vertreter einer privilegierten Führungs-Elite, sondern als Staatsbürger wie jeden anderen ansehen, da nicht die Isolierung der Akademiker und Studenten vom gesamten Volk, sondern ihre „Offenheit zum Volk“ im Sinne einer lebendigen gesellschaftlichen Praxis gefordert ist. (21) Die Isolierung und Betreuung der Studenten in einem von der Stadt sich abschließenden Campus oder Studentendorf leistet jedoch der Entwicklung einer Atmosphäre des „Elfenbeinturms“ oder aber sozialen Elite-Vorstellungen Vorschub.
Die Behauptung, der Student müsse erst in Wohnheimen zur harmonischen Entfaltung seiner Gesamtpersönlichkeit anhalten und zu sittlicher Verantwortung erzogen werden, negiert aber vor allem die Mündigkeit des Studenten, der nicht wie ein junger Erwachsener, sondern wie ein unmündiger Schüler behandelt wird. Der Versuch der intensiven Lenkung und erzieherischen Beeinflussung der Studenten durch Tutoren und Heimleiter führt entweder zu schweren psychologischen Spannungen und persönlichen Auseinandersetzungen, oder die zu einem echten wissenschaftlichen Studium erforderliche Entwicklung zu geistiger Selbständigkeit und kritischem Urteilsvermögen wird von vornherein verhindert. Die schon bestehenden autoritären Verzerrungen im akademischen Unterrichtssystem werden durch eine hinzukommende erzieherische Betreuung im Bewußtsein zumal der jüngeren Studenten noch verstärkt.
Von Studenten, die in Wohnheimen oder Kollegien als unmündige Erziehungsobjekte behandelt werden, kann nicht ohne weiteres erwartet werden, daß sie sich im Seminar ohne schädliche Autoritätsgläubigkeit kritisch an einer Diskussion beteiligen und selbständig wissenschaftlich arbeiten. (22)
Außer diesen psychologischen Vorbehalten muß aber auch festgestellt werden, daß die Ziele dieser direkten erzieherischen Betreuung in sich fragwürdig sind. In einer Gesellschaft, die kein allgemeinverbindliches Erziehungsprinzip und Lebensethos mehr kennt, in der die unterschiedlichsten religiösen, weltanschaulichen, berufsständischen, politischen Erziehungsanschauungen vertreten werden, müssen die Ziele einer so intensiven Erziehung, die den ganzen Menschen ‚erfassen‘ will, entweder inhaltsleer oder manipulativ werden.
Nach dem Nullpunkt von 1945 ist das entstandene geistige Vakuum in der deutschen Universität nicht durch eine neue soziale Bildungsidee gefüllt worden. Da die geistige Erneuerung der Universität nach ihrer Pervertierung im Dritten Reich (23) ausblieb, muß dieser Universität energisch das Recht abgesprochen werden, ihre Studenten auf ein verbindliches Erziehungsbild zu verpflichten.
Sollte ein solcher Anspruch dennoch durchgesetzt werden, so muß das Leitbild der „sittlichen und politischen Verantwortung“ entweder zur leeren Phrase erstarren, über deren Hohlheit sich alle Beteiligten stillschweigend verständigen, oder die Studenten werden den unterschiedlichsten Konkretisierungen dieses Erziehungsziels unterworfen - von den Relikten des Bildungshumanismus, dem ‚Gedankengut‘ der Korporationen, oder des Liberalismus, bis zu den Leitsätzen der katholischen Soziallehre - je nachdem, was von einzelnen Heimleitern, akademischen Direktoren oder Tutoren in den Heimgemeinschaften den Studenten aufgedrängt wird. Mögen die Inhalte noch so unterschiedlich sein, für den einzelnen Studenten, der sich in ein bestimmtes Heim oder Kolleg einzuordnen hat, haben sie den Charakter der Indoktrination. Außenseiter, die sich der väterlichen Führung durch den Tutor und seine Arbeitskreise widersetzen, würden sehr bald von der ‚Gemeinschaft‘ unter moralischen Druck gesetzt oder ausgeschieden. Der bedrohliche Konformismus, der durch die amerikanische College-Erziehung erzeugt wird, wäre die Endstation dieses Weges. Hinzukommt allerdings, daß die Verpflanzung des College-Systems aus den angelsächsischen Demokratien nach Deutschland, in eine Gesellschaft ohne deren lebendige ‚Fundamental-Demokratisierung‘, in eine noch autoritärere Universitäts-Atmosphäre, wohl unmittelbare politische Konsequenzen hätte:
Ein System der intensiven sozialen Kontrolle einer in ‚kleinen Zellen‘ organisierten Studentenschaft wurde zum Instrument der weltanschaulich-politischen „Disziplinierung“ und Beeinflussung der Studenten. Schon wird unter Hinweis auf „linksradikale Studentenmassen“ in den französischen Studentensiedlungen nach Anzeichen einer „kommunistischen Unterwanderung“ von Studentendörfern gefahndet. Das Deutsche Studentenwerk hat, wie sein Vorsitzender, Prof. Hallermann im Juni 1961 erklärte, ebenso wie die westdeutsche Rektoren-Konferenz, gegen den Bau von großen Studentendörfern Bedenken, falls nicht „institutionelle Hilfen“ eingebaut werden, die sicherstellen, „daß solche Studentenzentren nicht bei Spannungen zwischen Hochschullehrern und Studentenschaft oder in politisch unruhigen Zeiten zu Ausgangspunkten organisierter Unruhen werden. “ Aus diesem Grunde müsse die Universität neben Forschung und Lehre auch einen unmittelbaren Erziehungsauftrag wahrnehmen. (24)
Das Studentenwerk, einst ein Selbsthilfeinstrument der Studentenschaft, hat sich der demokratischen studentischen Selbstverwaltung entfremdet und bietet sich den herrschenden gesellschaftlichen Kräften als politisches Machtinstrument zur Indoktrination der Studenten an.
Neben dem Anspruch, durch erzieherische Betreuung den ganzen Menschen zu erfassen, haben in der Auseinandersetzung um die Erziehungsaufgabe der Universität zwei konkurrierende Erziehungsvorstellungen eine Rolle gespielt, die sich auf die Einübung bestimmter sozialer Haltungen, Gefühle, Verhaltensweisen beschränken:
Der Gedanke der „demokratischen Erziehung“, der ebenfalls in Wohnheimen, aber auch durch die „Erziehungsinstrumente“ Studentenvertretung und „studentisches Gemeinschaftsleben“ realisiert werden sollte.
Das traditionelle Leitbild einer akademischen Standeserziehung, das ursprünglich nur in den Korporationen gepflegt, nun auch in Bildungskonzeptionen der Wohnheime in Erscheinung zu treten beginnt.
I.3.5 Akademische Standeserziehung
Jene Erziehungsvorstellungen, die ein besonderes akademisches Menschenbild, oder „das Akademische“ als ‚geistiges Prinzip‘ hervorkehren (25),sind vor dem historischen Hintergrund der Entleerung und Formalisierung der Bildungsidee des Idealismus zum ideologischen Integrationsmittel eines „nationalen“ Bürgertums zu sehen, in dem sich der Kult der „Innerlichkeit“ mit der Anbetung nationaler Macht und „Realpolitik“ mischt, in dem die besondere Weihe des eigentlichen, des ‚geistigen Menschentums‘ zur Rechtfertigung des sozialen Führungsanspruchs des Akademikers dient, der sich durch eine besondere akademische ‚Haltung‘ und Ehre von der ‚Menge‘ abhebt. Den Studenten soll jene Haltung „zuchtvoller Unterordnung“ im Dienste der „nationalen Kulturgemeinschaft“, in „Gehorsam und Treue gegenüber Staat und Hochschule“, die Wahrung der „akademischen Würde“ gegen „Lässigkeit und Entartung“ anerzogen werden, die den ‚deutschen Akademiker‘ auszeichnet. (26)
Denn: „Die gemeinsame Lösung praktischer Aufgaben erfordert … Anordnung, Führung und Bindung auf der einen Seite, Hinordnung, Gefolgschaft und Mitgehen auf der anderen Seite. “ (27) Solche Akademiker sind wieder sehr gefragt: „Die Industrie“ verlangt nach der „Führungspersönlichkeit“, die kraft ihrer „Leitbilder des Ganzen“ die hochindustrialisierte Gesellschaft noch verstehen und lenken kann, wie es in einer Schrift des Stifterverbandes heißt.
Das ständische akademische Erziehungsleitbild ist mit der Restauration der vorfaschistischen bürgerlichen Herrschaftspositionen nach 1945 nicht nur direkt, durch die organisierte „Wiederbelebung“ der Korporationen neu gestärkt worden, sondern angesichts der politischen Diskreditierung des „Waffenstudententums“ in der Entwicklung zum Dritten Reich wurde der Versuch unternommen, in der Universität selbst abgewandelte, aber spezifisch ‚akademische‘ Formen der Erziehung einzuführen. Dazu dient die stärkere Betonung der „Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden“ in einem Sinne, der mit dem Gedanken der Demokratisierung der Hochschule und der Emanzipation der Studentenschaft nichts gemein hat, sondern ein „existentielles Hineinwachsen“ der Studenten in die „akademische Lebensgemeinschaft“ meint (28), die „ethische Totalbindung“ der Persönlichkeit des Studenten an das „Ethos“ der akademischen Gemeinschaft (29), an „akademische Zucht und Sitte“ (so Prof. H. Thieme als Rektor in Freiburg. WRK und Stifterverband haben 196o eine Schrift mit einem 1. Preis ausgezeichnet, die von einem neuen verbindlichen Studium Universale eine „Besinnung auf das akademische Ethos und Standesbewußtsein“ erhofft und in der auch wieder von der „Erziehung einer völkischen Elite“ die Rede ist („Eine gesunde Demokratie hat in sich einen Zug zur Aristokratie. “), und, „die Ablehnung eines Wissens aus einer prinzipiell überwissenschaftlichen Erkenntnisquelle“ als „Verrat am Geist“ denunziert wird. Denn Bildung ist „das Wagnis der Hingabe an das Absolute … Der Akademiker ist der Mensch der sich einordnet in den ontischen Werte Kosmos.. nur von daher empfängt sein Leben Gestalt und Würde.“ (30)
Studentenwohnheime mit akademischen Tutoren gelten als Einrichtungen, „in denen auch Massen von Studenten im Sinne einer akademischen Gemeinschaft zusammengehalten werden können“. (31) Das studentische Disziplinarrecht wird nicht als eine äußerliche „Verkehrsregelung“ verstanden, sondern zum Erziehungsmittel erhoben.
Angesichts der zunehmenden Annäherung des ursprünglich unabhängigen akademischen Leitbildes der Universitäten an das der Korporationen ist es nur konsequent, wenn in letzter Zeit sogar die Verschmelzung dieser Verbindungen als ständische Selbsterziehungskörperschaften mit der „Universitätsgemeinschaft“ gefordert wird. Professor E. Aurich („Die Idee der Deutschen Universität und die Reform der Deutschen Universitäten“, 1960), selbst ein „Alter Herr“, will die Korporationen zum Unterorgan des Organs Universität erhoben sehen. Im Bremer Universitätsplan wird die stärkere Heranführung der studentischen Verbindungen als Träger der Erziehungsaufgabe an die Univertät gefordert. (32)
Dieses Konzept erscheint um so gefährlicher für die weitere gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik, weil es bei einer relativ großen Minderheit der Studentenschaft, die bereits durch ein akademisches Elternhaus oder entsprechende Schulbildung vorgeprägt ist, auf die entsprechende Resonanz stößt. Wie aus der empirischen Studie „Student und Politik“ hervorgeht, ist das Gesellschaftsbild der sog. „Geistigen Elite“ unter den Studenten mit 23'-' [FEHLER] an erster Stelle vertreten, ein Modell, in dem „gleichsam naturgegebene soziale Unterschiede zwischen der durch ‚innere Geisteshaltung‘, ‚Moral‘, ‚Charakter‘ und ‚Lebensstil‘ zur Elite berufenen Bildungsschicht auf der einen, der breiten Masse der Ungebildeten auf der anderen Seite ... in einer Art ständischen Hierarchie“ gesehen werden. Zusammen mit verwandten sozialen Herrschaftsvorstellungen ergibt sich eine feste Gruppe von rd. 1,3 FEHLER der Studentenschaft, die zugleich im besonderen Maße obrigkeitliche Autorität wünscht und Demokratie als ‚Vermassung‘ beklagt. (33)
I.3.6 Demokratische Erziehung
In dem Gedanken der ‚demokratischen Gemeinschaftserziehung‘, der in bewußter Distanzierung von den traditionellen akademischen Erziehungsleitbildern in der Nachkriegszeit entwickelt wurde, ist dagegen ein relativ progressiver Ansatz gefunden. In Fortsetzung der ‚Gemeinschaftskunde‘ (Sozialkunde) und der ‚Partnerschaftserziehung‘ in der Schule (34) sollen auch die Studenten weiterhin zu demokratischen Verhaltensweisen und Gesinnungen erzogen werden, die umschrieben werden mit Begriffen wie: Toleranz, Bereitschaft zur Diskussion und zum Kompromiß, soziales Verantwortungsgefühl etc. Erziehung zur Demokratie als Lebensform muß von vornherein Selbsterziehung in einem freien Gemeinschaftsleben sein, allerdings unter beratender Führung durch den Lehrer. So sollen als Übungsfelder für die demokratische Erziehung die freien studentischen Gemeinschaften, studentische Diskussions-Fora oder Debattier-Klubs, die Studentenvertretung und die Selbstverwaltung in Wohnheimen dienen.
Sosehr aber die Einübung demokratischer Verhaltensweisen im Alltag als eine der Grundelemente einer funktionierenden gesellschaftlichen Demokratie anzusehen ist - die allerdings in der bundesrepublikanischen Gesellschaftsordnung noch kaum entwickelt ist - so sind doch ernste Einwendungen gegen diese direkte, formale Erziehungsmethode im Rahmen der Universität zu erheben:
- Denn was in der Schule nützlich, ja notwendig sein mag, kann in der Hochschule eher Schaden anrichten. Indem die Übung demokratischen Verhaltens als Erziehungsziel zu sehr in den Vordergrund geschoben wird, entsteht eine künstliche Atmosphäre des ‚moralischen Zeigefingers‘, die auf Studenten, die auf ihre persönliche Selbständigkeit bedacht sind, geradezu abstoßend wirken kann. Diskussionen und Selbstverwaltungsformen als Selbstzweck mit erzieherischer Absicht wirken steril.
- Durch die Betonung der mitmenschlichen Beziehung auf sittlicher Grundlage im überschaubaren Bereich von ‚Gemeinschaften‘ wird ein falsches Verhältnis zu Politik und Demokratie geschaffen. Es wird unterstellt, daß die Gesellschaft gewissermaßen ein ins Überdimensionale gesteigertes Modell der ‚Gemeinschaft‘ darstellt, daß auch in der Politik reale gesellschaftliche Widersprüche durch demokratischen Stil und soziale Gesinnung ‚wegdiskutiert‘ werden können. Die objektiven Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung, die fest institutionalisierten Herrschaftsstrukturen werden nicht bewußt gemacht, sondern auf wertbezogene Handlungen und Gesinnungen reduziert.
- Die studentische Selbstverwaltung - eigentlich eine politische Selbstverständlichkeit - wird zum erzieherisch wertvollen „Sandkartenspiel“ ohne reale Aufgaben entwertet, während im Kern der Hochschule jeder Versuch der Demokratisierung vereitelt wird. Eine solche Haltung gerät in den Verdacht, durch Umdeutung der Studentenvertretung in ein Erziehungsmittel die „Diktatur der Ordinarien“ aufrechterhalten zu wollen.
Dennoch gibt es unter der Studentenschaft eine Minderheit, die besonders durch ein demokratisches ‚Gemeinschaftsleben‘ anzusprechen wäre. Es sind jene Studenten mit dem Gesellschaftsbild der „sozialen Gleichheit“ oder der sich nivellierenden Massengesellschaft, die soziale Unterschiede nur als eingebildete Vorurteile betrachten, die „an sich“ gar nicht bestehen bzw. durch i FEHLER Leistung beruflichen Aufstieg leicht zu durchbrechen sind, Vorstellungen die einhergehen „mit bemerkenswerter Blindheit gegenüber den Erscheinungen gesellschaftlicher Macht. “ (35) Diese Gruppe von rd. 22% der Studentenschaft, die zu zwei Dritteln eine durchaus demokratische politische Tendenz aufweist (36), würde durch eine formal bleibende demokratische ‚Partnerschaftserziehung‘ in ihren z.T. recht naiven gesellschaftlich-politischen Vorstellungen nur noch bestärkt werden, während umgekehrt jene Studenten, die „innere Werte“ gegen Macht und Geld, gegen das ‚politische Geschäft‘ überhaupt ausspielen oder die sich eo ipso zur sozialen Führungselite rechnen, durch demokratische Übungsspiele kaum überzeugt werden.
Die Übung im politischen Denken und Handeln im Sinne eine Demokratie, die nicht als verschwommene Gesinnung, sondern als realer gesellschaftlicher Prozeß zu begreifen ist, kann nicht durch eine formale, spielerische Erziehung, sondern nur durch realistische gesellschaftliche Praxis inmitten dieses Prozesses und seiner Widersprüche erfolgen, indem der Student als Beschäftigter in einem Betrieb, als aktives Mitglied einer politischen Organisation oder als Studentenvertreter mit realen politischen Zielen dem wirklichen gesellschaftlichen Kräftespiel ausgesetzt ist.
I.3.7 Studium generale
Verknüpft mit den Bestrebungen nach einer direkten außerwissenschaftlichen Erziehung, z.T. aber auch unabhängig davon, wurde schon in der Nachkriegszeit als eine weniger intensive Form der Erziehung die Vermittlung von Allgemeinwissen durch das Studium generale neben dem Fachstudium angestrebt. Der Grundzug dieser Konzeption - seit dem Gutachten des Hamburger Studienausschusses von 1948 - ist die Auffassung, die Versäumnisse der Schule sollten durch die Vermittlung von naturgemäß popularisierten Kenntnissen aus einem Kanon von Grundgebieten für alle Studenten nachgeholt werden: aus dem Bereich von Philisophie, Geschichte, Soziologie, Volkswirtschaft, Psychologie, aber auch Religion, Pädagogik, Bildende Kunst, Musik, Naturwissenschaften. Dieses Allgemeinwissen, das der „Stärkung des Ganzheitscharakters der Universität“ (37) dienen soll, wird aber unter einem bestimmten Vorzeichen gesehen: Es soll die Einheit und ‚Richtigkeit‘ der Bildung aus dem „abendländischen Kulturerbe“, die „sittlichen und religiösen Fundamente des gesellschaftlichen Zusammenlebens“ zum Bewußtsein bringen, wie es in dem sog. „Blauen Gutachten“ von 1948 heißt. Weniger eine kritisch-aufklärerische Wirkung ist beabsichtigt, als vielmehr die Vermittlung von ‚ewigen Werten‘ abendländischer Kultur. (38) In der Praxis solcher Wissensvermittlung müssen daher entweder die gängigen oberflächlichen Relikte des Bildungshumanismus im Vordergrund stehen, oder ein derartiges Studium generale wird für einzelne Lehrstuhlinhaber und Tutoren zum Instrument der weltanschaulichen Mission, der intensiven Formung des Weltbildes der Studenten.
(So bejaht die Katholische Deutsche Studenten-Einigung das Studium generale - „Stellt es doch eine uns gegebene Möglichkeit dar, in der Begegnung mit allen Erscheinungsformen menschlichen Geistes ein gültiges Weltbild zu erarbeiten. “) (39)
Wegen der autoritären Wirkungen des gegenwärtigen Lehrbetriebs der Universität und angesichts des immer stärker betonten einseitigen Erziehungsanspruchs besteht jedoch nicht die Chance, daß ein Studium generale mit weltanschaulichen Vorzeichen den Charakter einer offenen kritischen Auseinandersetzung zwischen den einzelnen akademischen Lehrern und unter den Studenten erhielte. Die popularisierte, notwendigerweise oberfläch liehe Vermittlung eines Grundbestandes an ‚Bildungswissen‘, etwa in einem Lehrgang in den Anfangssemestern (‚studium fundamentale‘) ermöglicht auch kaum eine kritische Haltung der Studenten gegenüber dem Stoff und den darin verborgenen weltanschaulichen Vorentscheidungen.
Ein anderer Zugang zum Sinn eines Studiums generale ergibt sich aus der gesellschaftlichen Funktion, die es mit oder ohne Billigung seiner Initiatoren annähme: ‚Die Industrie‘ fordert laut Stifterverband den „unspezifisch, aber dafür um so breiter und tiefer gebildeten Akademiker mit Führungseigenschaften“ - und ein Arbeitskreis des „Rationalisierungskuratoriums der Deutschen Wirtschaft“ stellt fest: „So ist für die Übernahme leitender Funktionen eine gute Allgemeinbildung erforderlich. Nach Auffassung des Arbeitskreises ist deshalb ein Studium generale im wörtlichen Sinne wünschenswert. “ (40)
„Wenn allgemeine Bildung im neunzehnten Jahrhundert für den erfolgreichen Unternehmer in vieler Hinsicht selbstverständlich war, ohne daß sie ganz im praktischen Zwecke, aufzugehen schein, so wird sie jetzt für den künftigen Generaldirektor, ja den Manager überhaupt, als Mittel zum Zweck empfohlen.“ Kultur wird zum „Hilfsartikel der Produktion“. (Horkheimer) (41)
Die Vermittlung oberflächlichen Bildungswissens aus dem Füllhorn des abendländischen Kulturerbes entspricht allerdings weniger dem gesamtgesellschaftlichen Interesse auf sinnvolle wissenschaftliche Ausbildung der Studenten für Funktionen in einer hochindustrialisierten Gesellschaft als vielmehr den Herrschaftsinteressen der faktischen Inhaber des staatlichen und wirtschaftlichen Machtapparates, die die Struktur der Nachfrage auf dem akademischen Arbeitsmarkt bestimmen. Solche „Allgemeinbildung“, von idealistischen Universitätsideologen ersonnen als Ergänzung der wissenschaftlichen Spezialausbildung, wendet sich aber damit letztlich gegen den wissenschaftlichen Kern des Studiums selbst. Das, was als Rahmen eines intensiven wissenschaftlichen Fachstudiums gedacht war, gerinnt mehr und mehr zum Selbstzweck. Die Universität hat in der Hochschulpolitik der Unternehmer, wie sie vor allem vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ausgeführt wird, aber auch in der Sicht der Partei- und Verwaltungsspitzen, ihren hervorragenden Stellenwert als vornehmster Ideologielieferant einer restaurativen Gesellschaft. Die Universität soll den künftigen Staats- und Wirtschaftsfunktionären - den „Führungskräften im engeren Sinne“, aber auch ihren geistes- und naturwissenschaftlich ausgebildeten ‚Hilfskräften‘ in den „Beratungs- und Stabsstellen“ (42) - „Leitbilder des Ganzen“ vermitteln, die ihnen eine selbstsichere Führu:hg gestatten. (Das ist selbstverständlich eine langfristige Zielvorstellung. Die Ideologi iierung der Wissenschaft geschieht langsam; es genügt vorerst, wenn Freiheit nicht mehr anders vorstellbar ist, denn als Freiheit der Unternehmer, und Wirtschaft nicht mehr anders, denn als sogenannte ‚soziale Marktwirtschaft‘.)
Eine solche Einplanung der Universitätsausbildung sieht sich bedroht durch jene unbescheidenen Wissenschaftler, die über die Erkenntnis zu Forderungen kommen und nicht in Demut die Grenzen der Anwendbarkeit der Wahrheit respektieren. Denn: „Wenn wir von Ehrfurcht vor der wissenschaftlich erfahrbaren Wahrheit sprechen, so \wollen wir damit einen klaren Strich unter die wissenschaftliche Fortschrittsgläubigkeit des vergangenen Jahrhunderts ziehen“, wie es in einer Schrift des Stifterverbandes heißt. Ferner droht Gefahr von dem spezialisierten Wissenschaftler. Er könnte wohl atü seinem, wenn auch begrenzten, Gebiet den ideologischen Schleier durchstoßen. Nicht spezielle Vertiefung, sondern eine Kombination von „Allgemeinbildung“ und Aneignung von speziellen bloßen ‚Kunstlehren‘ und technischen Fertigkeiten, die eng auf die „praktischen Gegebenheiten“ der Wirtschaft und Verwaltung bezogen sind, ist das Leitbild.
Aber nicht nur in der Vermittlung von ‚Herrschaftswissen‘ für Führungspositionen erfüllt sich die gesellschaftliche Funktion einer allgemeinen Bildung. Sie dient nicht nur direkt zur Rechtfertigung des sozialen Führungsanspruches der Akademikerschaft, sondern als Elemente eines Studium generale werden Philosophie, Geschichte, Kunst etc. zu Artikeln eines gehobenen Konsums. Die ‚Nutzlosigkeit‘ solcher geisteswissenschaftlichen Studien, verleiht ihnen den zur Dekoration des Sozialprestiges äußerst nützlichen Glanz, der seinen ‚Besitzer‘ von den Absolventen der unteren Stufen unserer Bildungshierarchie distanziert, die nicht in den ‚Genuß‘ einer höheren Allgemeinbildung kommen.
Gegen ein in dieser Weise sich auswirkendes Studium generale sind aber immerhin aus der Universität selbst starke Widerstände erwachsen. Die Studentenschaft hat wiederholt die oberfläche Aneignung allgemeinen Wissens aus zahlreichen Bildungsfächern abgelehnt und darauf beharrt, daß eine intensive und selbständige wissenschaftliche Arbeit am Speziellen ein wirksamerer Bildungsfaktor sei, als ein immer nur oberflächlich erarbeitetes Allgemeinwissen. (43) Sie hat sich ebenso wie z.B. die entscheidende Hochschulkonferenz von Hinterzarten (1952) für eine konsequente Verwissenschaftlichung der bestehenden Ansätze eines Studium generale eingesetzt, um dadurch seine Ideologisierung und Formalisierung bis hin zur obligatorischen Durchführung für alle Studenten zu Verhindern.
So wurde in den meisten Universitäten nur Studium generale - Veranstaltungen in der Form von streng wissenschaftlichen Fachvorlesungen und Kolloquien über allgemein interessierende Themen oder Grenzgebiete der Fächer eingeführt.
An diese Grundsatzentscheidung zur Wahrung des wissenschaftlichen Niveaus und der freien wissenschaftlichen Kritik innerhalb vom Studium generale-Programmen wird zu erinnern sein, wenn im Zusammenhang mit den Zielen der Umgestaltung der deutschen Universität zu einer ‚Erziehungs- und Heimuniversität‘ auch wieder die quasi außerwissenschaftliche Allgemeinbildung angestrebt wird.
I.3.8 Politische Bildung
Es entspricht der traditionellen Fremdheit, in der sich ‚Bildung‘ und Politik in Deutschland gegenüberstehen, wenn heute mehr und mehr isoliert nach politischer Bildung gerufen, den Studenten plötzlich „Mut zur Politik“ abverlangt wird. Dennoch pflanzt sich der Riß zwischen Bildung des Bewußtseins und Praxis der Politik auch hierin fort. Das ‚Politische‘ erscheint einerseits weiterhin als eine ‚Sparte‘ im Rahmen der allgemeinen Bildungsfächer, andererseits soll aber durch politische Bildungsarbeit politisches Engagement geweckt werden. Politische Bildung bleibt Bestandteil einer geisteswissenschaftlich orientierten und introvertierten Allgemeinbildung in der Kontinuität des Bildungshumanismus, die weniger an die gesellschaftliche Realität, als an abstrakte ethische Normen anknüpft: Demokratie ist ihrem tiefsten Wesen nach Sittlichkeit. Politische Erziehung, die sich weitgehend auf bloßes Bildungswissen beschränkt, die politische Prozesse, die gesellschaftlich bedingt sind, in anthropologische ummünzt, muß konsequent umschlagen in ein nur emotionales Beteiligtsein oder in einen im Grunde irrationalen Dezisionismus, „die Entscheidung zur Demokratie als Abstraktum ohne kritisch-rationales Verständnis des Anspruchs und der Wirklichkeit von Demokratie im historischen Prozeß.
Die verschiedenen Konzeptionen politischer ‚Bildungsarbeit‘, die in der Hochschule gegenwärtig vertreten werden, lassen sich nach ihrem Verhältnis zur Wissenschaft und nach ihrer politischen Ausrichtung oder Tendenz einordnen: Einer mehr außerwissenschaftlichen „staatspolitischen Bildungsarbeit“, die in Fortsetzung des Staatsbürgerkunde- oder Sozialkunde-Unterrichts der Schule Grundkenntnisse über Verfassung, Regierungssysteme, die Technik politischer Mechanismen vermitteln soll, steht die besonders vom VDS entwickelte und vorgeschlagene fachbezogene politische Bildung gegenüber, die an die politische Relevanz des Fachstudiums und der künftigen Berufsstellung des Studenten anknüpfen will. (44)
Die Variationen in der mehr oder weniger eindeutig ausgesprochenen politischen Zielvorstellung reichen von der Weckung eines allgemeinen politischen Verantwortungsgefühls und demokratischen Bewußtseins über eine stärkere Betonung der Verpflichtung und Treue des Akademikers gegenüber dem Staat bis zur sog. „gesamtdeutschen Bildung“ und der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus.
Unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen sind jedoch fast alle Formen und Leitbilder einer organisierten verbindlichen politischen Bildung an den Hochschulen im besonderen Maße in der Gefahr, zum Mittel der Ideologisierung eben dieser Herrschaftsstrukturen oder zum Instrument direkter weltanschaulicher Indoktrination zu werden:
1) Unter den gegenwärtigen Bedingungen des „objektiven“ Wissenschaftsbetriebs einer Soziologie und Politologie, die sich allzu oft begnügt mit der Systematisierung und Einordnung der „Fakten“ des politischen Lebens, ohne nach ihrem historischen Sinn und Rechtsgrund zu fragen, reduziert sich erst recht politische Bildung, als deren popularisiertes Derivat, praktisch auf die Vermittlung formal-technischer Daten und Spielregeln der Politik, im Sinn einer Lehre der politischen Institutionen oder einer formalen sozialen Beziehungslehre, die sich orientiert an Modellvorstellungen von Regierungssystemen und sozialen ‚Zusammenhängen‘ in der „pluralistischen Massengesellschaft“, ohne die antagonistische Grundstruktur der Gesellschaft noch kritisch bewußt zu machen, ohne die fundamentalen Vorgänge der Produktion und der Verhältnisse unter denen produziert wird, zu analysieren. Ein solches Vorgehen dient nur der möglichst reibungslosen Perpetuierung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung, die selbst nicht mehr in Frage gestellt wird.
2) Die Methode der außerwissenschaftlichen politischen Bildung neben dem Fachstudium bringt es mit sich, daß den Studenten „das Politische“ von außen, als wissenschaftsfremder toter Lernstoff oder als eine dunkle Sphäre des Irrationalen gegenübertritt, zumal da die meisten Studenten keinen realen Bezug zu einer gesellschaftlich-politischen Praxis haben können. Diese krampfhafte Politisierung, der damit verbundene künstliche moralische Appel an den Einzelnen, führt entweder zum rein emotionalen ‚Mitmachen‘ ohne rationale Begründung der politischen Urteils- und Willensbildung oder löst eine psychologische Abwehrreaktion gegen die ‚geistfeindliche‘ Politik aus.
3) Aber auch die bisher entwickelten Formen fachbezogener politischer Bildung bleiben trotz ihrem positiven Ansatzpunkt abstrakt und lassen das Zentrum der gesellschaftlich-politischen Widersprüche und Machtverhältnisse nicht ins Blickfeld gelangen:
„Es soll das Ziel der Erziehung sein, daß das Forschen und seine Ergebnisse, daß das Studium und seine Tätigkeit im Beruf selbst schon als politisch relevant erkannt werden. Auf diese Weise wird die Handlung im Beruf mit der politischen Handlung identisch. Die Trennung von ‚Existenz als Staatsbürger‘ und als ‚übriger Mensch‘ ist aufgehoben.“ (45)
Die Aufhebung dieser Trennung ist aber nicht nur ein Vorgang im Bewußtsein, sondern setzt eine materielle Änderung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse voraus. Von dieser Tatsache lenkt aber die „berufsbezogene“ politische Bildungsarbeit gerade ab. Die Erkenntnis, daß (eigentlich) alles Handeln im Beruf politisch sei, bleibt solange abstrakt, wie nicht das konkrete Ziel die Veränderung der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse ist, unter denen dieses Handeln geschieht. Diese Verhältnisse lassen aber die Aufhebung der Trennung von ‚citoyen‘ und ‚komme‘, von Staat und Gesellschaft, in einer politischen Gesellschaft nicht zu, „insofern privat, ohne wirksame öffentliche Kontrolle, über gesellschaftliche Macht einer politischen relevanten Größenordnung verfügt wird. Es werden unpolitische Bürger in an sich politischer Gesellschaft hervorgebracht. “ (46) Jene politischen Institutionen, die dem ‚Staatsbürger‘ als Mensch im Beruf' [FEHLER] die Selbst- und Mitbestimmung der Ziele und Bedingungen seiner Arbeit ermöglichen sollten, existieren nicht. Die private Verfügungsgewalt über die Mittel seiner Existenz läßt sich nicht wegdiskutieren durch die Predigt politischen Bewußtseins. Die Beschränkung auf den speziellen politischen ‚Mikrokosmos‘, etwa die soziale Verantwortung des Arztes oder des Lehrers und die Struktur und Funktion der Krankenhäuser bzw. der Schulen in der Gesellschaft ist nur eine Variante der ‚System-immanenten‘ Entpolitisierung oder der „Municipalisierung“ (Carlo Schmid) politischer Aktivität, die den Kern der gesellschaftlich-politischen Machtverhältnisse nicht antastet.
4) Die gegenwärtige autoritäre Wirklichkeit der deutschen Universität, die in totalem Widerspruch steht zu der Idee der akademischen Freiheit, auf die sie sich beruft, stellt zugleich - als die einzige den Studenten real zugängliche gesellschaftliche Praxis - einen handfesten Widerspruch zu dem gepredigten politischen Engagement für die Demokratie dar. Die autoritären Verzerrungen, im Lehr- und Unterrichtsbetrieb - die zur Demagogie verleitenden politischen Massenvorlesungen, der bestürzende Mangel an offener freier Diskussion und Kritik in den Seminaren, die Vormachtstellung des Lehrstuhlinhabers und Institutschefs gegenüber den ‚subalternen‘ Wissenschaftlern - lassen eine kritische Urteilsbildung der Studenten auf Grund freier Konkurrenz verschiedener wissenschaftlich-politischer Richtungen nicht zu, sondern eröffnen bei Einführung von mehr verbindlichen Formen politischer Bildung (z.B. durch Pflichtvorlesungen, Vorschriften in Prüfungsordnungen, oder durch Bildungsprogramme in Wohnheimen) die Gefahr einer einseitigen politisch-weltanschaulichen Beeinflussung der Studenten durch die jeweils verantwortlichen Lehrstuhlinhaber und die von ihnen abhängigen Mitarbeiter. Der Pluralismus in den Zielen solcher politischen Indoktrination je Fakultät oder Universität wäre angesichts der erschwerten studentischen Freizügigkeit und der Autoritätsfrömmigkeit der meisten Studenten nur ein schwacher Trost.
5) Das geringe genuin-demokratische Potential im politischen Bewußtsein der Studenten und ihre relativ starke Anfälligkeit für autoritäre Haltungen oder Gesellschaftsbilder, ein Verhältnis, das nachweislich durch die einseitige soziale Zusammensetzung der Studentenschaft besonders verstärkt wird, schaffen einen günstigen Resonanzboden für die autoritative Vermittlung ideologischer politischer Theorien und Gesellschaftsmodelle, sowie ein politisches Klima in der Universität, das darüberhinaus auch andersartige Ansätze einer kritisch-rationalen politischen Bildung verzerren oder ersticken kann. Organisierte politische Bildung großen Stils, in der die ideologischen Elemente überwiegen müßten, würde gegenwärtig auf eine unkritisch eingestellte Studentenschaft ohne lebendige Erfahrungen in der politisch-gesellschaftlichen Praxis treffen.
6) Die unzureichend gesicherte bzw. verwirklichte Hochschulautonomie und die mangelnde materielle Förderung der Hochschulen macht die stark improvisierte politische zum Spielfeld hochschulfremder gesellschaftlicher Kräfte und staatlicher Instanzen, die durch Beteiligung an der Finanzierung und Beeinflussung der Veranstaltungen Einfluß nehmen. Die Regierungen üben durch die Vergabe von Bundes- bzw. Landesmitteln für staatsbürgerliche Erziehung und studentische Gemeinschaften einen unmittelbaren Einfluß aus, den das Bundesinnenministerium ganz offen zur Ausschaltung oder Benachteiligung unwillkommener oppositioneller Studentengruppen benutzt.
Neben den protegierten „staatstreuen“ studentischen Verbänden - den Korporationen, Vertriebenengruppen, den vom Verteidigungsministerium initiierten „Hochschulgruppen für Wehrkunde“ treten auch direkt hochschulfremde, von der Bundesregierung finanzierte und beeinflußte CDU-Tarnorganisationen und -institute bei der ‚staatspolitischen Bildung‘ der Studenten in Erscheinung, wie die „Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise“. Im Rahmen eines militanten Antikommunismus und einer weitgehend nur noch emotionalen Wiedervereinigungspropaganda, die besonders von den Burschenschaften getragen wird, nimmt auch das „Kuratorium Unteilbares Deutschland“ starken Einfluß auf die „staatspolitische Betätigung an den Universitäten und Hochschulen“, um, wie es heißt, „die Studenten aus der geistigen Isolierung bei der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus herauszuführen. “ (47)
Solche „staatspolitische Bildungsarbeit“ in der Art eines Wiedervereinigungs- und Vertriebenen-Managertunis entfernt sich immer mehr vom wissenschaftlichen Niveau und appelliert an ein politisches Bewußtsein, das unter dem Vorwand der Lösung „nationaler Aufgaben“ autoritären Systemen zuneigt.
I.3.9 Bildungsanspruch ohne Resonanz
Da in einer Gesellschaft, die sich nicht auf dem WegefortschreitenderDemokratisierung, sondern auf dem der autoritären Zuspitzung restaurativer Machtverhältnisse befindet, keine geistige Erneuerung der Universität erfolgen konnte, mußten sich die dennoch beanspruchten Leitbilder einer außerwissenschaftlichen Erziehung und Bildung als fragwürdig erweisen.
Fragwürdig erscheint aber auch, ob selbst diese zumeist traditionellen, nun ideologisch gewordenen Leitbilder künftig noch eine Entsprechung im Bewußtsein der großen Mehrheit der Studentenschaft finden werden. Denn in dem Maße, in dem sich der Prozeß der „Entzauberung“ der einstigen „Hohen Schule“ und ihres universalen Bildungsanspruchs zum Betrieb der „Wissenschaft als Beruf“ unter anderen Berufarbeitsstätten zuspitzt, ohne daß ein neues grundsätzliches Selbstverständnis der Wissenschaft jenseits ihrer oberflächlich-positivistischen Existenz erreicht wird, muß auch unter den Studenten
ein „realistisches Bewußtsein“ oder „Unbewußtsein“ die Oberhand gewinnen, wie es sich in den Untersuchungsergebnissen der Studie „Student und Politik“ am Beispiel des politischen Bewußtseins deutlich genug abzeichnet: Ein solches Bewußtsein, das Gesellschaft nicht unter einer zentralen Perspektive, sondern als Anhäufung unzusammenhängender ‚Tatsachen‘ ‚begreift‘, weist darauf hin, daß es zur Identifikation mit dem Bestehenden, dem ‚Gegebenen‘, keiner Ideologie mehr bedarf. Die Gesellschaft wird zwar keineswegs explizit als gut bezeichnet, aber indem sie sich auflöst in Details, über die ebenso richtig wie neutral Bericht erstattet wird, ist ihr Bestand hinterrücks schon garantiert. Dieselbe Auflösungstendenz läßt sich aber in Bezug auf das Studentische Bewußtsein von der Wissenschaft und der Universität aufweisen: Studieren und Forschen verlieren ihren besonderen Sinngehalt und Anspruch, erscheinen nur noch als Berufstätigkeit oder Berufsausbildung wie jede andere, die im Rahmen einer lediglich verwaltungsmäßigen Einheit von Fachausbildungsinstituten erfolgt. Die Frage nach der sozialen Aufgabenstellung und Verantwortung der Universität oder des Akademikers wird nicht mehr gestellt. Aus den gleichen Ergebnissen der Befragung Frankfurter Studenten ergibt sich, „daß die Befragten das, was als Allgemeinbildung an der Universität betrieben wird, kaum noch ernst nehmen. “ (48) Zwei Drittel sind der Ansicht, man könne die Universität ebensogut in eine Reihe von Fachschulen auflösen, weil die Fakultäten keinen nennenswerten Kontakt mehr hätten, obwohl die meisten dann doch an der Fiktion der „universitas literarum“ festhalten möchten. Ebenso viele meinen, inner halb des heutigen Studienbetriebs könne man sich praktisch nicht mehr um Allgemeinbildung kümmern.
„Wer nicht Muße hat, ohne auf sein Fortkommen zu schauen, zu lernen und zu denken, dem muß das Wort Autonomie oft wie Hohn klingen. Statt dessen sucht er dann auf der einen Seite die Kenntnisse und Fertigkeiten, die ihn beruflich ausweisen, und auf der anderen Seite die weltanschaulichen Parolen, die ihm die Last abnehmen, sich geistig mit Dingen herumzuschlagen, von denen er im allgemeinen überzeugt ist, daß sie zu ändern nicht in seiner Macht liegt.“ (Max Horkheimer) (49)
Die Jagd nach den Scheinen und Berechtigungsnachweisen, als Ausweise einer höheren ‚Funktionstüchtigkeit‘ im beruflichen Konkurrenzkampf scheint alles andere zu verdrängen.
„Ungehemmt führen zahlreiche Studenten den Entschluß zum Studium auf utilitarische Erwägungen zurück: die Realität des Berufslebens ist weitgehend eintönig und trist; ursprüngliche Neigungen sind doch nicht zu verwirklichen; darum wird von vornherein das Studium gewählt, das sich am besten bezahlt macht.“ (50)
Sicherlich liegt nicht immer ein objektiver Zwang zu solcher Haltung vor, doch das geistige Gesamtklima der Universität in dieser Gesellschaft macht sie eigentlich völlig selbstverständlich.
Aber selbst wenn die geistig-psychologischen Voraussetzungen vorhanden wären - und bei einer entscheidenden Minderheit von Professoren und Studenten wohl auch sind - so müßte eine weitgespannte erneuerte Bildungs- und Erziehungsbewegung in der Hoch schule an den harten kapitalistischen Tatsachen scheitern, die zur akuten Notlage der Universität inmitten der „Überfluß-Gesellschaft“ geführt haben. Eine intensive Erziehung und Bildung aller Studenten setzt erstens einen möglichst engen persönlichen Kontakt zwischen Dozenten und Studenten und damit eine gewaltige Vergrößerung des gegenwärtigen Lehrkörpers voraus, der nicht einmal zur effektiven Durchführung der fachwissenschaftlichen Ausbildung ausreicht, und erfordert zweitens Zeit für die Studenten, d.h. Verlängerung des Studiums, Ausschaltung der Werkarbeit in den Semesterferien, damit sie sich auf Bildungsbemühungen überhaupt konzentrieren können. Beides erscheint aber wegen der Versäumnisse bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den letzten zehn Jahren und angesichts der Lückenhaftigkeit der Studentenförderung und bei der unzureichenden allgemeinen materiellen Ausstattung und Größe der Hoch schulen völlig ausgeschlossen.
I.3.10 Bildung „jenseits der Universität“?
Trifft der traditionelle Bildungsanspruch der Universität heute auf eine ihm entfremdete Bewußtseinshaltung der Studenten, so ziehen einige seiner konservativen Verteidiger aus diesem empirischen Befund eine Konsequenz, die nun nicht mehr verwundern kann. Ihr nüchternes Eingeständnis, daß „die Wissenschaft zur Substanz des praktischen Handelns selbst geworden und daher an sich keineswegs mehr Träger einer sich über das praktische Leben erhebenden Bildungsidee“ sei (51), zwingt sie, sich gegen alle Ersatzlösungen außerwissenschaftlicher Erziehung in der heutigen Hochschule auszusprechen, die völlig zum Ort dieser ‚bildungslosen‘ Wissenschaft herabgesunken sei, schlägt aber um in romantisch-illusionäre Ersatzlösungen auf höherer Ebene: etwa in dem Vorschlag von Gerhard Ritter (Die Krisis des deutschen Universitätswesens. Tübingen 1960) (52) zur Teilung der heutigen Universität in eine breite Stufe für die Ausbildung der Akademiker der praktischen Berufe und eine obere Stufe für die geistige Elite des wissenschaftlichen Nachwuchses; oder in Plänen zur Aufteilung der Hochschulen in Colleges zur Berufsvorbildung und „Graduate Schools“ für das eigentliche wissenschaftliche Studium (53); und schließlich in Schelskys Utopie der Gründung von neuen Bildungsakademien:
„ … jenseits der Universität liegt heute der immer noch mögliche Raum der Bildung in Freiheit und Einsamkeit.. Die Idee der Bildung der bedarf einer insti tutionellen Neuerfindung, einer Bildungsanstalt jenseits der akademischen Berufs ausbildung und damit jenseits unserer heutigen Universität, und zwar unter Absti nenz von allen praktischen Zwecksetzungen, also unter eben jener Idee, aus der die Neugründung der Universität Berlin stammt.“ (54)
Solche rückwärts gewandten Utopien eines ‚Kastalien‘ „fern allen praktischen Zwecksetzungen“ oder einer Akademie der ‚geistigen Elite‘ illustrieren nur in extremer Zuspitzung - der ein Humboldt oder Fichte gewiß widersprechen würde - den fiktiven Charakter eines weltfremd gewordenen Bildungsbegriffs, der Bildung als „sozial zweckloses Nebenbei“ in einem Raum spielerischer Muße für eine „funktional luxuriöse Gruppe“ von Privilegierten versteht. (55)
I.3.11 Grenzen der erzieherischen Wirkung des Studiums selbst
Uns drängt sich dagegen aus der Analyse der verschiedenen außerwissenschaftlichen Erziehungsexperimente hinsichtlich des Verhältnisses von Studium und Erziehung eine andere Konsequenz auf:
Die gegenwärtige Hochschule kann und darf die bewußte allgemeinmenschliche Erziehung, die außerwissenschaftliche Bildung der Persönlichkeit nicht zu ihren Aufgaben rechnen.
Die moderne Universität ist eine wissenschaftliche Arbeits- und Ausbildungsstätte, keine spezifische Erziehungs- und Bildungsanstalt.
Zusammenfassend sind dafür die folgenden Argumente zu nennen:
- Die Universität in der gegenwärtigen Gesellschaft ist weder geistig noch materiell fähig, ihren Studenten eine umfassende menschliche Bildung zu vermitteln, die unter einem zentralen, als verbindlich anerkannten Lebens- und Bildungsprinzip steht.
- In das bestehende geistige Vakuum würden bei Einführung eines verbindlichen Erziehungsprogramms universitätsfremde und wissenschaftsfeindliche Ideologien einströmen, die schließlich selbst den wissenschaftlichen Charakter des eigentlichen Studiums, seine kritische Rationalität, gefährden müßten.
Die Universität kann lediglich eine Seite der menschlichen Persönlichkeit formen und zur Entfaltung bringen: den kritischen Intellekt. Die umfassende menschliche Prägung der Gesamtpersönlichkeit des Studenten durch eine charakterlich hervorragende Forscherpersönlichkeit oder durch echte geistige Freundschaften mit Kommilitonen ist im heutigen Universitätsbetrieb zu einer solchen Ausnahme geworden, daß es lächerlich anmutet, sie in einem Erziehungsprogramm ‚organisieren‘ zu wollen.
Die Universität wird die vielfältigen, sich z.T. widersprechenden Bemühungen um eine allseitige Entfaltung und Integration der menschlichen Gesamtpersönlichkeit anhand von Aufgaben und Zielen, die ein menschliches Leben mit konkreten Sinn erfüllen können, begrüssen und fördern, aber ohne sie als ihre institutionelle Aufgabe, als Teil ihres eigenen verbindlichen Programms anzusehen, ohne dem Einzelnen die Weise seiner Lebensgestaltung aufzudrängen.
Andererseits wird sich die Universität vor der negativen Wirkung solcher Erziehungsziele und -formen schützen müssen, die sich gegen die kritisch-rationale Substanz der Wissenschaft selbst richten und die geistige Selbständigkeit und Aufgeschlossenheit des Studenten für die wissenschaftliche Erkenntnis bedrohen. Als Beispiel dafür seinen genannt: die bereits geschilderten Ziele einer akademischen Standeserziehung, die Erziehungsmittel des ‚Waffenstudententums‘ und eine ideologisch verzerrte Allgemeinbildung oder politische Bildung.
Damit ist auch die Haltung der Universität zu den studentischen Gemeinschaften als den wichtigsten und aktivsten Trägern einer vielfältigen studentischen Selbsterziehung positiv wie negativ eindeutig bestimmt.
Aber den verbindlichen Erziehungsanspruch der Hochschulen zurückweisen heißt nicht, die indirekten erzieherischen Wirkungen des Studiums leugnen: Denn wie alle gesellschaftlichen Arbeits- und Lebensprozesse zugleich indirekte Erziehungs- und Bildungsprozesse darstellen, so konstituiert auch das Zusammenwirken von Dozenten und Studenten in der Hochschule einen konkreten Erziehungszusammenhang, in dem jeder Einzelne jeweils sowohl Subjekt als auch Objekt bestimmter bildender und erziehenden Wirkungen im weitesten Sinne ist. Es handelt sich nicht um Bildung und Erziehung im engeren Sinne wie in der Schule, sondern um einen Vorgang der natürlichen unbewußten gegenseitigen Beeinflussung und Formung von jüngeren und älteren erwachsenen Menschen durch ihre Zusammenarbeit und persönliche Begegnung, so wie auch die Arbeit im Betrieb oder politische Aktivität zugleich indirekt erzieherischen Charakter hat.
Die Vorstellung von einem einseitigen und gerichteten Erziehungs- und Bildungsauftrag des Lehrkörpers gegenüber der Studentenschaft entspricht nicht dem Grundprinzip und der heutigen Realität der modernen deutschen Universität.
Wenn behauptet wird, die Universität könne nur indirekt, absichtslos, durch die Ziele und Formen der wissenschaftlichen Arbeit begrenzte erzieherische und bildende Wirkungen hervorbringen, so ist diese Position, auf der die Universität in der gegenwärtigen Gesellschaft beharren muß, soll nicht ihr kritisch-rationaler Kern fortgeschwemmt werden, mit dem klassischen Bildungsideal der Universität Humboldts nur scheinbar identisch, da der Begriff und die gesellschaftliche Funktion der Wissenschaft sich seither tiefgreifend gewandelt haben: Es hat sich als Illusion erwiesen, daß die freie wissenschaftliche Erkenntnis aus sich selbst zur erfüllten Individualität des Menschen führen soll. Das wissenschaftlichen Denken allein konnte die Gesamtpersönlichkeit des Menschen nicht bilden und sein Leben mit einem zentralen Sinn erfüllen. Denn die Wissenschaft ist vom Medium der Philosophie, der spekulativen Schau des Universums, zur „Substanz des praktischen Handelns selbst“ geworden; die ‚Hohe Schule des Geistes‘ hat sich in den ‚Hochschul-Betrieb‘ verwandelt, das Band zwischen eines spekulativ-philosophischen Bildung, die in kontemplativer Haltung in einem Raum der Einsamkeit und Freiheit verharrt, und ihrem Medium Wissenschaft ist zerrissen, seitdem diese Wissenschaft sich als Ausschnitt aus dem arbeitsteiligen gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozeß entfaltet.
Gerade der philosophisch-spekulative Charakter des klassischen Bildungsbegriffs hat aber dazu beigetragen, daß dieser Funktionswandel der Wissenschaft in der Gesellschaft in der Form bewußtlosen Anpassung der Wissenschaft an die je herrschenden äußerlichen gesellschaftlichen Bedürfnisse erfolgt ist. (56) Daher ist das Ansinnen zurückzuweisen, den Studenten neben seiner Arbeit in der wissenschaftlichen Ausbildung mit einem antiquierten, nun außer-wissenschaftlich gewordenen totalen Bildungsanspruch zu konfrontieren, der noch dazu in der Realität des heutigen Studienbetriebs zur oberflächlich-allgemeinbildenden Wissensvermittlung oder zu einem krampfhaft organisierten Gemeinschaftsleben verflacht ist.
Die Frage nach den Zielen einer Bildung neben dem Fachstudium muß ersetzt werden durch die Frage nach dem Sinn und Ziel des Studiums überhaupt. An die Stelle von Überlegungen über eine besondere Erziehungsaufgabe der Universität muß die Reflexion über die Struktur des konkreten sozialen Erziehungszusammenhangs treten, in dem die wissenschaftliche Arbeit und das Studium sich vollziehen.
I.4 Ziele und Schwerpunkte des Studiums
Einige Grundforderungen für die Gestaltung und Zielsetzung des Studiums können in der näheren Betrachtung der immanenten Tendenz eines frei sich entfaltenden Studienprozesses entwickelt werden: Im Ablauf des Studiums kehren in abgewandelter Weise jene Elemente wieder, die kennzeichnend sind für den Charakter des gesamten wissenschaftlichen Erkenntnis- und Arbeitsprozesses in Forschung und Lehre, von dem das Studium nur ein Ausschnitt ist. In Abwandlung der drei Elemente des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses überhaupt - im Fortschreiten von der Spontaneität des Einzelnen durch den produktiv-kritischen Widerspruch zur Kooperation, die sich in die Praxis fortsetzen muß - läßt sich die Grundstruktur des Studiums kennzeichnen als Bewegung durch die fachliche und thematische Spezialisierung zur Vertiefung in kritischer Reflexion inmitten der Hinwendung zur Praxis im weitesten Sinne, von der freien, individuellen Wahl und Erarbeitung des Studienziels und speziellen Themas durch die konfrotation der individuellen Sicht mit der Kritik des Lehrers und der Kommilitonen zur gemeinsamen Arbeit in der Praxis der Wissenschaft, die sich zur Praxis des Berufs und der Gesellschaft erweitert.
I.4.1 Spezialisierung des Studiums
Das im Vordergrund stehende Studienziel ist für alle Studenten das intensive Studium einer wissenschaftlichen Disziplin als Vorbereitung auf einen bestimmten Beruf (oder eine Gruppe verwandter Berufe).
Die Spezialisierung im Studium muß aber in drei verschiedenen Perspektiven gesehen werden: aus der Sicht des Studenten, der Wissenschaft und der beruflichen Praxis in der Gesellschaft:
1) In der freien Wahl des Studienfachs und des speziellen Arbeitsthemas innerhalb dieses Faches prägt sich nicht nur die individuelle Begabung und das subjektive Interesse des einzelnen Studenten aus, sondern darin soll die fruchtbare ‚Neugier‘ des Drangs zum Erkennen und Forschen den Studenten zur Entwicklung eigener, höchst individueller Perspektiven der wissenschaftlichen Arbeit, zu einer besonderen, originären Fragestellung führen (ohne daß unbedingt ein direktes neues Forschungsergebnis gewonnen werden müßte
Weil an diesem Punkte des Studiums die Spontaneität des Einzelnen zum Ausdruck kommen soll, ist hier in einem bestimmten Rhythmus durchaus der Rückzug in die Isolation der wissenschaftlichen Arbeit in eigener Verantwortung und Zielstellung erforderlich, ehe der Student wieder zum Gedankenaustausch und zur Zusammenarbeit mit seinen Kommilitonen und Lehrern Verbindung aufnimmt.
Die Mitarbeit des Studenten im Seminar sollte daher möglichst auf der Basis der Lösung einer eigenständigen Arbeitsaufgabe erfolgen. (Vgl. Kapitel II, Wissenschaftliche Arbeitsformen)
2) Die Aufrechterhaltung des wissenschaftlichen Charakters des Studiums bedeutet angesichts des gegenwärtigen Entwicklungsstandes der Wissenschaft vor allem immer stärkere fachliche und thematische Spezialisierung. Um mit der steigenden unaufhaltsamen Differenzierung der Wissenschaften und ihrer Umsetzung in die Praxis aller Lebensbereiche Schritt zu halten, wird die Spezialisierung des Fachstudiums künftig sogar noch gründlicher und radikaler sein müssen.
Es ist verfehlt, die geistige „Allgemeinbildung“ gegen sie angeblich ‚ungeistige‘ Spezialisierung auszuspielen. Ein solches Urteil wird abgegeben auf Grund eines heute nicht mehr möglichen Begriffs der Einheit der Wissenschaften im Sonne der idealistischen Philosophie. Eine Spezialisierung, die im Gesamtzusammenhang eines frei sich entfaltenden Studiums steht, bildet heute erst die Voraussetzung für die (begrenzte) Bildungsfunktion des Studiums und für den Einblick in Ergebnisse und Methoden anderer Fächer:
Bildung ist nicht abhängig von dem ‚allgemeinen‘ Charakter des Wissensstoffes, sondern von der Art und Weise, in der in der Hochschule fachwissenschaftlich gearbeitet wird. Im Interesse einer weiteren Verwissenschaftlichung der Ausbildung der Studenten ist eine solche Form der Spezialisierung erforderlich, die zugleich ein Intensivierung des Studiums darstellt, die von der Aneignung speziellen Wissens zur Erkenntnis und praktischen Erprobung der, jeweiligen Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens vorstößt. Denn der Sinn des Studiums ist nicht systematische Vermittlung allgemeinen oder fachlichen Wissens, sondern das Erlernen der wissenschaftlichen Mittel, durch die Wissen erworben, weiterentwickelt und angewendet werden kann. Eine derartige intensive wissenschaftliche Arbeit am Speziellen ist daher ein wirkungsvollerer Bildungsfaktor als ein naturgemäß oberflächlich bleibendes Allgemeinwissen ohne Bezug zur Praxis der wissenschaftlichen Arbeit. Auch das Bedürfnis nach Einsicht in weitere wissenschaftliche Zusammenhänge, die die Grenzen der Fächer sprengen, erwächst erst aus der intensiven Arbeit am Speziellen. Erst wenn der Student an Hand eines Faches oder mehrerer verwandter Fachgebiete die Methodik wissenschaftlichen Arbeitens erlernt und erprobt hat, ist eine Einführung in die Arbeitsweise und grundlegenden Ergebnisse benachbarter Disziplinen sinnvoll.
3) Es entspricht der objektiv notwendigen gesellschaftlichen Funktion der Universität, wenn die Wahl des Studienfaches sich vornehmlich an der speziellen Berufsvorbildung orientiert. Wissenschaftliche und berufliche Spezialisierung gehen nicht unbedingt konform, aber stehen in einem ständigen Bezug, ob es die Universität zugeben will oder nicht. Also sollte sie diesen Bezug wollen, aber zugleich von sich aus zu bestimmen suchen, und zwar aufgrund wissenschaftlicher Analysen der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Berufspraxis, um die Lenkung der fachlich-beruflichen Spezialisierung nicht wissenschaftsfremden sozialen Interessengruppen zu überlassen, Einflüssen, die auf eine blinde Anpassung des Studiums an die äußere gesellschaftliche Bedarfssituation hinauslaufen, aber keineswegs die objektiven gesellschaftlichen Erfordernisse widerspiegeln. Die Universität wird daher bei der Gestaltung ihrer verschiedenen Ausbildungswege, bei der Einteilung der Studienfächer, dem Druck wirtschaftlicher und berufsständischer Interessengruppen widerstehen müssen, die die durchaus notwendige Spezialisierung in eine einseitig an der Berufspraxis orientierte Richtung drängen wollen:
So fordert z.B. ‚die Wirtschaftspraxis‘ von den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Falkultäten neben der Lehre nach Wirtschaftszweigen im großen Stil Lehrstühle für spezielle Wirtschaftsfunktionen zu schaffen, die eng auf die Bedürfnisse der Ausbildung und Technik der Unternehmensführung ausgerichtet sein sollen (z.B. verschiedene Lehrstühle für Personalwesen, Rechnungswesen, Unternehmensleitung etc.) Ebenso wird die Einführung eines genau durchdachten Studienplanes gefordert, der wiederum sich bewußt gegen die wissenschaftliche Spezialisierung richtet. (57)
I.4.2 Exemplarische Studien
Eine sinnvolle Spezialisierung im Verlauf des Studiums hat zwei Seiten:
- Die Einführung und selbständige Einarbeitung in die grundlegenden Erkenntnisse, Fragestellungen und Methoden eines ganzen Faches.
- Die gründliche beispielhafte Arbeit an einem ganz bestimmten Objekt, das sich der Einzelne möglichst nach seinem individuellen Interesse wählen soll, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse und Methoden des ganzen Fachs.
Im Fachstudium müssen daher systematisch Grunderkenntnisse und grundlegende Methoden erlernt werden und zugleich sollen exemplarisch die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden des Faches auf das Studium bestimmter begrenzter Gegenstände angewandt werden. Diese Konzentration auf einzelne beispielhafte Studienobjekte angewendet werden. Diese Konzentration auf einzelne beispielhafte Studienobjekte dient sowohl der Erlernung und Einübung der wissenschaftlichen Arbeitsweise des Faches als auch dem Nachvollzug des Erkenntnisprozesses, der zu bestimmten Forschungsergebnissen geführt hat, bis zur Gewinnung von neuen Erkenntnissen, mag der Beitrag des einzelnen Studenten dazu noch so gering sein.
Die Ausbildung in vielen Fachwissenschaften droht aber in der Überfülle des zu lernenden Stoffes die Problematik und die methodischen Voraussetzungen der Erforschung des bestimmten Objekts aus dem Blickfeld zu verlieren. Das Fach erscheint den meisten Studenten als eine nur statisch aufgefaßte Summe von Stoff, als Addition von wissenswerten Dingen, die es sich anzueignen gilt, ohne dabei die Frage nach dem Sinn zu stellen; Wissenschaft wird nicht mehr als ein arbeitsteiliger, vergesellschafteter Arbeitsprozeß von Menschen erkannt und in seiner historisch-gesellschaftlichen Bedingtheit gesehen. Der Student droht zu einem bloßen Benutzer einer Ansammlung von Karteikästen,Bücherregalen, Archiven zu werden, der mit dem ‚tabellarischen Verstand‘ eines Registrators gestellte Aufgabe „löst“, ohne die theoretisch-methodischen Voraussetzungen und den Sinn dieses Wissenschaftsbetriebs zu verstehen, in dem er nur kleines Rädchen ist.
Gegen diese Tendenz die sowohl immanent aus dem positivistischen Wissenschaftsbegriff erwächst, als auch von Interessengruppen aus der Berufspraxis von außen vorangetrieben wird (die das Fachstudium mehr auf die Vermittlung ausgedehnter fertiger Ergebnisse der Wissenschaft ausrichten wollen, die zur Anwendung in der Praxis bereits ‚auf bereitet‘ sind) - müssen zwei Grundforderungen erhoben werden.
– Die Reinigung des Fachstudiums von allem gedankenlos auswendig gelernten Wissen, von der Fülle von Stoff, der zum Verständnis der zentralen wissenschaftlichen Problematik und Methodik des Faches nicht erforderlich ist;
– die Konzentration des Studiums auf die selbständige exemplarische Erfassung eines bestimmten Objekts an Stelle der Aufnahme eines statisch gedachten Stoff-Systems.
Eine Neuorientierung des Studiums von der systematisch-extensiven Wissensvermittlung (z.B. in langen Pflichtvorlesungen und in Seminaren, die mehr der Stoff-Rezitation als der produktiven Diskussion dienen) zum intensiven exemplarischen Studieren läßt sich durch die Einführung von einzelnen, zeitlich auf ein bis zwei Semester begrenzten Studienprogrammen erreichen, in deren Verlauf innerhalb eines Faches- oder auch in Kooperation von mehreren benachbarten Disziplinen - Vorlesungen, Kolloquien, Seminare, Arbeitskreise und Forschungsgruppen eingerichtet werden, die einen bestimmten Problemkreis anhand eines (nicht zu eng begrenzten) Beispiels in seinen verschiedenen Aspekten behandeln.
Ein solches, als studium exemplare bezeichnetes zweisemestriges Studienprogramm (verbunden mit Exkursionen) ist z.B. im Friedrich-Meinecke-Institut, dem Historischen Seminar der Freien Universität Berlin, bereits mehrmals durchgeführt worden Vgl. ANHANG Nr. 1
Die gemeinsame Diskussion, Vorbereitung, Organisation und Auswertung eines solchen Studienprogramms durch Dozenten und Studenten bringt wieder stärker das dynamischprozeßhafte Element in der Wissenschaft, die kooperative Bewältigung einer bestimmten Fragestellung, z.T. sogar eines ungelösten wissenschaftlichen Problems zum Bewußtsein.
Ein solches Vorgehen bietet darüberhinaus einen konkreten Ansatzpunkt zu der notwendigen kritischen Analyse und Vertiefung des Fachstudiums.
I.4.3 Vertiefung des Studiums
In der Universität wird nicht nur Fachwissen, als Summe fertiger Ergebnisse, vermittelt, sondern es soll die jeweilige Methode der wissenschaftlichen Arbeit, die Weise, wissen schaftliche Ergebnisse in einem Fach zu gewinnen, gelehrt und von den Studenten praktiziert werden. Dazu ist es erforderlich, den konkreten Entstehungsprozeß dieser Ergebnisse in wissenschaftlich-methodischer Weise nachzuvollziehen, d.h. aber seine methodisch-theoretischen Voraussetzungen zu reflektieren.
Der Charakter und die Richtung solcher Reflexion im Fachstudium hängt ab von dem Begriff der Wissenschaft, der in der Universität und ihren Fachrichtungen herrscht. Der modernen Wissenschaft erscheint aber die Welt, das ‚Ensemble ihrer Erkenntnisgegenstände‘ nicht mehr als ein ganzheitlicher Kosmos, selbst nicht mehr in dem philosophischen Ansatz des spekulativen Idealismus der deutschen Universitätsgründer, sondern als ein Prozeß voller Widersprüche.
Die seit Begründung der Humboldtschen Universität zugespitzte „Arbeitsteilung der Wissenschaft, die ein Ausdruck der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung ist, läßt sich durch keine Synthese beseitigen. Es gibt nicht eine Art Dachorganisation der Wissenschaft, die das durch den Rationalisierungsprozeß Getrennte durch einen weiteren Schritt der Rationalisierung künstlich wieder zusammenbringt. “ (58)
Der Weg der Reflexion des Fachwissens kann heute nicht dahin führen, in einer kontemplativen Haltung spekulativ das Bild der Universität zu beschwören, sondern sie muß als Prozeß von Kritik und Selbstkritik inmitten der wissenschaftlichen Kooperation am speziellen Objekt das jeweilige Ergebnis messen am Gesamtprozeß der Fachwissenschaft und ihres Bezugs zur Gesellschaft.
Nicht spekulative Erweiterung des Fachstudiums zur fiktiv gewordenen Ganzheit des Weltbildes, sondern seine Vertiefung durch kritische Selbstreflexion am speziellen konkreten Gegenstand ist heute das wissenschaftlich und gesellschaftlich notwendige Ziel. Zugleich beginnt sich immer mehr die Einsicht durchzusetzen, daß auch „die Chance der ‚Allgemeinbildung‘ nicht darin liegen kann, einer ohnehin verlorenen universitas litterarum nachzuhängen, sondern vielmehr die Spezialisierung der Wissenschaft gleichsam zu radikalisieren, und zwar durch deren Selbstreflexion auf ihre methodischen Voraussetzungen. “ (59)
1) Solche Vertiefung des Studiums in der Spezialisierung geschieht schrittweise in mehreren Stufen:
I.4.4 Übung der kritisch-rationalen Diskussion
Kritische Reflexion als Kern wissenschaftlichen Arbeitens hat im Rahmen des Studienprozesses zwei Seiten: eine formale und eine inhaltlich bestimmte. Der formale Rahmen für die inhaltliche Erfüllung der Reflexion muß durch die geistige Emanzipation des jungen Studenten zur geistigen Selbständigkeit, durch seine Lösung aus den festen Autoritätsbindungen, die ihn in Schule und Elternhaus umgaben, (bzw. die ihn in einer dem Studium vorangehenden Berufspraxis oder Werkarbeit festhielten) erst geschaffen werden. In diesem Prozeß der Formung der Persönlichkeit des Studenten zur Freiheit für die Wissenschaft ist der wichtigste Vorgang die Entwicklung seiner Fähigkeit zur rationalen Kritik und Selbstkritik durch das Beispiel kritisch-wissenschaftlicher Auseinandersetzung der Professoren (z.B. in Vorlesungen, Kolloquien, die sich nicht auf Wissenvermittlung beschränken, sondern kritische Interpretation leisten) und durch die Übung in der rationalen Diskussion mit anderen Studenten und Dozenten. Darin besteht das wichtigste Element des konkreten ‚Erziehungszusammenhangs‘ der Universität.
Unter den gegenwärtigen Studienverhältnissen bestehen dafür allerdings kaum günstige Voraussetzungen: Es kann nicht zweifelhaft sein, welche Verhaltenswesen und Gesinnungen den Studenten unbewußt anerzogen werden durch Massenvorlesungen, in denen ihnen autoritative, ‚unnahbare‘ Fachvertreter fertige Ergebnisse als letzte Weisheit zu verkünden scheinen, durch üb erfüllte Seminare, in denen es nur Monologe des Professors und des ‚Referenten vom Dienst‘ gibt, oder welche menschliche Haltung dem wissenschaftlichen Nachwuchs eingeimpft wird durch seine z.T. erniedrigende Abhängigkeit von solchen Lehrstuhlinhabern, die ihre autoritäre Vormachtstellung nicht durch menschliche Qualitäten, durch geistige Toleranz und natürliche Autorität zu überspielen oder zu neutralisieren verstehen.
Es müssen in der Universität neue Methoden und Formen der Lehre, des Unterrichts und des Studiums entwickelt werden (bzw. bewährte Formen müssen wieder ‚freigelegt‘ werden), die eine möglichst freie methodisch konsequente Entfaltung der rationalen Diskussion und des wissenschaftlich,-kritischen ‚Streitgesprächs vor Zeugen‘ fördern.
Erkenntnisse der modernen Gruppen-Soziologie sollten auch auf die Organisation des Studiums in der Hochschule angewendet werden, um Experimente mit verschiedenen Formen der wissenschaftlichen Diskussion und Kooperation anzuregen. (Vgl. im einzelnen Kapitel Il, Die Hochschule und ihre Arbeitsformen). Die ständige Übung in der Praxis der rationalen Diskussion und kritischen Argumentation, die Belebung des Geistes der wissenschaftlichen ‚Disputation‘ muß zur grundlegenden gesellschaftlichen Konvention des Universitätslebens werden. Hierbei können die studentischen Fachschaften und wissenschaftliche Clubs oder ständige Arbeitskreise von Dozenten und Studenten eine entscheidende Rolle spielen.
Aus dem Fortschreiten der wissenschaftlichen Diskussion von der kritischen Fragestellung und Auseinandersetzung zum Vergleich oder zur Synthese der einzelnen Beiträge ergibt sich schließlich auch im Rahmen des Studiums der Übergang von der Diskussion zur Kooperation bei der Lösung oder beim Nachvollzug von beispielhaft gewählten wissenschaftlichen Problemen des Faches. Durch die Intensivierung und effektive Gestaltung der fachlichen Zusammenarbeit der Studenten in kleinen Gruppen wird letztlich auch die formale Voraussetzung der Teilhabe von Studenten am eigentlichen Forschungsprozeß, an den Grenzen des bisherigen Erkenntnisbereichs, geschaffen. Damit erweist sich die Intensivierung der kritisch-rationalen Diskussion als ein Weg der Hinwendung zur Praxis der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit, in der es um die Erarbeitung konkreter Ergebnisse, um die Lösung von Aufgaben im Gesamtzusammenhang des produktiven Wissenschafts-Prozesses, geht, die ihrerseits einen bestimmten Stellenwert im gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozeß haben.
Durch das Prinzip der rationalen, methodisch geführten Diskussion als der formalen Seite der kritischen Reflexion des Studiums wird aber nur eine gewissermaßen negative Formung der Person des Studenten bezweckt, die alle formalen Behinderungen eines echten Studiums in seinem Bewußtsein und in seinen sozialen Verhaltensweisen aufheben soll, um ihn freizusetzen für die Reflexion und Kritik. Die Formung des Intellekts zur Freiheit für die Reflexion und zur Kritikfähigkeit wird von der Universität gefordert, weil sie Grundvoraussetzung wissenschaftlichen Arbeitens ist, nicht aber als Mittel bei der harmonischen Entfaltung der Gesamtpersönlichkeit (die auf diese Weise allein auch gar nicht geleistet werden kann).
I.4.5 Methodologische Grundorientierung:
Die kritische Reflexion selbst, als Prozeß der Vertiefung des Studiums, setzt ein bei der Vermittlung des Bewußtseins der jeweils angewendeten fachwissenschaftlichen-selbstkritischen Methode und ihrer Begrenzung, an die Studenten, bei der ständigen Überprüfung der eigenen Arbeitsweise nach den Regeln der fachlichen Methodik.
Das Bewußtsein der Begrenzung der speziellen fachwissenschaftlichen Methoden auf ganz bestimmte Erkenntnisgegenstände weist aber zugleich über den Rahmen des Faches hinaus und legt den Vergleich mit Methoden und Fragestellung verwandter Disziplinen nahe.
Als erste Stufe der kritisch-reflektorischen Vertiefung des Fachstudiums ist eine intensive methodologische Grundorientierung der Studenten notwendig, die die erkenntniskritischen und wissenschafts-theoretischen Voraussetzungen der Methodik des Faches aufweist und in Vergleich setzt mit den Methoden anderer Disziplinen.
Die Einsicht in die methodischen Grundlagen und Voraussetzungen des Fachstudiums muß bereits im ersten Studienabschnitt, in Proseminaren und Tutorengruppen, einsetzen, um die Studenten von Anfang an von der extensiven Aneignung einer Überfülle von Lern-Stoff wegzuführen zur Reflexion der konkreten Methoden, die zu einem bestimmten Ergebnis im Rahmen des Wissensbestandes geführt haben.
Dabei muß den Studenten jedoch auch die Vielfalt der methodischen Wege innerhalb einer Fachwissenschaft bewußt gemacht und die Möglichkeit des Vergleichs verschiedener methodischer Ansätze gegeben werden, unter denen sie im weiteren Verlauf ihres Studiums einen individuellen Zugang zu speziellen Studienthemen finden sollen.
I.4.6 Wissenschaftstheoretische Studien:
Ein tieferes Eindringen in die Methodologie und Theorie des Faches muß allerdings Zwangsläufig zur Reflexion der gesellschaftlichen Bedingtheit wissenschaftlicher Tätigkeit und ihrer Funktion in der Gesellschaft führen. Das Bewußtsein der notwendigen Begrenztheit der Spezialmethoden eröffnet den Weg zu einer Haltung, die nicht stehen bleibt bei der isolierten wissenschaftlichen Arbeits innerhalb eines Fachgebietes, sondern sich bemüht, die Ergebnisse der jeweiligen Einzelwissenschaft auf ihren Sinn im gesamtgesellschaftlichen Prozeß zu befragen.
Als zweite Stufe der Vertiefung des Studiums ist daher die Einführung von fachbezogenen wissenschaftstheoretischen (wissenschaftssoziologischen) Studien erforderlich, in denen die Bezogenheit der Aufgaben und Probleme der einzelnen Fachgebiete auf die gesellschaftliche Wirklichkeit klar herausgestellt werden muß.
Die permanente Kritik des Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft kann nicht stellvertretend für alle Fächer, allein durch die Soziologie und Politologie geleistet werden, die selbst Spezialdisziplinen sind, sondern von jeder Einzelwissenschaft aus muß durch Selbstreflexion ihrer methodologisch-theoretischen Grundlagen hindurch die Funktion ihrer Ergebnisse im gesamtgesellschaftlichen Lebens- und Produktionsprozeß kritisch geprüft werden.
Im Verlauf der wissenschaftlichen Fachausbildung des Studenten muß ihm in der Haltung und Verantwortung seiner Lehrer das konkrete Engagement seiner Fachdisziplin an die Norm der Wissenschaft überhaupt bewußt gemacht werden.
Eine solche Haltung wird freilich um eine eindeutige Parteinahme nicht herunterkommen: Denn eine wissenschaftliche Verantwortung, die nicht zugleich Verantwortung vor der Sache der Menschlichkeit und der Freiheit von Unterdrückung und Ausbeutung ist, bleibt ihrem eigenen Begriff und dem Begriff der Bildung ungemessen. Das in der Selbstreflexion ausgesprochene Engagement an die Humanität als wissenschaftliches Bildungsziel ist das Ziel aufklärerischer Wissenschaft überhaupt, die den Anspruch erhebt, kritische Rationalität im Dienste des Menschen zu sein.
Das so bestimmte Engagement muß sich gegen e ine realitätsfremde, introvertierte „humanistische Bildung“ ebenso wenden wie gegen einen auf Beschreibung und Systematisierung des Materials sich reduzierenden positivistischen Wissenschaftsbetrieb. Denn die beiden zugrundeliegende kontemplative Haltung des Gelehrten gegenüber seinem Erkenntnismaterial reproduziert sich in seinem Verhalten zur gesellschaftlichen Praxis, das ebenfalls darin besteht das „Gegebene“ als Gegebenes zu akzeptieren.
Die Universität in der gegenwärtigen, antagonistisch strukturierten Gesellschaft ist allerdings nicht in der Lage, eine derartige engagierte Haltung ihrer Studenten und Dozenten ‚durchzusetzen‘ oder zu ‚kontrollieren‘. Die Reflexion des Verhältnisses Wissenschaft - Gesellschaft kann Studenten zur Parteinahme für die Sache der Menschlichkeit und Freiheit in der gesellschaftlichen Praxis führen und so für ihre ganze Lebensgestaltung und ihre Handlungen bestimmend werden, aber die Vermittlung einer solchen Haltung an die Studenten durch akademische Lehrer, die sich ihrer Verantwortung dafür bewu3t sind, ist ein seltener Ausnahmefall in einer Universität, die nur ein Ausschnitt der restaurativen Gesamtgesellschaft ist.
Die allgemeine Einbeziehung intensiver wissenschaftstheoretischer bzw. wissenssoziologischer Studien in die Ausbildung der Studenten in allen Fachrichtungen setzt voraus, daß zunächst innerhalb der Hochschule die Bemühungen um die Gewinnung eines neues Selbstverständnisses der Wissenschaften und ihrer gesellschaftlichen Funktion verstärkt werden. Erst wenn die Reflexion des Selbstverständnisses der Wissenschaft innerhalb ihrer Integration in den gesamt-gesellschaftlichen Produktionsprozeß bei der Ausbildung der künftigen Dozenten selbst wieder stärker in den Mittelpunkt tritt, kann erwartet werden, daß eine allgemeine Vertiefung des Fachstudiums in diesem Sinne erfolgt.
Um jedoch die wissenschaftliche Arbeit und die kritische Auseinandersetzung auf diesem Gebiet stärker in Gang zu setzen, könnten einige zusätzliche organisatorische Voraussetzungen geschaffen werden, die es Dozenten und Studenten, die ihre Verantwortung in dieser Frage ernst nehmen, erleichtern würden, sich dafür einzusetzen, z.B. durch die befristete Freistellung von Fachgelehrten und Assistenten zur wissenschaftlichen Arbeit und Fortbildung in Fragen der Theorie und des gesellschaftlichen Standorts ihrer Fachwissenschaft oder der sozialen Funktion der Ausbildung in ihrem Fach, möglichst in Kontakt oder Kooperation mit Fachkollegen und Dozenten der Philisophie oder Soziologie, die für derartige Studien befähigt sind; durch Vergabe zahlreicher Forschungsstipendien an wissenschaftliche Nachwuchskräfte zur Bearbeitung derartiger Probleme; durch Gründung von Institutionen, die der gemeinsamen Diskussion und wissenschaftlichen Arbeit von Dozenten und Studenten verschiedener Fachrichtungen über die Theorie und Soziologie der Einzelwissenschaften dienen, etwa auf Anregung und Initiative von Professoren der Philosophie und der Soziologie an einigen Universitäten.
I.4.7 Sozialwissenschaftliche Studien:
Die darüberhinausgehende Fundierung der kritischen Reflexion des Verhältnisses von Einzelwissenschaften und Gesellschaft durch Einführung allgemeiner sozialwissenschaftlicher Studien ist in der gegenwärtigen Universität nicht als verbindlich für alle Studenten anzustreben, sondern nur für diejenigen zu ermöglichen, die aus echtem Interesse, aufgrund vertiefter wissenschaftlicher Reflexion oder aus einem praktisch-politischen Engagement sich dafür aufgeschlossen zeigen.
Bei der gegenwärtigen politischen Bewußtseinslage der Studentenschaft - ihrer Entpolitisierung und Entfremdung von realer gesellschaftlicher Praxis -müßte den meisten Studenten das Studium gesellschaftlicher Fragen autoritativ gegen ihren Willen aufgedrängt werden. Das in einem solchen Verfahren und Bewußtsein vermittelte bzw. gelernte Wissen hätte den Charakter eines toten Lernstoffs und bliebe politisch völlig folgenlos.
Die verbindliche Einführung sozialwissenschaftlicher Studien für alle Studenten etwa durch entsprechende akademische (nicht staatliche) Prüfungsbestimmungen und Studienpläne ist im gegenwärtigen Zeitpunkt völlig ausgeschlossen, sollte allerdings als ‚Planziel‘ beim Ausbau der Hochschulen berücksichtigt werden.
Dazu müssen erst durch eine umfassende Hochschulreform die folgenden politischen und sachlichen Voraussetzungen geschaffen werden:
- Volle Verwirklichung der akademischen Freiheit der Lehre und des Studiums, um die autoritären Wirkungen des gegenwärtigen Lehr- und Unterrichtsbetriebs auszuschalten;
- reale Demokratisierung der Hochschule, um eine wirksame Beteiligung der Studenten an der Gestaltung ihres Studiums auch durch die Lehrpläne zu erreichen
- volle Verwirklichung der Autonomie der Hochschulen, um den Einfluß staatlicher und gesellschaftlicher Kräfte auf Gestaltung und Ziele einer sozialwissenschaftliche Bildung zu verhindern.
- Planmäßiger Ausbau der sozialwissenschaftlichen Institute, Bibliotheken, mentationszentren und breite Förderung wissenschaftlicher Nachwuchskräfte in den Sozialwissenschaften zur großzügigen Erweiterung des Lehrkörpers.
Der Sinn sozialwissenschaftlicher Studien für Studenten anderer Fachrichtungen kann nicht darin bestehen, sie neben oder nach ihrer Fachausbildung zu Soziologen auszubilden, sondern das exemplarische Studium realer gesellschaftlich-politischer Prozesse soll ihnen die notwendige Orientierung bei der kritischen Reflexion der Funktion ihres Studiums, ihres künftigen Berufs und ihrer Fachwissenschaft im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang verschaffen, soll ihnen das Bewußtsein der Wirklichkeit und der Theorie der Gesellschaft vermitteln, in der sie Verantwortung tragen für die Sache der Humanität.
Daher muß der reale Lebensprozeß dieser kapitalistischen Eigentums-Gesellschaft - die Produktion und die Verhältnisse in denen produziert wird - der Ausgangspunkt solcher Studien sein. Von dort aus müssen beispielhaft fundamentale wirtschaftliche und soziale Prozesse sowie politische Vorgänge aus der neuesten und Zeit-Geschichte als Studiengegenstände ausgewählt werden.
Eine oberflächliche „politische Bildungsarbeit“, als Variante der allgemeinen Erwachsenenbildung für Studenten ist auch als Zwischenlösung abzulehnen, stößt auch bei Studenten, die ihr Studium bewußt methodisch-wissenschaftlich betreiben, auf Ablehnung. Das wissenschaftliche Niveau muß auch bei allgemeinen politisch- sozial wissenschaftlichen Studien unbedingt gewahrt bleiben. Daher sollte der Bildungswert einer Soziologie, die nicht beim Sammeln und Klassifizieren von politischen Fakten, sozialen Beziehungen und Handlungen stehen bleibt, sondern nach dem objektiven Sinn gesellschaftlicher Prozesse fragt, die sich in den ‚Fakten‘ ausdrücken, im Mittelpunkt allgemeiner sozialwissenschaftlicher Studien stehen:
„Indem Kenntnis der Methode und der soziologischen Forschungsergebnisse auch für den Nichtsoziologen die Fähigkeit zu differenzierter Erfahrung stärken kann, indem sie das Verständnis für Menschen erweitert und der Anfälligkeit für Fanatismus entgegenwirkt, setzt Soziologie die vielgehaßte Aufklärung fort. Was früher Bildung geheißen hat, die geistige Widerstandskraft gegen die aufs Bewußtsein einstürmenden Tagesmächte,' [FEHLER] ist nicht mehr denkbar ohne das Wissen von Gesellschaft und die Prozesse in ihr.“ (Horkheimer) (60)
In der gegenwärtigen Situation sollten sich Bemühungen um eine sozial-wissenschaftliche Bildung von Studenten aus allen Fächern auf folgende konkrete Ansätze beschränken:
1) Aufgrund der unabhängigen Initiative von Professoren (bzw. Instituten) der Soziologie, Politischen Wissenschaft und der Philosophie, die ihre wissenschaftliche Arbeit nicht im Sinne eines „objektiven“ technisierten Wissenschaftsbetriebs verstehen, sondern in zeitgemäßer Fortsetzung des aufklärerischen Anspruchs den Begriff von Gesellschaft selbst kritisch reflektieren, sollten differenzierte sozialwissenschaftliche Bildungs- oder Studienprogramme für interessierte Studenten aller Fakultäten entworfen und durchgeführt werden, in der Form von Seminaren, Kolloquien mehrerer Dozenten, Arbeitskreisen und Wochenendseminaren.
Dadurch soll Studenten, die aufgrund wissenschaftstheoretischer Reflexion oder aus einem praktisch-politischen Engagement heraus sich dafür aufgeschlossen zeigen, die Möglichkeit gegeben werden, sich parallel und z.T. in Beziehung zu ihrem Fachstudium über Vorgänge der gesellschaftlichen Realität anschaulich zu informieren und zur Reflexion der Theorie der Gesellschaft vorzustoßen. Nur ein derartiges Studienprogramm auf wissenschaftlicher Basis, das nicht stehen bleibt bei der Vermittlung von Fakten über den politischen Mechanismus und seinen Institutionen, sondern zu kritisch-rationaler Auseinandersetzung und zum politischen Engagement provoziert, wird auf begabte und selbständig denkende Studenten auch anderer Fächer eine Anziehungskraft ausüben.
Jene akademischen Lehrer der Soziologie, der Philosophie oder der Politischen Wissenschaft, die sich in ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit und Lehre ihrer Verantwortung vor der Sache der Menschlichkeit bewußt sind, tragen auch Verantwortung dafür, daß ein kritisches Bewußtsein der Idee und Wirklichkeit der Gesellschaft nicht nur ihren eigenen fachlichen Schülern, sondern darüberhinaus auch aufgeschlossenen Studenten anderer Fakultäten vermittelt wird. Sie sollten daher ihren Einfluß nutzen, um die notwendigen Mittel zur Einrichtung freier sozialwissenschaftlicher Studienprogramme für interessierte Nicht-Soziologen (bzw. -Politologen), zu erhalten.
2) In Anlehnung an eine Empfehlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz aus dem Jahre 1954 (61) sollten von einigen Instituten oder Seminaren für Soziologie und Politische Wissenschaft, deren Dozenten sich für die Förderung der sozialwissenschaftlichen Bildung unter der Studentenschaft besonders verantwortlich fühlen und dazu geeignet erscheinen, wissenschaftliche Lehrgänge durchgeführt werden, für die interessierte und geeignete Studenten aller Fakultäten nach Abschluß ihres Fachstudiums mehrere Semester lang als Stipendiaten für Arbeiten in der Soziologie oder Politischen Wissenschaft freigestellt werden könnten, bevor sie in die Berufspraxis gehen.
Die geistige und materielle Unabhängigkeit dieser Studienprogramme und der Stipendiaten muß durch die Selbstverwaltungsorgane der Hochschule gesichert werden. Die Stipendiaten werden von Kommissionen aus Fachdozenten, den Dozenten des Studienprogramms und Studentenvertretern ausgewählt. Bei der Planung des Lehrgangs sollten die Dozenten weitgehend auf die Studieninteressen der Stipendiaten eingehen.
I.4.8 Studium und Praxis
So wie es sich als Illusion erwiesen hat, von der formalen Freiheit des Wissens die Selbstentfaltung des Menschen zur erfüllten Individualität zu erwarten, so bleibt immer noch offen, ob selbst von einem tieferen kritisch-rationalen Selbstverständnis der Wissenschaft und des Studiums zur energischen Tat inmitten des gesellschaftlichen Prozesses vorangeschritten wird; ob sich nicht vielmehr „die traditionelle Kluft zwischen der Subjektivität und der äußeren Wirkungskraft der Akademiker“ (62) wiederholt in dem Bewußtsein eines akademischen ‚Kritikers‘, der von der Reflexion über die ‚Waffe der Kritik‘ niemals zur ‚Kritik der Waffen‘ gelangt. Es genügt nicht, den Stellenwert der Wissenschaft und seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit im gesellschaftlichen Funktionszusammenhang zu wissen, sondern dieses Wissen muß umschlagen in eine Form der kritisch-revolutionierenden Praxis im weitesten Sinne.
Allein in der Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit vermag der Mensch zu sich zu finden:
„Gebildet wird mach nicht durch das, was man „aus sich selbst“ macht, sondern einzig in der Hingabe an die Sache, in der intellektuellen Arbeit sowohl wie in der ihrer selbst bewußten Praxis.“ (63)
Erst in der Einheit von Wissen und Praxis besteht die konkrete Chance zur vollen Selbstverwirklichung der Individualität des wissenschaftlich arbeitenden Studenten.
Der Begriff von ‚Praxis‘ ist ausschlaggebend dafür, ob man der Universität überhaupt zugesteht, einen Beitrag zur Selbstverwirklichung der Person des Studenten in der Praxis zu leisten. Gegen einen oberflächlichen verengten Begriff von Praxis, der zumindest die traditionelle und gegenwärtige deutsche Universität als Stätte des bloßen praxisfernen Wissen nicht zum Bestandteil des gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozesses rechnet oder aber sie als ‚Insel der Geistes‘ im Meer der ‚materialistischen‘ Berufs- und Arbeitswelt ideologisch verklärt, ist festzustellen:
Die konkrete wissenschaftliche Forschungsarbeit am speziellen Objekt und die intellektuelle Arbeit des Studenten für seine wissenschaftliche Fachausbildung, wie sie in der modernen Hochschule als wissenschaftliche Arbeitsstätte organisiert sind, sind selbst Formen der Praxis im Gesamtzusammenhang des gesellschaftlichen Produktionsprozesses im weitesten Sinne. Die Ergebnisse dieser intellektuellen Arbeit von Wissenschaftlern und Studenten - anwendbare Forschungsergebnisse und einsetzbare wissenschaftlich qualifizierte Arbeitskraft - sind sogar Grundvoraussetzungen der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Produktion und Organisation. Die Hochschule ist längst nicht mehr eine Akademie einer philosophisch geprägten universalen Wissenschaft. sondern ein Wissenschafts- und Ausbildungsbetrieb. Im Bewußtsein und in der Tätigkeit der Studenten und ihrer Lehrer sollte sich daher Wissen und Praxis eigentlich in dreifacher Weise gegenüberstehen:
– Die Beherrschung der wissenschaftlichen Arbeitsweise und Methodik- und die praktische wissenschaftliche Arbeit am konkreten Objekt;
– die Kenntnis der wissenschaftlichen Voraussetzungen und Methoden, die für eine bestimmte Berufsarbeit notwendig sind - und die Anwendung dieses Wissens in der Berufsarbeit selbst;
– das Verständnis von Idee und Wirklichkeit der Gesellschaft - und die gesellschaftsverändernde politische Praxis.
I.4.9 Wissenschaftliche Praxis:
Die Einheit von Wissen und Praxis im Prozeß der wissenschaftlichen Arbeit erfüllt sich in dem Maße, in dem die Aneignung von fertigen wissenschaftlichen Ergebnissen, von Lern-Stoff oder von methodischen Regeln der Fachwissenschaft sowie die kritische Reflexion dieses Wissens durch den einzelnen Studenten als isolierten Wissens-Konsumenten oder theoretischen Kritiker umschlägt in die wisssenschaftlich-kritische Auseinandersetzung und Kooperation mit anderen Studenten und Dozenten am konkreten Studien- oder Forschungsgegenstand. Der Prozeß der produktiven Zuspitzung des kritischen Beitrags der Einzelnen zur Kooperation ist eine Form des Umschlagens der ‚Theorie‘ des Wissens in die Praxis der wissenschaftlichen Arbeit.
Für die volle Entfaltung der Persönlichkeit und Initiative des Studenten durch die Einheit von theoretischer Reflexion und praktischer Arbeit an der Wissenschaft ist es daher zunächst entscheidend, ob es gelingt, in der Universität praktische Formen einer lebendigen kritischen Diskussion und Kooperation unter Studenten und Dozenten zu entwickeln (bzw. bewährte Formen wiederzubeleben), die den Studenten vom passiven und isolierten ‚Hörer‘ oder stillen ‚Denker‘ wieder oder noch stärker zum wissenschaftlich Arbeitenden machen. Es ist für derartige organisatorische Formen bereits der Ausdruck ‚Wissenschaftliches Praktikum‘ geprägt worden, das etwa in der Form eines ganztägigen Praktikums (in jeder Woche) durchgeführt wird, in dessen Verlauf intensive Besprechungen von Studenten-Gruppen mit Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern, praktische Übungen und Sitzungen von Arbeitsgruppen nötig wären, um wenigstens einen Teil der Studenten höherer Semester in direkten Kontakt mit der wissenschaftlichen Arbeit ihrer Lehrer und der Hochschulinstitute zu bringen.
Die Praxis der Wissenschaft besteht aber auch in der ständigen Konfrontation des Erkenntnisprozesses mit dem Objektiven, seinen konkreten Gegenständen aus dem Bereich der menschlichen Gesellschaft und der Natur. Als organisatorische Ausformung dieses Verhältnisses sind z.B. die studien- oder wissenschaftsbezogenen Exkursionen und Praktika zu fördern, die nur deshalb veranstaltet werden, um dem Studenten einen besseren Einblick in die realen Umstände und Bedingungen seines Studien- oder Forschungsgegenstandes zu verschaffen.
Ebenso sind Kontakte der Hochschulinstitute zu ‚Vertretern der Praxis‘ aus Gesellschafts und Lebensbereichen zu fördern, denen die Studienobjekte der Dozenten und Studenten entstammen.
I.4.10 Berufliche Praxis
Die intensive gegenseitige Durchdringung von Wissenschaft und Berufspraxis in immer mehr Lebensbereichen bringt es mit sich, daß sich der Student während der Zeit seines Studiums gleichzeitig mit der Wissenschaft beschäftigt und sich intensiv auf eine Berufsstellung vorbereitet. Durch das gegenwärtige akademische ‚Konjunktur-Klima‘, in dem viele Studenten darauf drängen, ihre ‚akademische Arbeitskraft‘ so schnell und so teuer wie möglich zu verkaufen, und durch den Druck von zahlreichen Berufsverbänden auf die Hochschulen nimmt aber die Tendenz zur Verlagerung von Teilen der direkten Berufsausbildung an die Universität immer mehr zu.
Die Universität kann aber den Studenten neben der Fähigkeit, spezielle wissenschaftliche Ergebnisse und Methoden für ihre Verwertung und Anwendung in der Praxis des Berufs auszuwerten, bestenfalls nur indirekte, aber um so wertvollere Qualifikationen für die Berufspraxis vermitteln: die Fähigkeit, kritisch-selbständig zu denken, konsequent-methodisches planvolles Vorgehen und eigene Initiative bei der Lösung komplizierter Aufgaben. Die Praxis in Wirtschaft und Verwaltung verlangt zwar durchaus nach solchen Qualitäten, aber noch stärker nach der Beherrschung bestimmter spezieller Techniken und Kenntnisse, die eigentlich nichts mit dem Ziel des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses zu tun haben. Daher wird der Druck von Vertretern der Berufspraxis auf die Universität zur stärkeren Anpassung des Lehrplan an diese Bedürfnisse (die eigentlich der Einsparung von Kosten für die längere Ausbildungszeit innerhalb der Berufsarbeit dienen) eher noch zunehmen.
Anderseits hat die berufliche Praxis, die von den angewandten Ergebnissen der technischen und Naturwissenschaften geprägt ist, einen so hohen Grad der Spezialisierung erreicht, daß es der Universität objektiv unmöglich wäre, in diesen Fachrichtungen eine Ausbildung für spezielle Berufsstellringen zu vermitteln. Die Gefahr der blinden Anpassung des Studiums an die geäußerten direkten Bedürfnisse der speziellen Berufsausbildung ist daher eher in einigen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern gegeben, in denen von Seiten der Berufspraxis nicht die Fähigkeit zu spezieller wissenschaftlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit oder die ständige spezielle wissenschaftliche Fortbildung innerhalb der Praxis verlangt wird. (wie es z.B. für Absolventen der Fächer Chemie, Medizin und anderer naturwissenschaftlicher und technischer Fachrichtungen durchaus der Fall ist), sondern in denen die Beherrschung von mehr oder weniger komplizierten direkt-berufsbezogenen Techniken und pragmatischen ‚Kunstlehren‘ verlangt wird (Jura, Wirtschaftswissenschaften, allgemeine und Wirtschaftspädagogik, Markt- und Meinungsforschung).
Hier ist die Berufspraxis im Gegensatz zu den von Naturwissenschaften durchdrungenen Bereichen vielfach gerade nicht von entscheidenden und neueren Erkenntnissen und Methoden der Wissenschaft bestimmt, sondern soziale Sonderinteressen und Vorurteile verhindern die gesellschaftlich notwendige konsequente Umsetzung solcher wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis.
Ein Selbstverständnis der Universität, das sich zu ihrer Verantwortung für das gesellschaftliche Gesamtinteresse bekennt, erfordert es, daß die Universität in diesen Fachrichtungen entgegen den Wünschen von sozialen Interessengruppen und auch gegen den Willen von Studenten, die sich an deren Parolen orientieren, die Verkürzung und Reduzierung des Studiums auf die Vermittlung von pragmatischen Kunstlehren und Grundkenntnissen ablehnt, und vielmehr das Prinzip der wissenschaftlichen Vertiefung in de Spezialisierung des Studiums noch weiter ‚radikalisiert‘ - auch wenn damit eine Verlängerung der Studiendauer unumgänglich wird. Die Universität hat es in der Hand, durch ihre Prüfungsordnungen (einschließlich akademischer Zwischenprüfungen) diese Tendenz durchzusetzen.
Beim Festhalten am Prinzip der wissenschaftlichen Vertiefung in der Spezialisierung besteht die Chance, daß eine aktive Minderheit von Studenten mit dem Bewußtsein in wichtige Positionen der Berufspraxis gelangt, aus neuen, gesellschaftlich relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen ihres Fachgebietes Konsequenzen ziehen zu müssen für die Lösung praktischer sozialer Aufgaben, auch gegen den Druck sozialer Teilinteressen. Die Konfrontation der auf praktische Realisierung drängenden wissenschaftlichen Ergebnisse mit sozialen Verhältnissen, die eine solche Konsequenz nur zulassen, wenn das Ergebnis den je herrschenden sozialen Sonderinteressen und Vorurteilen nicht zuwiderläuft, kann den so provozierten Akademiker, der sein Studium unter wissenschaftlichen Fragestellungen betrieben hat, zum Engagement in der gesellschaftsverändernden politisch-sozialen Praxis treiben.
Die Universität sollte eine derartige zielgerichtete wissenschaftliche Berufsorientiertheit von Studenten, ihre kritisch-bewußte Anpassung an die Berufspraxis vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse und des gesamtgesellschaftlichen Interesses, dadurch unterstützen, etwa indem sie exemplarisch (besonders im letzten Studienabschnitt) eine intensive Konzentration auf die wissenschaftliche Arbeit an begrenzten, gesellschaftlich relevanten wissenschaftlichen Problemkreisen ermöglicht, deren wissenschaftliche Bearbeitung Voraussetzung der Lösung vordringlicher gesamtgesellschaftlicher Aufgaben ist. Da die Bearbeitung solcher Fragen vielfach nur bei Anwendung von Methoden und Ergebnissen verschiedener Fachrichtungen effektiv möglich ist, muß im Verlauf des Studiums schon aus diesem Grunde dafür gesorgt sein, daß der Student neben einer gründlichen Spezialisierung auf ein Fachgebiet auch Einblick in Methoden, wissenschaftliche Fragestellungen und grundlegende Erkenntnisse benachbarter oder sinnvoll zu kombinierender Fachrichtungen erhält. (64)
Andererseits ist es weder möglich noch wünschenswert, die Lehre und Einübung technisch-pragmatischer Kunstlehren und Stoff-Systeme aus dir Universität völlig zu verbannen, erstens weil ihre Beherrschung in der heutigen intensiv technisierten Zivilisation auch für die meisten akademischen Berufspositionen unerläßlich ist, und zweitens weil gerade durch sie hindurch und nicht isoliert davon der Ansatz zu einer wissenschaftlichen Vertiefung durch kritische Überprüfung von bestimmten Regeln und Voraussetzungen dieser „geistes-technischen“ Systeme gefunden werden muß, denn eine solche Situation ist auch der Normalfall in der eigentlichen Praxis, die von weitgehend erstarrten, nicht aktuell wissenschaftlich geprüften pragmatischen Regeln und Verhaltensmustern geprägt ist. Diese Kunstlehren müssen, indem sie gerade in der Universität und nicht in speziellen Fachschulen gelehrt und geübt werden, ständig kritisch in Frage gestellt und vor dem Hintergrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf ihre gesamtgesellschaftlich notwendige Funktion hin überprüft werden.
Allein die Vermittlung solcher Fertigkeiten, die kaum noch einen Bezug zu wissenschaftlichen Methoden und Fragestellungen haben, aber praktisch notwendiger Bestandteil der Berufsausbildung von Studenten sind, muß von der Universität auf bestehende oder neu zu gründende höhere Fachschulen verlagert werden, auf denen einige Fachkurse auch von Studenten parallel zu ihrem Universitätsstudium besucht werden könnten (z.B. in neuen Wirtschaftsfachschulen, Verwaltungsfachschulen). Die pädagogische Ausbildung der künftigen Lehrer ist dagegen auf jeden Fall unter wissenschaftlichen Fragestellungen und auf der Basis neuer erziehungswissenschaftlicher und psychologischer Erkenntnisse in Universitätsinstituten für Pädagogik durchzuführen, gleichzeitig in welchen Schulzweigen die Lehrer unterrichten werden (Vgl. Kapitel II).
Die Vermittlung praktischer Fertigkeiten durch eine ein- bis zweijährige berufliche Vorpraxis (z.B. als kaufmännische Lehre, wie sie die Wirtschaftspraxis für die Studenten fordert) sollte von den Hochschulen nur denn gebilligt werden, wenn die Erlernung dieser Fähigkeiten für das Studium Vorbedingung und nicht auf anderem Wege, neben dem Studium (in Fachschulen oder durch kürzere Praktika in den Semesterferien) möglich erschein. Die Eingliederung der Studenten in die Berufsarbeit in Betrieben vor dem Studium kann ihre einseitige und unkritische Berufsorientiertheit nur noch verstärken, und veranlaßt sie dazu, den ‚Zeitverlust‘ durch ein möglichst kurzes, oberflächliches Studium wieder einzuholen. (So fordert z.B. auch die Wirtschaftspraxis als Konsequenz ihres Vorschlages die Verkürzung der gegenwärtigen Studiendauer auf sieben Semester, während gleichzeitig in fast allen Fachrichtungen eine Verlängerung des Studiums notwendig wird). Es kann durch eine derartige Vorpraxis auch kaum festgestellt werden, ob der Student für ein bestimmtes Fachstudium geeignet ist. Die Fundierung der Berufswahl durch Einblick in die Praxis des Berufs kann auch durch kürzere praktische Tätigkeit während der ersten Studienjahre erreicht werden, die auch der Prüfung der Begabung des Studenten für bestimmte Fachrichtungen dienen sollen.
Wo dennoch ein längeres Berufspraktikum sachlich notwendig ist, so sollte es eher in der Mitte des Studiums als vor seinem Beginn durchgeführt werden. Der Student sollte sein Praktikum nicht in völliger Unkenntnis der wissenschaftlichen Beurteilung von Vorgängen der Berufspraxis absolvieren. Mindestens aber sollte das Praktikum wie es zumeist in den technischen Fächern geschieht, in zwei Teile, vor Beginn und in der Mitte des Studiums, aufgeteilt werden.
I.4.11 Gesellschaftliche Praxis:
Die beiden Formen der Hinwendung zur Praxis im weiteren Sinne: durch Teilnahme am wissenschaftlichen Arbeitsprozeß und durch Vorbereitung auf die Berufspraxis, die beide ihren notwendigen Stellenwert im gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozeß haben, müssen aber ergänzt und ‚radikalisiert‘ werden durch gesellschaftliche Praxis im engeren Sinne.
Das Aussichherausfinden des wissenschaftlich Denkenden in den gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsprozeß darf nicht stehen bleiben bei der ihm nächstliegenden Praxis der speziellen wissenschaftlichen und beruflichen Arbeit. Die objektiven Verhältnisse treten ihm nicht nur in dem Besonderen entgegen - in seinem speziellen Beruf, der seinem persönlichen Fortkommen dient und nur einen abgestrennten Sektor des gesellschaftlichen Lebens darstellt - sondern in dem Allgemeinen der zentralen gesellschaftlich-politischen Prozesse, in denen für oder wider eine vernünftige und menschliche Einrichtung und Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse und - im Atomzeitalter - für oder wider die Erhaltung der Existenz von menschlich-zivilisierter Gesellschaft überhaupt entscheiden wird.
Zu solcher Praxis gehört als Voraussetzung die lebendige Erfahrung des Studenten in anderen Lebens und Arbeitsbereichen der Gesellschaft. Sie kann er nur durch eine realistische, nicht spielerisch betriebene oder künstlich erleichterte ‚gesellschaftliche Praxis‘ gewinnen, in der er die zentralen gesellschaftlichen Widersprüche und die realen Arbeitsverhältnisse erfährt, unter denen die meisten Menschen zu arbeiten haben, und in der er an den konkreten politischen Konflikten teilnimmt, in denen sich die gesellschaftlichen Antagonismen ausprägen.
Als Formen realistischer gesellschaftlicher Praxis für Studenten sind die Arbeit in der industriellen Produktion und die praktisch-politische Betätigung in politischen Organisationen anzusehen - z.B. in Parteien, Gewerkschaftten, in politischen Jugend- und Studentenverbänden, die sich nicht als Freizeit- und Bildungsvereine, sondern als politische Aktionsgruppen verstehen, aber auch in einer Studentenvertretung mit realen politischen Zielsetzungen.
Im Sinne einer Bildung des Studenten zu kritischer Rationalität im Dienste des Menschen ist aber eine gesellschaftliche Praxis notwendig die im Bewußtsein des Engagements an die reale Vermenschlichung gesellschaftlicher Verhältnisse geschieht. Solche Praxis erfolgt nicht aus einem ‚freischwebenden‘ ethischen Impuls oder im Hören auf einen abstrakten Appell zur Menschlichkeit, sondern dahinter steht der Zwang des Menschen, nur durch seine „Entäußerung“ an die Umwelt, in der Hingabe an den Prozeß der naturbewältigenden Arbeit der Menschen in der Gesellschaft, zu sich selbst finden zu können. Eine Universität, die den Anspruch auf reale menschliche Bildung ihrer Studenten einlösen wollte, könnte dies nicht aus sich selbst heraus tun, sondern nur indem sie in enger Arbeitsteilung mit anderen gesellschaftlichen Institutionen die äußeren Voraussetzungen dafür schafft, daß im Leben und in den Handlungen der Studenten eine enge Verknüpfung von Wissen und Praxis im Dienste der Menschen sich vollzieht und eine Einheit von theoretisch-‚radikaler‘ Reflexfon des speziellen Fach-Wissens und gesellschaftsverändernder Praxis erreicht wird, die über die Anwendung erlernter wissenschaftlicher Kenntnisse im speziellen Beruf hinausgeht.
Konsequenterweise müßte daher ein Studienprogramm der Universität zur wissenschaftstheoretischen und sozialwissenschaftlichen Bildung der Studenten vollendet werden durch seine Verknüpfung mit einem Programm gesellschaftlicher Praxis, etwa durch Einführung eines generellen Werkjahres zur normalen Arbeit in der Produktion für alle Studenten, und und in der Verpflichtung, nach freier Wahl sich entweder in der Studentenvertretung, in politischen Organisationen oder in unabhängiger Weise praktisch-politisch zu betätigen.
Aber ebensowenig wie in der gegenwärtigen Universität ein verbindliches Programm sozialwissenschaftlicher Studien für alle oder auch nur einen größeren Teil der Studenten verwirklicht werden kann, so fehlen auch zur Einführung von verbindlichen Formen gesellschaftlicher Praxis für die Studenten gegenwärtig fast alle Voraussetzungen. Was im Falle der sozialwissenschaftlichen Studien dafür die gegenwärtige geistige Situation und reale Struktur der Universität entscheidend, so sind für die Ablehnung einer verbindlichen gesellschaftlichen Praxis (z.B. des allgemeinen Werkjahres) die gegenwärtigen sozialen Bedingungen und politischen Verhältnisse in der Wirtschaft und den politischen Verbänden ausschlaggebend: Die herrschenden gesellschaftlichen Machtgruppen hätten es u- der Hand, die gesellschaftliche Praxis der Studenten in einer Weise ideologisch für ihre Zwecke auszugestalten, daß nicht das Engagement an die vernünfte Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern die ‚Einsicht‘ in die vorgebliche ‚Vernünftigkeit‘ des je Gegebenen im Zentrum stünde.
Die Hochschulpolitik der Unternehmer hat aus eigener politische Initiative diesen Weg längst beschritten, noch ehe von anderer Seite eine konkrete Konzeption des Betriebspraktikums von Studenten entwickelt wurde. (65)
So wurden die Anregungen aus der sowjetischen Bildungs- und Studienreform mit dem Prinzip des ständigen Wechsels von Studium und Arbeit in der Produktion in der Bundesrepublik bis jetzt nur von Seiten der Unternehmer aufgegriffen und für ihre Zwecke mit einem entgegengesetzten Vorzeichen versehen. (66)
In der Erkenntnis, daß die bisherige Form der Werkarbeit, in der der Student unter normalen Bedingungen als Beschäftigter in allen möglichen Betrieben sein Geld verdient, z.T. dazu beigetragen hat, Illusionen über die sozialen Verhältnisse zu zerstören und Kritik zu wecken, versucht die Industrie die Werkarbeit auch ideologisch zu ‚kanalisieren‘. So hat das Deutsche Industrie-Institut das Modell eine Betriebspraktikums für Studenten aller Fakultäten entwickelt, dem zufolge der Student für vier Wochen in den Arbeitsprozeß „eingegliedert“ wird, nachdem ihm vorher der Betrieb erklärt worden ist. In diesen vier Wochen wird der Student weder durch Selbstverständnis noch durch objektive Verhältnisse ein Arbeiter sein, da er einen ausdrücklich anerkannten besonderen Status hat. Die Arbeiter werden ihn als einen Delegierten der Unternehmensleitung betrachten. Nach diesen vier Wochen folgen zwei Wochen „Informationszeit“, in denen der Student vom Management ‚betreut‘ und unterrichtet wird, wodurch das Ganze vollends zu einem gut gesicherten Ausflug in die fremde Welt einer fremden Klasse (des ‚Arbeiterstandes‘) wird. Der Arbeitgeberverband hat Empfehlungen herausgegeben, die auf den Erfahrungen dieser Praktika aufbauen und darauf abzielen, dem normalen und bisher sich frei entwickelnden Werkstudententum einen ähnlichen festen Rahmen zu geben.
Da gegenwärtig die Unternehmer die Verfügungsgewalt über die Durchführung und Organisation der meisten Betriebspraktika hätten, ist ihre verbindliche Einführung auch nur für einen Teil der Studenten abzulehnen. Gleichzeitig sollte aber den Vorstellungen der Unternehmerschaft, die bei dem anhaltenden Zwang zur Werkarbeit in den Semesterferien eine echte Realisierungschance besitzen, ein konkretes Programm für freiwillige studentischen Betriebspraktika entgegengesetzt werden:
Auf freie Initiative von Arbeitskreisen aus interessierten Dozenten der Soziologie und Studenten sollten Betriebspraktika für interessierte Studenten aller Fakultäten vorbereitet und ausgewertet werden, die in solchen Industriebetrieben stattfinden müssen, in denen eine nicht einseitig vom Unternehmerinteresse bestimmte Gestaltung der Praktika ermöglicht wird.
Ein Betriebspraktikum, das den Studenten in die Realität der Arbeitsbedingungen und - verhältnisse des Betriebes versetzt und zugleich eine kritische Reflexion seiner Erfahrungen im Gespräch erlaubt, muß unter den folgenden Bedingungen stattfinden:
- Es muß mindestens ein halbes Jahr dauern und in der gleichen Arbeitsstätte verbracht werden.
- Der Student soll in dieser Zeit keine Privilegien gegenüber seinen Arbeitskollegen haben.
- Es sollen mehrere Studenten im Betrieb arbeiten, die untereinander Kontakt haben.
- Es sollen Diskussionsabende oder Wochenendtreffen zwischen Studenten, Arbeitern und Hochschullehrern stattfinden.
- Vor und nach dem Praktikum sollen an der Universität Seminare mit Soziologen und Praktikanten stattfinden, um die Problematik der Arbeitsverhältnisse im Zusammenhang mit der Theorie und Gesamtverfassung der Gesellschaft kritisch zu durchdenken.
(Als Vorbild dafür können z.T. vom Studienwerk Villigst durchgeführten Betriebspraktika und Werkseminare angesehen werden.)
I.5 Gliederung des Studiums
In einer Situation, in der sich die Hochschule in steigendem Maße mit der Aufgabe der speziellen Berufsvorbereitung konfrontiert sieht und in der sich ihre äußere Notlage und Überfüllung immer mehr zuspitzt, entstanden innerhalb und außerhalb der Hochschule Lösungsversuche, die eine Teilung des Studiums in zwei Abschnitte durch eine Zwischenprüfung vorgesehen, in einen ersten, stärker „verschulten“ Studienabschnitt (Grundstudium), und einen zweiten, freieren Studienabschnitt (Hauptstudium). (67)
Nach einem Modell des VDS sollen am Ende des Grundstudiums das Wissen und die Leistung des Studenten in einer Reihe von Fächern, von denen er einige am Ende der Grundsemester abschließen soll, sowie seine Eignung zum Studium der gewählten Fachrichtung geprüft werden. In den Anfangssemestern soll das Studium stärker „geordnet“ werden, damit sich der Student später in seinem Hauptstudium „frei orientieren und entfalten kann“. Besonders von der Wirtschaftspraxis sind die Vorschläge des VDS und einer Kommission der Kultusminister- und Rektoren-Konferenz für eine solche Teilung des Studiums begrüßt worden unter dem Gesichtspunkt, die Studenten dazu anzuhalten, schon zu Beginn des Studiums gründlich und fleißig zu lernen und nicht etwa, wie das heute noch vorkommt, die ersten Semester zu „verbummeln“, und um ihnen zugleich „eine Art Richtlinie für den Studienaufbau“ zu geben. (68)
Sicher ist, daß dadurch eine Überfüllung des ersten Studienabschnitts mit Wissensstoff eintreten würde, wobei noch dazu in Ausrichtung auf die Zwischenprüfung intensiv gelernt werden müßte. Es ist fraglich, ob in einer solchen Situation Raum für die zugleich erstrebte Entwicklung eines „methodisch-wissenschaftlichen Arbeits- und Denkvermögens“ und der Fähigkeit, das Fach „in den Rahmen der Wissenschaften einzuordnen“ bleiben kann. (69)
Sicherlich ist es richtig, daß der Studienanfänger in der gegenwärtigen Situation seiner „akademischen Freiheit“ gar nicht gewachsen ist. Dem Studenten tritt die Universität zumeist als ein abstraktes „Angebot“ von Wissens-Stoff entgegen, in dem er zunächst planlos umherirrt, um sich dann bald eng an den Prüfungsordnungen auszurichten, d.h. aber vom planlosen Konsumieren in ein engstirnig reglementiertes „Pauken“ überzugehen. Gewiß ist das Postulat der herrschenden Universitätsideologie, der Student müsse schon im zweiten Semester verpflichtet sein, „selbst durch Irrtum zu forschen“ (70) heute größtenteils fiktiv geworden, da der zum ‚Stoff-Konsumenten‘ und ‚akademischen Fachschüler‘ gewordene Student vielfach gar nicht mehr in den Raum selbsttätigen Studierens und Forschens gelangt.
Dennoch sind gegen die erstrebte Aufteilung des Studiums in zwei so gegensätzlich strukturierte Abschnitte ernste Einwendungen zu machen:
Die Zusammendrängung eines fachschulartigen Lernbetriebs in den ersten zwei Jahren würde die Einstellung des Studenten zum Charakter seines Studiums so intensiv formen, daß er sich im zweiten Abschnitt nur schwer von der eingeübten Arbeitsweise lösen könnte, zumal er dann schon wieder mit dem Blick auf das drohende Abschlußexamen sein Studium von selbst reglementieren würde.
Die Ausrichtung des ersten Studienabschnittes auf eine umfangreiche Zwischenprüfung und die notwendige Bewältigung eines weitgespannten Wissens-Stoffes erschwert die freie Wahl oder einen Wechsel des Faches in den ersten Semestern. Außerdem kommt der Student kaum mit dem eigentlichen Kern der gewählten Fachwissenschaften in Berührung, sondern fast ausschließlich mit ihrem Stoff und im günstigsten Fall mit den äußeren Formen wissenschaftlich-methodischen Vorgehens.
Die Vorbereitung des Studenten auf den sinnvollen Gebrauch seiner akademischen Freiheit kann nicht dadurch erreicht werden, daß er angehalten wird, in der ersten Studienhälfte fast ganz auf sie zu verzichten, sondern zu diesem Zweck muß vor allem eine Anderung des augenblicklichen Studienbetriebs energischer in Angriff genommen werden (Vgl. dazu die in Kapitel II entwickelten Formen der Studienselbsthilfe.)
Ohne die Wichtigkeit des intensiven Lernens und Übens besonders in den ersten Semestern gering einzuschätzen, muß doch an dem Nebeneinander, dem ständigen Wechsel zwischen mehr schulartiger Übung und Stofferarbeitung einerseits und der kritisch-selbständigen wissenschaftlichen Denkweise auf der anderen Seite festgehalten werden.
Die lernende Erarbeitung von Lehrstoffen und Techniken muß im Bewußtsein des Studenten auf eine wissenschaftliche Problematik des Faches bezogen sein. Daher ist die gleichzeitige Aneignung von Wissens-Stoff zahlreicher Neben- und Hilfsfächer anzulehnen (Nach den VDS-Vorschlägen soll z.B. ein Student der Wirtschaftswissenschaft im Grundstudium gleichzeitig sich die Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Soziologie, Sozialpsychologie, Rechtswissenschaft, Statistik, Logik, Mathematik und Methodenlehre aneignen). Stattdessen ist in den ersten Semestern ein stufenweises Eindringen in den Stoff die wissenschaftliche Probestellung und Methodologie einiger weniger Fachgebiete anzustreben.
Aufgrund der Überlegungen über Begriff, Ziele und Schwerpunkte des Studiums wird der folgende Studienaufbau empfohlen:
I.5.1 Einführung in das Studium:
Im ersten Studienabschnitt sollen die Studenten vor allem in die von Schulunterricht sich abhebende Form des wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens eingeführt werden. Sie Sollen bewußt noch nicht an eine Fülle von Stoff und Spezialgebieten herangelassen werden, da man befürchten muß, sie würden sich in der bloßen Aufnahme von Wissen verlieren.
Im Mittelpunkt des ersten Studienabschnitts steht daher die beispielhafte Einführung in Methodik und wissenschaftliches Problematik einer Fachrichtung am Stoff einiger weniger Fachgebiete.
Der Student soll von Anfang an in die Spannung zwischen intensivem Lernen von Wissens Stoff und dem kritischen Durchdenken einer wissenschaftlichen Problematik hineingestellt werden. Dadurch wird er besser darauf vorbereitet sich im weiteren Verlauf seines Studiums selbständig gleichzeitig in den Stoff und in die Problemstellung und Theorie weiterer Fachgebiete oder anderer Disziplinen einzuarbeiten. Die intensive Erarbeitung zahlreicher Wissensgebiete sollte erst nach dem ersten Studienabschnitts beginnen.
Die Spezialfächer, die der Student in den ersten Semestern möglichst frei wählen soll (abgesehen von den Naturwissenschaften, in denen das nur begrenzt möglich ist) sollen erstens nicht zu eng miteinander verknüpft sein (z.B. Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch bei Germanisten oder Politische und Rechtssoziologie bei Soziologen) sondern auch Einblick in verschiedene Fachrichtungen erlauben (z.B. ein sprachwissenschaftliches und ein historisches Fachgebiet in der Philosophischen Fakultät, und dürfen zweitens nicht zu eng begrenzt oder bloße Hilfswissenschaften im Rahmen einer Fachrichtung sein.
Am Beispiel des Stoffs und der Methodik der gewählten Fachgebiete sollen vor allem folgende Aufgaben der Studieneinführung erfüllt werden:
1) Allgemeine Einführung in die wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise: Es soll vor allem die Kunst des kritisch-wissenschaftlichen Gesprächs, der Diskussion und des selbständig vorbereiteten freien Vortrags gelehrt und geübt werden. (Die Methodik der Diskussion und Interpretation wird naturgemäß mehr in den Geistes- und Sozialwissenschaften im Vordergrund stehen, aber in allen Fächern ist die Fähigkeit zum freien Vortrag zu üben.) Zentrum dieser Einübung in die wissenschaftliche Arbeitsweise ist das Proseminar, geleitet von jüngeren Dozenten und Assistenten als Tutoren.
2) Feststellung der Schwerpunkte in der Begabung und den Fähigkeiten der Studenten, um ihnen die Wahl bestimmter Fächer oder einen Wechsel des Studienfachs noch im ersten Studienabschnitt empfehlen zu können. Dazu ist eine intensivere individuelle Studienberatung durch wissenschaftliche Assistenten und Dozenten mit Tutorenfunktion erforderlich.
3) Erlernung der Benutzung des fachwissenschaftlichen ‚Handwerkszeugs‘(Nachschlagewerke, Bibliographien, systematische Handbücher in den Geisteswissenschaften, technische Einrichtungen und Apparate in den Naturwissenschaften) durch kleine Tutoriengruppen (mit studentischen Tutoren) und in besonderen Kursen oder Praktika.
Zur stärkeren Intensivierung des Studiums bereits in den ersten Semestern ist allgemein der Unterricht und die Arbeit in kleinen Gruppen und eine ständige Studienberatung anzustreben und beim personellen und sachlichen Ausbau der Hochschulen zu berücksichtigen. (Vgl. Kapitel IV, Der Lehrkörper der Hochschule)
Als notwendige ergänzende Aufgaben neben der eigentlichen wissenschaftlichen Studieneinführung sind anzusehen:
1) Parallel zur Studieneinführung muß in vielen Fachrichtungen bereits im ersten Studienabschnitt die systematische Einarbeitung in das grundlegende Fachwissen in größerem Umfang einsetzen, besonders in den Naturwissenschaften. Dazu ist ein Stufenbau von von auf einander aufbauenden Lern-Kursen und Übungen erforderlich, die jedoch auch nach dem ersten Studienabschnitt weiterhin absolviert werden müssen und nicht in der Form eines ‚Grundstudiums‘ vorgeschaltet werden können. In den Geisteswissenschaften geht das selbständig-kritische Studieren in Seminaren und Arbeitsgruppen ständig einher mit der Erarbeitung neuer Stoffgebiete (z.B. bestimmter Sprachstufen, deren Kenntnis nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt des Studiums gefordert wird). In den Naturwissenschaften dagegen ist eine geordnetere Studienfolge der zu lernenden Stoffgebiete erforderlich.
2) Verbesserung der Sprachkenntnisse der Studenten in allen Fakultäten (nicht nur in philologischen Fächern) durch Kurse und Konversationsgruppen, die die Einarbeitung in fremdsprachige wissenschaftliche Fachliteratur erleichtern sollen. Zur Erlernung von neuen Sprachen, die z.T. in der Schule nicht gelehrt werden, sollten Kurse in Sprachinstituten eingerichtet werden, die mit der Hochschule in Verbindung stehen.
I.5.2 Zwischenprüfungen
Nach der Einführung in das Studium in den ersten Semestern sollte in allen Fakultäten eine Eignungsfeststellung in der Form einer akademischen Zwischenprüfung stattfinden.
I.5.2.1 Zur Begründung:
1) Durch Einführung der Zwischenprüfung soll dem Studenten eine sinnvolle und intensivere Studiengestaltung schon in den ersten Semestern nahegelegt werden, ohne dabei die akademische Freiheit des Studiums zu verletzen. Denn die freie Wahl des Lehrers, der Fachgebiete der Prüfung innerhalb einer Studienrichtung und des Zeitpunkts der Prüfung muß gewährt werden.
2) Die Einführung eines allgemeinen einheitlichen Systems vom Zwischenprüfungen zur Eignungsfeststellung in allen Universitäten hätte den Vorteil der Objektivierung der Maßstäbe der Eignungsfeststellung und der Vereinheitlichung der z. Zt. sehr unterschiedlichen Prüfungsmethoden. Die Vielzahl der gegenwärtigen Prüfungen - Hauptseminaraufnahme, Proseminarabschluß, - Hilfswissenschaftliche, Honnef, - und andere Förderungsprüfungen - können ersetzt werden durch eine einzige Zwischenprüfung. Dadurch würden die Fakultäten und verantwortlichen Professoren veranlaßt, theoretisch fundierte und realistische Kriterien der Eignung aufzustellen, deren Rahmen etwa durch die Fakultätentage und die WRK einheitlich festgelegt werden müßten. Allgemeingültige Prüfungen, die nicht lokal begrenzt sind und nicht von einzelnen Fachprofessoren willkürlich erweitert und in ihren Zielen verfälscht werden dürfen, erleichtern die Freizügigkeit der Studenten, den Wechsel des Studienortes.
3) Die Studienförderung bedürftiger Studenten ist gegenwärtig und auf absehbare Zeit an Prüfungen gebunden, die für Studenten aus anderen sozialen Schichten entfallen. Eine Eignungsfeststellung, die sich auf die Ausscheidung nur der bedürftigen Ungeeigneten beschränkt, ist jedoch sozial ungerecht. Als Folge der Einführung allgemeiner akademischer Zwischenprüfungen könnte zugleich diese Ungerechtigkeit beseitigt werden.
Die Zwischenprüfung (Eignungsprüfung) kann frühestens nach dem zweiten, spätestens nach dem vierten Semester abgelegt werden. Es soll die Fähigkeit des Studenten zum kritisch-selbständigen wissenschaftlichen Denken und seine grundsätzliche Eignung zum Studium eines größeren Faches oder einer Gruppe von verwandten Fachgebieten geprüft werden.
Für folgende Fachrichtungen oder Studienrichtungen müßten z.B. jeweils eine derartige akademische Zwischenprüfung eingeführt werden:
Geschichtswissenschaften, Sprach- und Literaturwissenschaften, Psychologie, Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Jura, Technische Fachrichtungen, Medizin (z.T. bestehende Vor- oder Zwischenexamina haben einen anderen Charakter). Damit würde es z.B. für die verschiedenen philologischen Fächer, von denen zumeist mehrere parallel studiert werden, nur e i n e Prüfung an Hand von zwei begrenzten frei gewählten Fachgebieten aus der sprachlichen und der literaturgeschichtlichen Abteilung eines Fachs geben, in der die grundsätzliche Eignung zum Studium philologischer Fächer geprüft werden soll. (In den meisten kleinen Fachrichtungen, wie z.B. Sinologie, wird sich eine förmliche Prüfung wegen der intensiven Studiengestaltung und des engen Kontakts zu den Dozenten erübrigen; sie wäre hier nur erforderlich, falls die Dozenten einen Studenten für absolut ungeeignet halten.
Die Schwerpunkte in den Kriterien der Prüfung sind allerdings von Fach zu Fach verschieden:
Zur Feststellung der Eignung gehört besonders in den naturwissenschaftlichen und technischen Fachrichtungen auch die Prüfung der Fähigkeit, sich in planvoll-methodischer Weise das grundlegende Fachwissen anzueignen. Daher hat die Zwischenprüfung in einigen Fachgebieten auch den Charakter einer begrenzten, exemplarischen Wissens-Prüfung. Das Abfragen von Wissen muß in allen Fächern jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Besonders in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern ist die Wissensprüfung keine geeignete Methode der Eignungsfeststellung.
Als negative Abgrenzung der Funktion von Zwischenprüfungen muß festgestellt werden: Sie dürfen nicht Instrument kurzsichtiger Seminarplanung sein. Unter dem Vorwand, sie könnten wissenschaftliche Hauptseminare von noch nicht qualifizierten Teilnehmern freihalten, werden die Prüfungen in dem gegenwärtigen Stadium permanenter Überfüllung der Hochschulen und des Mangels an Lehrkräften dazu benutzt, durch sinnloses Abfragen von Wissen die meisten Studenten auf Jahre hinaus von den eigentlichen Seminaren fernzuhalten. Um nicht durch studienfremde reine Wissensprüfungen den Charakter des Studiums der sich größtenteils selbst überlassenen Studenten völlig zu verzerren, sollten bei äußersten Notlagen wegen der Überfüllung eher Voranmeldungen für spätere Semester oder eine Auslosung der Seminarplätze eingeführt werden.
In dem Maße, in dem schon im ersten Studienabschnitt eine theoretische Vertiefung zur Orientierung über die Methodologie des Faches und seine Einordnung in den Gesamtzusammenhang der Wissenschaften erfolgen kann, sollte auch dieser Aspekt in der Prüfung besonders in den Vordergrund treten. Eine philosophische Einübung in eine Fachwissenschaft gehört an den Anfang des Studiums. „Am Ende käme sie längstmöglich zu spät. Das Philosophische gehöre eher ins letzte, statt ins erste Semester - diesem Vorurteil liegt selbst eigenes mangelhaftes Philosophieren zugrunde. “ (71)
I.5.2.2 Zur Durchführung der Zwischenprüfung ist zu empfehlen:
- Voraussetzung der Zulassung zur Prüfung ist nur der Nachweis des erfolgreichen Besuchs einer Mindestzahl von Proseminaren und Übungen, deren Thematik in den Geisteswissenschaften kaum - in den Naturwissenschaften dagegen stärker festgelegt werden müßte.
- Die Prüfung soll mündlich, unter Heranziehung einer vorliegenden, nicht zu umfangreichen schriftlichen Hausarbeit durchgeführt werden (es soll sich nicht um ein schriftliches Seminarreferat handeln), an deren Entstehung ein Assistent oder ein älterer Student als Tutor beratend mitgewirkt haben.
- Es soll ein Prüfungsgespräch mit einer Kommission aus zwei bis drei Dozenten und Assistenten und einem studentischen Tutor stattfinden. Da es sich um eine grundsätzliche Eignungsprüfung handelt, sollte auch ein von der Studentenvertretung benannter älterer Student (studentischer Tutor) zum Prüfungsteam gehören und den Kandidaten befragen können. (Eine solche Regelung hat sich in einigen Hochschulen, z.B. an der Freien Universität Berlin, bei den Honnef-Fachprüfungen bereits bewährt.)
- Wird trotz Wiederholung nach ein oder zwei Semestern die Prüfung nicht bestanden, muß der Student das Studienfach wechseln und in einer anderen Fachrichtung sich auf die Zwischenprüfung vorbereiten oder er wird die Hochschule verlassen müssen.
Dadurch könnte eine notwendige begrenzte Auslese durch den Ausschluß absolut Ungeeigneter vom Studium erreicht werden. Nach einer bestimmten Anzahl von Jahren ist jedoch ein erneuter Versuch der Ablegung der Prüfung zu gestatten.
Da die Zwischenprüfung lediglich der Eignungsfeststellung dient, ist sie eindeutig von den Leistungsprüfungen (in der Form von Klausuren oder auch mündlichen Prüfungen) zu trennen, die zum Abschluß einzelner Kurse, Lehrgänge, Praktika eingeführt sind und der notwendigen Selbstkontrolle der Studenten über ihre Leistungen bei der Erarbeitung grundlegender Fachkenntnisse und Techniken dienen. Diese Leistungsprüfungen können nicht, etwa in der Art einer ausgedehnten ‚Mammutprüfung‘ mit der Eignungsfeststellung zusammengezogen werden, erstens weil die Eignungsfeststellung möglichst früh erfolgen und nicht von den Studenten wegen der hohen Anforderungen einer ‚Universal-Zwischenprüfung‘ immer weiteraufgeschoben werden soll, und zweitens weil das mit Sicherheit die völlige ‚Verschulung‘ mindestens der ersten Studienhälfte bedeuten würde. (Vgl. oben, S. 52/53)
Die Zwischenprüfung als bloße Eignungsfeststellung hat auch nichts gemein mit den in einigen Fächern eingeführten Zwischen- oder Vorexamina (z.B. Vordiplomprüfungen), die den Anschluß einer Stufe des Studiums, von ganzen Studienfächern darstellen, deren Kenntnis Voraussetzung eines weiteren Studiums ist (z.B. im Verlauf des Medizinstudiums, in den technischen Fächern). Solche Zwischenexamina finden wegen der größeren Anforderungen einige Semester später als die Eignungsprüfungen statt. Für die Geistes- und Sozialwissenschaften und für einen Teil der Naturwissenschaften kommet als Zwischenprüfungen nur Eignungsprüfungen in Frage, da sich hier keine Gliederung des Studiums in Stufen von Fachgebieten durchführen läßt.
I.5.3 Das Hauptstudium
Nach der mit einer Zwischenprüfung abgeschlossenen Studieneinführung von zwei bis vier Semestern, je nach Fleiß oder Begabung der einzelnen Studenten, muß in dem eigentlichen Hauptstudium eine stärkere Differenzierung des Studienweges nach den unterschiedlichen Begabungen und Studienzielen der Studenten erreicht werden. Ein Ansatz ist schon dadurch gegeben, daß begabtere oder intensiver studierende Studenten schon ein Jahr eher in die Seminare und wissenschaftlichen Übungen des Hauptstudiums gelangen können als andere.
Die Differenzierung der Studienwege muß allein durch verschiedene Formen und Arten von Abschlußprüfungen erreicht werden und nicht durch eine institutionelle Trennung, etwa (innerhalb der einzelnen Fächer) in einen Lehrgang nur für Studenten, die Berufsvorbildung betreiben und einen für die eigentlich wissenschaftlichen Studierenden, mit getrennten Seminaren oder sogar verschiedenen Kategorien von Lehrkräften (‚eigentliche‘ Professoren, d.h. Lehrstuhlinhaber, und bloße „Studienprofessoren“, „Studienräte im Hochschuldienst“ Vgl. Kapitel N, Der Lehrkörper der Hochschule). Auch die institutionelle Gliederung bzw. Zweiteilung des Hauptstudiums in eine kürzere ‚Unterstufe‘ geringeren Niveaus und eine darauf aufbauende ‚Oberstufe‘ des eigentlichen wissenschaftlichen Studiums ist abzulehnen. Es können kaum präzise Kriterien für die Unterscheidung in ‚Berufsausbildung‘ und ‚echtes‘ wissenschaftliches Studium aufgestellt werden. Auch würden durch eine so formale Gliederung der Studentenschaft in zwei Kategorien unnötige Spannungen und Konflikte innerhalb der Universität herbeigeführt. Ferner wäre die gesellschaftliche Funktion dieser Zweiteilung die Verstärkung der Tendenz zur Herausstellung einer akademischen sozialen Führungselite und zur Verfestigung der bestehenden Bildungshierarchie.
Über den Aufbau des Hauptstudiums lassen sich nur wenig generelle Aussagen machen die für alle oder die meisten Fakultäten Gültigkeit hätten:
1) In seinem Verlauf muß eine schrittweise Erweiterung des Studiums auf mehrere Fachgebiete des gewählten Hauptfaches und auf Nebenfächer erfolgen, möglichst bis zum gleichzeitigen Studium der Grundlagen solcher Fächer, die nicht theoretisch-methodisch mit dem Hauptfach verwandt sind.
Dadurch soll der Student erstens einen Einblick in Wissenschaften mit einem andersartigen theoretisch-methodologischen Fundament erhalten und zweitem soll stärker als gegenwärtig das Studium von Grenzgebieten traditioneller Fachrichtungen, durch ein Studium mit neuen und interessanten Fächerkombinationen gefördert werden (etwa: Soziologie und Architektur, Medizin und Sozialpsychologie, Afrikanistik und Landwirtschaft)
2) Gleichlaufend zur Erweiterung des Studiums auf andere Fachgebiete und Fächer muß besonders gegen Ende des Studiums eine Spezialisierung, die versteifte, intensive wissenschaftliche Arbeit an einem begrenzten Objekt erfolgen. Eine solche Konzentrierung sollte den Studenten durch verschiedene Formen des studium exemplare nahegelegt werden, in denen die verschiedenen Aspekte oder Ansätze dieses Studienprinzips zum Ausdruck kommen:
Das exemplarisch vertiefte Fachstudium zur stärkeren Heranführung des Studenten an die Praxis der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit, durch Konzentration auf spezielle Studien- und Forschungsobjekte des Faches; das begrenzte ‚exemplarische studium generale vom Fach aus‘ - die einzig noch mögliche Form des studium generale; (denn die stärkere Annäherung an die Praxis der Wissenschaft und die Vertiefung des Studium am konkreten Objekt weist in vielen Fachgebieten notwendig über die Grenzen des Faches hinaus zur Anwendung von Erkenntnissen und Methoden mehrerer Fächer auf den Gegenstand der Erkenntnis bzw. des Studiums die Hinwendung zum Studium gesellschaftlich besonders relevanter Forschungs- und Studiengebiete, zu deren Bearbeitung und Durchleuchtung ebenfalls Ergebnisse und Methoden mehrerer Fächer nutzbar gemacht werden müssen.
Damit wird die schrittweise Erweiterung des Studiums bis zum Einblick in Fächer mit völlig anderer Methodik und theoretischen Grundlage zu einer Grundbedingung der Spezialisierung und Konzentrierung auf solche begrenzte Studienobjekte, die nur unter kritischer Reflexion über das Spezialfach hinaus und in der Anwendung von Erkenntnissen verschiedener Fächer überhaupt in ihrer Totalität erfaßt werden können.
Die Institutionalisierung des ‚studium exemplare‘ in der Form der Erfassung der Totalität des konkreten Objekts über das Spezialfach hinaus verweist auf die Notwendigkeit einer Änderung im organisatorischen Aufbau der Hochschule (Vgl. Kapitel II, Die Hochschule und ihre Arbeitsformen) Als Beispiel exemplarischer Studien, die zugleich den Ansatz zu einem studium generale vom Fach aus darstellen, ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, regelmäßig wechselnde länderkundliche studium exemplare - Programme besonders für Studenten der geistes - und sozialwissenschaftlichen Fächer einzurichten, in denen jeweils die jüngste Geschichte und die gegenwärtige Gesamtverfassung eines fremden Landes (besonders auch von Entwicklungsländern) für zwei bis drei Semester im Mittelpunkt zahlreicher Lehrveranstaltungen von allen daran beteiligten Fachinstituten und Professoren stünde. Zur Beteiligung könnten die Institute oder einzelnen Dozenten der folgenden Fächer herangezogen werden: die betreffende sprach- und literaturwissenschaftliche Disziplin, Geschichte, Politische Wissenschaft, Soziologie, Geographie, Weltwirtschaftslehre, Kunstgeschichte, Publizistik. Ein derartiges länderkundliches Studienprogramm hätte besonders für die Ausbildung der künftigen Lehrer große Bedeutung.
Andere Objekte eines fachlichen oder überfachlichen studium exemplare ergeben sich aus der Notwendigkeit, bestimmte gesellschaftliche Probleme und Planungsaufgaben intensiver zu bearbeiten (z.B. die Problematik moderner Stadtplanung in Verbindung mit Städtebau, Gemeindesoziologie, oder spezielle Bereiche der Betriebssoziologie).
In vielen Fächern könnte zwischen Grund- und Hauptstudium oder innerhalb des Hauptstudiums das Studium für ein Semester unterbrochen werden, um Gelegenheit zur Durchführung von wissenschaftsbezogenen Praktika oder Berufspraktika zur Berufsfindung und Berufsvorbereitung zu geben. Durch ein Praktikum nach der Zwischenprüfung wäre dem Studenten die Möglichkeit gegeben, noch vor Aufnahme des Hauptstudiums seine berufliche Eignung zu testen. Auch bei einen evtl. davon bestimmten Fachwechsel würde ein so angelegtes einführendes Grundstudium seinen Wert behalten. Es könnte auf die erforderlicher verkürzte Einführung in das neugewählte Fach je nach der Verwandtschaft der Fachrichtungen angerechnet werden.
I.5.4 Abschlußprüfungen:
Durch den Charakter der verschiedenen Arten von Abschlußprüfungen wird die Zielrichtung und Gestaltung des Hauptstudiums entscheidend bestimmt, und zwar aufgrund der freien Entscheidung der Studenten, die sich für dieses oder jenes Abschlußexamen im Laufe ihres Studiums entschließen.
Es sollten im allgemeinen in jeder Fachrichtung oder Fakultät drei Formen des Studienabschlusses möglich sein:
- durch Prüfungen, deren Charakter zwar von der Universität bestimmt und in der Durchführung von ihr abhängig wären, die aber doch auf einen begrenzten Bereich der Praxis, auf ganz bestimmte Berufswege ausgerichtet wären, allerdings unter Anlegung wissenschaftlicher Maßstäbe an die Probleme der Berufspraxis; (gegenwärtig z.B. bestimmte Dlplomprüfungen und die Staatsprüfungen)
- durch Prüfungen, die zwar ebenfalls an der Qualifikation für die Berufspraxis orientiert sein sollten, aber für einen weiteren, nicht genau zu begrenzenden Bereich und zugleich auf Grund eines vertieften wissenschaftlichen Studiums abzulegen sind, und die daher eine möglichst freie und individuelle Fächerkombination auch über Fakultätsgrenzen hinweg zulassen (gegenwärtig z.B. die in einigen Philosophischen Fakultäten wieder eingeführte Magisterprüfung, die als Modell für ähnliche Prüfungen in den anderen Fakultäten dienen könnte). Bei der Vorbereitung dieser Prüfungen sollte das Prinzip des überfachlichen studium exemplare besonders betont werden;
- durch die Promotion, deren zunehmende Entwertung durch die, Schaffung von neuen nicht eng auf eine bestimmte Berufspraxis bezogenen Prüfungen in der Art der Magisterprüfung eingeschränkt werden könnte.
Auch künftig muß jedoch für die Studenten die Promotion auch als einziger Studienabschluß, ohne Verpflichtung zur vorherigen Ablegung einer anderen Abschlußprüfung, ermöglicht werden, weil trotz allen Entartungen nur die Promotion eine effektive Förderung wissenschaftlicher Begabungen und Leistungen erlaubt.
Bei allen Prüfungen ist der Fähigkeit, Kenntnisse in Zusammenhänge einzuordnen und sie anzuwenden, eine größere Bedeutung beizumessen als dem reinen Tatsachenwissen. Da lange Diplom- oder Staatsexamensarbeiten kaum einen Beitrag zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen leisten, sollten an ihrer Stelle kürzere schriftliche Arbeiten verlangt werden, die innerhalb eines Semesters anzufertigen wären und vor allem die Beherrschung der wissenschaftlichen Methoden und des wissenschaftlichen Handwerkzeugs unter Beweis stellen sollen.
(Über die Problematik der akademischen und staatlichen Prüfungen im Verhältnis zur Hochschulautonomie vgl. Kapitel VII, Hochschule und Staat).
II. Die Hochschule und ihre Arbeitsformen
Aus den ausführlichen Überlegungen über den Charakter der wissenschaftlichen Arbeit in der Hochschule und über die Ziele und Schwerpunkte des Studiums ergeben sich eine Reihe von praktischen Konsequenzen für die organisatorische Gestaltung der Hochschule und ihrer Arbeitsformen, die von der Problematik der Gesamtuniversität, ihrer Größe und Gliederung, bis zu den einzelnen Organisationsformen der Forschung und Lehre und des Studiums reichen.
Erst nach Analyse und Kritik der allgemeinen sozialen ‚Arbeitsverhältnisse‘ in der Hochschule, unter denen die Arbeitsformen stehen, ist es möglich, sie im Gesamtzusammenhang der Verfassung und Verwaltung der Hochschule und der sozialen Verhältnisse der Hochschullehrer und Studenten zu betrachten. (Vgl. Kapitel III bis VI). Zunächst sollen daher die praktischen Konsequenzen für die Organisation der Hochschule, die sich aus der Sache selbst ergeben, aus der Art und Weise, wie in der Universität wissenschaftliche Arbeit und Studium betrieben werden, gezogen werden, um dann zu prüfen, welche gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Realisierung im Raum der gegenwärtigen Hochschule entgegenstehen und wie diese Arbeitsformen im Prozeß einer realen Hochschulverfassungsreform durchgesetzt werden können (bzw. wiederbelebt werden können).
II.1 Die Gesamt-Universität
Es sollte unbedingt an dem Prinzip festgehalten werden, möglichst alle wissenschaftlichen Disziplinen in einer Voll-Universität zusammenzufassen - nicht aus einer abstrakten Idee der ‚Universalität‘, der spekulativen Schau der ‚Ganzheit‘ der Wissenschaften, der heute keine Realität in der wissenschaftlichen Praxis mehr entspricht, sondern weil gerade eine extreme Spezialisierung in der fachwissenschaftlichen Arbeit an einem konkreten Objekt in vielen Fällen an Probleme gelangt, die nur durch Einschaltung von anderen Fachrichtungen zu verstehen und zu bearbeiten sind. Nicht aus der Idee der Universität als Repräsentanz des philosophisch reflektierten Gesamtwissens, sondern aus dem praktischen Vollzug der wissenschaftlichen Arbeit ist die Erhaltung der vollständigen Universität gerechtfertigt.
In der Forschung und auch in der wissenschaftlichen Ausbildung der Studenten und des wissenschaftlichen Nachwuchses hat sich die steigende Bedeutung von Grenzgebieten zwischen den Forschungs - und Lehrbereichen der traditionellen Disziplinen erwiesen. Es entstehen laufend neue ‚Kombinationsfächer‘ aus der Vereinigung oder praktischen Zusammenarbeit von Fachgebieten verschiedener Disziplinen und Fakultäten, deren praktische Bedeutung in der Universität nur durch die Starrheit der alten Fakultätsgrenzen und der. Trennung des Hochschulwesens in Universitäten, Technischen und Pädagogischen Hochschulen verringert wird (z.B. Architektursoziologie, Arbeitsmedizin, Sozialhygiene, Medizinisch-Technologische Fachgebiete, Verkehrswissenschaft, Wirtschaftsingenieurstudium).
Die Gliederung der Universität in Fakultäten und Fächer muß möglichst offen und flexibel sein, um künftige neue „Arbeitsgemeinschaften“ oder Zusammenschlüsse verschiedener Fachgebiete zur Bearbeitung von Rand- und Grenzgebieten zu ermöglichen, die gegenwärtig noch gar nicht vorausgesehen werden können.
Schon aus diesem Grunde ist etwa die Auflösung der Universitäten in Medizinische Akademien, Naturwissenschaftliche Hochschulen, Philosophische Akademien, Wirtschaftsakademien etc. oder die Gründung von ‚Teil-Universitäten‘( z.B. ohne Medizinische Fakultät) abzulehnen.
Die Bewahrung der Einheit der Universität ist vor allem aus den folgenden praktischorganisatorischen Gründen zu fordern:
- Die Aufnahme der Zusammenarbeit zwischen Instituten verschiedener Fakultäten zur ständigen oder begrenzten gemeinsamen Erforschung bestimmter Bereiche oder zur Einführung eines neuen Ausbildungsweges (wie z.B. das Wirtschaftsingenieurstudium) ist eher und rationeller im Rahmen einer bestehenden Voll-Universität au organisieret als beim Bestehen von getrennten Hochschulen, in denen zu diesem Zweck ganz neue Einrichtungen errichtet werden müßten oder die Lösung solcher Aufgaben unterbleiben würde.
- Die Studenten haben dadurch eine größere Auswahlmöglichkeit für neue und individuelle Fächerkombinationen innerhalb ihres Studiums oder zum ergänzenden Studium bestimmter Grenzgebiete, deren Kenntnis in der Praxis verlangt aber wegen der starrer Ausbildungswege nicht ausreichend vermittelt wird.
- Einige Einrichtungen der Universität, wie Dokumentation- und Bibliothekszentren, der Apparat der Wirtschafts- und Personalverwaltung können gemeinsam benutzt werden.
II.1.1 Universitäten und Technische Hochschulen
Das bisher Gesagte gilt aber im gleichen Maße auch für die Ingenieurwissenschaften an den Technischen Hochschulen in ihrem Verhältnis zu den wissenschaftlichen Disziplinen der Universitäten.
Daher ist als Planziel beim Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen und im Zusammenhang mit der Planung von Neugründungen die Verschmelzung der Universitäten und Technischen Hochschulen durch Eingliederung einer Technischen Fakultät (mit mehreren großen Abteilungen) in die Universität und durch Erweiterung der Technischen Hochschulen zu Universitäten anzustreben.
Die Entwicklung der technischen Disziplinen und der wissenschaftlichen Ingenieurausbildung hat zu einer weitgehenden Annäherung der Technischen Hochschule an die Universitäten geführt:
Zwischen Disziplinen der Universitäten und von Technischen Hochschulen haben sich zahlreiche Grenzgebiete der Forschung ergeben, die gegenwärtig z.T. an Fakultäten der Universitäten oder an Technischen Hochschulen betrieben werden;
für die Ingenieurstudenten ist eine immer intensivere mathematisch-naturwissenschaftliche Grundausbildung erforderlich, deren Qualität durch ihre Eingliederung in die Universität noch gesteigert werden könnte;
auch interessierten Studenten der technischen Disziplinen sollte die Chance geboten werden, sich aus wissenschaftstheoretischen oder praktisch-politischen Interessen an sozialwissenschaftlichen Studienprogrammen innerhalb der Universität zu beteiligen (sobald dafür die praktischen Voraussetzungen geschaffen sind);
es werden künftig noch weitere spezielle Ausbildungswege in Grenzbereichen zwischen Technik und verschiedenen Fachwissenschaften eingerichtet werden müssen, um dem Bedarf in der Praxis nachzukommen (z.B. Medizinische Technik, Verkehrs- und Kommunalwissenschaft, Arbeitswissenschaft, Dokumentationstechnik).
Neben der notwendigen Errichtung von neuen Universitäten, und zwar von Anfang an mit Technischen Fakultäten, wie es der Wissenschaftsrat empfiehlt (72), sollte daher vorrangig der schrittweise Ausbau bestehender Technischer Hochschulen zu Voll-Universitäten erfolgen (vor allem in Hannover, München - als zweite Universität-, Aachen, Stuttgart)
Da in den Technischen Hochschulen bereits zahlreiche Lehrstühle für Natur-. Geistes- und Wirtschaftswissenschaften bestehen, die z.Zt. der ergänzenden Bildung der Ingenieurstudenten dienen, wären in ihnen Kristallisationspunkte zum Aufbau entsprechender vollständiger Fakultäten gegeben, die bei Gründung völlig neuer Universitäten z.T. recht schwierig zu finden sein dürften.
Die Studentenzahlen an den Technischen Hochschulen, die - abgesehen von Berlin und Aachen - meistens zwischen 5000 und 6000 Studenten liegen, sind noch nicht so hoch, als daß ihre Erweiterung zu Voll-Universitäten die Gesamtzahl wesentlich über die gegenwärtige Größe der meisten Universitäten ansteigen ließe, d.h. auf etwa 9000 bis 10 000. Der Ausbau der Technischen Hochschulen in Hannover, München, Aachen, Stuttgart könnte auch benachbarte große Universitäten entlasten.
Wo die materiellen und räumlichen Voraussetzungen bestehen, sollten aber auch einigen bestehenden Universitäten (vollständige) Technische Fakultäten angegliedert werden (z.B. vor allem in Nürnberg-Erlangen)
II.1.2 Neugründung Medizinischer Akademien nur als Notlösung
Es sollte geprüft werden, ob die vom Wissenschaftsrat empfohlene Gründung von sieben Medizinischen Akademien (73) nicht dadurch eingeschränkt werden könnte, daß neue Medizinische Fakultäten an bestehende Technische Hochschulen (mit ihren allgemeinwissenschaftlichen Abteilungen) angegliedert werden (evtl. in Hannover, Stuttgart, Karlsruhe). Da alle Technischen Hochschulen in Großstädten liegen, wäre wahrscheinlich eine wichtige Vorbedingung zur Einrichtung von Universitätskliniken gegeben. Bei gleichzeitigem Ausbau der geistes- und naturwissenschaftlichen Abteilungen der Technischen Hochschulen zu vollständigen Fakultäten wäre auch gute Voraussetzungen für die notwendige wissenschaftliche Ausbildung der Mediziner über ihr Fach hinaus gegeben, während bei Gründung isolierter Medizinischer Akademien in ihnen neue Lehrstühle errichtet werden müßten, oder wie es sogar der Wissenschaftsrat einplant, Einrichtungen benachbarter Universitäten zusätzlich beansprucht werden müßten, die aber im allgemeinen schon überlastet sind. Dagegen sind die natur- und geisteswissenschaftlichen Lehrstühle und Seminare an den Technischen Hochschulen nicht im gleichen Maße beansprucht bzw. überfüllt.
Die isolierte Gründung von Medizinischen Akademien (wie z.B. für Lübeck geplant) darf nur als eine vorübergehende Notstandsmaßnahme angesehen werden, weil der notwendige allgemeine Ausbau und die Gründung neuer Universitäten im letzten Jahrzehnt fahrlässig versäumt worden sind. Daher sollten Medizinische Akademien auf jeden Fall nur an solchen Orten errichtet werden, für die in späteren Jahren eine Universitätsgründung geplant ist oder jedenfalls möglich und sinnvoll erscheint.
II.1.3 Universität und Lehrerbildung
Auch die Entwicklung der Lehrerbildung in den Pädagogischen Hochschulen hat zu einer Annäherung an das Niveau und die Anforderungen eines Universitätsstudiums geführt, da die moderne Pädagogik und die komplizierte Problematik der Erziehung in der modernen Industriegesellschaft eine eindeutige Verwissenschaftlichung der Lehrerbildung in allen ihren Zweigen erfordert.
Das Studium aller künftigen Lehrkräfte muß auf echter wissenschaftlicher Grundlage durchgeführt werden, weil die Praxis der Erziehung und Bildung unter den gegenwärtigen Bedingungen ständig neue methodische und psychologische Probleme aufwirft, denen sich der Lehrer in selbständig-kritischer Weise und auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse stellen muß.
Da in der Lehrerbildung und in der Praxis der Schule ständig höhere Anforderungen an das wissenschaftlich-kritische Denken und die selbständige pädagogische Fortbildung aller Lehrer gestellt werden, ist es sachlich nicht gerechtfertigt, die Ausbildung der Lehrer für bestimmte Schulzweige weiterhin von der Universität getrennt in personell und materiell unzureichend ausgestatteten Pädagogischen Hochschulen durchzuführen, die z.T. in abgelegenen Orten ohne kulturelles Leben liegen.
Ist das wissenschaftliche Studium künftiger Studienräte besonders vom Stoff her zu rechtfertigen, so ist es für die Lehrer an den Grund- und Mittelschulen ebensosehr hinsichtlich der pädagogischen Methodik und der Orientierung über die sozialen psychologischen und biologischen Voraussetzungen des Erziehungsprozesses im Zusammenhang der Entwicklung des Kindes zu fordern. (Das schließt nicht aus, daß auch die pädagogische Ausbildung der Studienräte endlich auf ein wissenschaftliches Niveau gehoben wird). Der „Rahmenplan“ des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen sieht die Zusammenarbeit der drei traditionellen ‚Lehrer-Stände‘ - des Volkschullehrers, des Mittelschullehrers und des Studienrates - in einer vorgesehenen ‚Förderstufe‘ vor. Diese Zusammenarbeit, die sich auch in anderer Form als notwendig herausstellen wird, sollte zusätzlich gefördert werden durch die gemeinsame erziehungswissenschaftliche und pädagogische Ausbildung aller Lehrergruppen in der Universität.
Die weitere Rechtfertigung der Trennung der Ausbildungswege für Studienräte und für die übrigen Lehrer erfolgt nur noch aus sozialen Standesinteressen an der Konservierung einer überkommenen ‚Bildungshierarchie‘, die es nicht zuläßt, die Schulbildung von Kindern verschiedener sozialer Schichten durch einen einzigen ‚Lehrerstand‘ zu vollziehen.
Aus sachlichen wie sozialen Erfordernissen ist daher als Planziel beim Ausbau des Hochschulwesens die Vereinigung aller Pädagogischen Hochschulen mit den Universitäten zu fordern, an denen besondere Pädagogische Institute oder Seminare zu errichten sind, in denen sowohl erziehungswissenschaftliche Forschung und Lehre als auch die Vermittlung von Unterrichtsmethoden erfolgen soll.
Auch die fachliche Bildung der Volks- und Mittelschullehrer könnte, falls durch umfassenden Ausbau des Hochschulwesens die äußeren Voraussetzungen dafür geschaffen sind, an den Universitäten erfolgen. (Ein Anfang dazu ist bereits bei der Ausbildung dieser Lehrer in der Universität Hamburg gemacht).
Da in den Universitäten bereits Ausbildungswege konzentriert sind, die fast noch enger auf eine bestimmte Berufspraxis bezogen sind und z.T. eher den Charakter von bloßen pragmatischen ‚Kunstlehren‘ angenommen haben (z.B. Betriebswirtschaftslehre, Jura), in einer Form, die in der Lehrerbildung kaum je möglich sein dürfte, so ist der Einwand einer angeblich zu engen Verbindung von Lehrerbildung und Berufspraxis zumindest einseitig. Die meisten Ausbildungssysteme, die die Tendenz zu reinen Kunstlehren haben, müssen gerade deshalb an der Universität verbleiben, um ihre kritisch-wissenschaftliche Durchdringung zu ermöglichen.
II.1.4 Die Größe der Universität
Das Ziel der Erweiterung der Universität durch Aufnahme der Technischen und Pädagogischen Hochschulen führt notwendig zu der Frage nach der maximalen Größe der Universität.
Der Wissenschaftsrat betont, es gebe eine obere Grenze für die Größe einer Universität, weil es eine obere Grenze für die Anzahl der Mitglieder einer Fakultät (der Professoren) gebe. Bei Überschreiben dieser Grenze sei keine sinnvolle akademische Selbstverwaltung mehr möglich. Er kommt auf Grund von Berechnungen der Lehrstühle je Fakultät und der Bedingungen eines persönlichen Kontakts der Lehrstuhlinhaber in Fakultätssitzungen und bei Annahme eines normalen Zahlenverhältnisses von Studenten je Lehrstuhl in den einzelnen Fakultäten (Philosophische z.B. 35:1, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche und Juristische 100:1) zu der maximalen Richtzahl von 8000 Studenten in einer Universität.
Aus diesem Grunde fordert der Wissenschaftsrat die Gründung von mindestens drei neuen Universitäten und einer Technischen Hochschule zum Auffangen des von ihm auf 40000 geschätzten Zuwachses an Studenten (bis 1965).
Da aber diese Berechnung des Wissenschaftsrates nach allen anderen Schätzungen zu geringe Zahlen ansetzen (selbst das Bundesinnenministerium rechnet mit 60000), andererseits aber die Gründung neuer Hochschulen vom Bund und den Ländern nur sehr unvollständig und langsam vorangetrieben wird, so ist zu erwarten, daß selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, daß 1965 bereits vier neue Hochschulen existieren, damit nicht einmal der ganze Zuwachs der Studentenzahlen bewältigt wäre. Selbst bei Gründung einiger neuer Universitäten werden also im nächsten Jahrzehnt die Studentenzahlen der bestehenden Universitäten sogar weiter ansteigen, und zwar - bei Aufrechterhaltung der notwendigen Freizügigkeit - durchaus nicht gleichmäßig je Hochschule, sondern bei extremer Ausweitung besonders anziehender Universitäten (wie München).
Der Normalfall wird also auf keinen Fall die vom Wissenschaftsrat als normal (nicht als ideal) qualifizierte Universität mit 8000 Studenten sein, in der die bisherige Form der akademischen Selbstverwaltung durch die Fakultätskollegien allein noch sinnvoll funktionieren könnte, sondern die typische „Massenuniversität“ von 10-20000 Studenten.
Wollte man in diesen Massenuniversitäten wenigstens das normale Zahlenverhältnis von Studenten je Lehrstuhl aufrechterhalten bzw. wieder erreichen, so müßte eine Universität wie München, die nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 13000 Studenten und 278 Lehrstühle haben soll, gegenwärtig - bei einem Stand von rd. 20000 Studenten - 425 Lehrstühle haben: Soll das normale Zahlenverhältnis an einer Philosophischen Fakultät, von 1:35, erreicht werden, so müßten an einer großen Philosophischen Fakultät von 5000 Studenten rd. 140 Lehrstühle bestehen; hinzu kämen aber noch im Verhältnis von etwa einem Drittel Nichtordinarien, also ein Lehrkörper von bis zu 200 habilitierten Dozenten in einer Fakultät.
Da die wünschenswerte Begrenzung der Größe der Universitäten nicht zu erreichen sein Wird, zieht aber der Wissenschaftsrat daraus die Konsequenz, in den Massenfächern die erforderliche Zahlenrelation nicht einzuhalten, sondern bei der Planung des Lehrköpers je Fakultät „gewisse Höchstgrenzen“ (die undefiniert bleiben) nicht zu überschreiten, um nicht „die vorhandenen Selbstverwaltungseinrichtungen (zu) sprengen und den Zusammenhang der Gesamthochschule vollends (zu) zerstören.“
Nicht die wünschenswerte Zahlenrelation von Studenten je Professor, sondern die Aufrechterhaltung überkommener Selbstverwaltungseinheiten ist also im Zweifelsfalle der Maßstab für die Größe des Lehrkörpers. Auch aus diesem Grunde, nicht nur wegen der unzureichenden Neugründungen, wird also die notwendige Größe des Lehrkörpers in allen sog. Massenfächern eingestandenermaßen nicht erreicht, ja gar nicht erst angestrebt.
II.2 Neugliederung der Universität und ihrer Fakultät
Uns drängt sich dagegen eine andere Konsequenz auf, die der Wissenschaftsrat nur am Rande erwähnt, aber nicht zu ziehen bereit ist:
die Ergänzung der traditionellen Gliederung der Universität in Fakultäten als Selbstverwaltungseinheiten durch eine neue lockere Untergliederung der Fakultäten nach dem Vorbild des angelsächsischen department-Systems.
Die Universität benötigt einerseits eine Untergliederung zur Lösung und Koordinierung von Verwaltungsaufgaben, aber anderseits sind in ihr Institutionen notwendig, die dem wissenschaftlichen Gespräch der Dozenten, der Koordinierung von Forschung und Lehre sowie der Durchführung von Prüfungen aller Art dienen, und damit eher den Charakter von Arbeitsgemeinschaften als von Selbstverwaltungseinrichtungen haben.
Die wachsende Größe des Lehrkörpers und die z.T. extreme Differenzierung großer Fakultäten in zahlreiche Fächer, die den Kontakt mit anderen Fächern ihrer Fakultät kaum noch suchen, hat dazu geführt, daß die zuletzt genannten wissenschaftlich-organisatorischen Aufgaben von den Fakultäten nicht mehr sinnvoll wahrgenommen werden können. Abgesehen von den notwendigerweise noch geschlosseneren Juristischen und Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultäten ist die Gliederung in Fächer so weit vorangetrieben, daß viele Professoren sich weigern, über organisatorische und personelle Fragen eines anderen Faches ihrer Fakultät überhaupt ein Urteil abzugeben, geschweige denn eine Entscheidung zu treffen. Dennoch wird die Fiktion aufrechterhalten, die Fakultät in ihrer Gesamtheit urteile und entscheide z.B. über eine Habilitation oder eine Berufung oder über die Gestaltung der Lehrpläne der einzelnen Fächer.
Bei einer bestimmten Größe und Mitgliederzahl, die gegenwärtige in den meisten Fakultäten bereits überschritten ist, versagt eine Organisationsform wie die traditionelle Fakultät, die auf kollegialer Zusammenarbeit und persönlichem Kontakt aufgebaut sein soll.
Gerade zur Wiederherstellung des persönlichen Kontakts und der kollegialen Kooperation zwischen Universitätslehrern einer nicht zu eng begrenzten überschaubaren Fachrichtung ist daher eine Neugliederung der Universität in engere wissenschaftliche Arbeitseinheiten erforderlich. Dadurch entfällt ein wichtiges Hemmnis zur radikalen Erweiterung des Lehrkörpers, nämlich das Argument der drohenden Arbeitsunfähigkeit der akademischen Selbstverwaltungsorgane.
Da die übergroßen Fakultäten als kollegiale Organe aller Lehrstuhlinhaber nicht mehr arbeitsfähig sind, müssen wichtige Aufgaben nach unten, an neue, engere Selbstverwaltungs- und Arbeitseinheiten im Rahmen einer Faches oder einer Gruppe von verwandten Fachgebieten, abgetreten werden. Die traditionellen Fakultäten sind nur noch als Instanzen zur Koordinierung gemeinsamer Verwaltungsaufgaben der einzelnen Fachinstitute oder Abteilungen anzusehen. Sie sollten nicht mehr durch übergroße Kollegien von Ordinarien vertreten werden, sondern die Verwaltungsaufgaben einer Fakultät sind von repräsentativen Organen (wie im Falle des Akademischen Senats) aus Vertretern der Fachinstitute und -kollegien wahrzunehmen.
Die verschiedenen Fachrichtungen innerhalb einer Fakultät könnten je nach organisatorischer Zweckmäßigkeit in der Form fester größerer Fachinstitute oder als lockere Zusammenfassung mehrerer kleinerer Institute und Seminare zu Abteilungen der Fakultät etabliert werden. Die Fachinstitute oder ‚Fakultätsabteilungen‘ würden dann die grundlegenden Selbstverwaltungseinheiten der Universität bilden.
II.2.1 Organisation von Forschung und Lehre und die Struktur der Institute
Die vorgeschlagenen engeren akademischen Selbstverwaltungseinheiten, die zwischen den kleinen Spezialinstituten oder -seminaren und der weitläufigen Gesamt- Fakultät stehen, sind aber nicht nur notwendig, um eine funktionierende akademische Selbstverwaltung aufrechtzuerhalten, sondern sie ergeben sich auch aus eines direkt sachlichen Notwendigkeit in Forschung und Lehre selbst:
1) Soll durch die ständig steigende Spezialisierung der wissenschaftlichen Arbeit nicht die Erfassung und Bearbeitung eines konkreten Forschungsgegenstandes in seiner Ganzheit selbst im Rahmen einer allgemeinen Fachrichtung unmöglich gemacht werden, soll nicht den Sinn einer radikalen Spezialisierung im Funktionszusammenhang der Wissenschaften oder innerhalb einer einzelnen Disziplin verlorengehen, so ist eine der Spezialisierung parallellaufende Intensivierung der ständigen gegenseitigen Information, Diskussion und Kooperation von Wissenschaftlern verschiedener Fachgebiete mindestens im Rahmen einer größeren, sinnvoll zusammengefaßten Fachrichtung erforderlich. (Unter Fachrichtung wird in diesem Zusammenhang eine der traditionell eingeführten Disziplinen wie z.B. Physik, Biologie, Geschichtswissenschaft, Romanistik, Nationalökonomie verstanden, unter Fachgebiet eine ihrer Untergliederungen, wie sie z.B. in den Aufgabenbereichen der Lehrstühle zum Ausdruck kommen.)
Die ständige gegenseitige Unterrichtung und praktische Zusammenarbeit von Fall zu Fall darf sich jedoch nicht auf Fachzeitschriften, wissenschaftliche Kongresse und Gastvorträge beschränken, sondern muß innerhalb der Universität wieder in einer neuen Form institutionalisiert werden.
Den organisatorischen Rahmen dafür bietet weder die traditionelle Fakultät noch das gegenwärtig vorherrschende kleine ‚Lehrstuhl-Institut‘ eines einzelnen Ordinarius und Institutsdirektors mit einem Stab abhängiger wissenschaftlicher Mitarbeiter und Hilfskräfte.
Im Interesse einer intensiveren Kommunikation und Kooperation der wissenschaftlichen Lehrer und Mitarbeiter eines Faches ist in allen Fachrichtungen die Bildung größerer kollegial geleiteter Institute mit mehreren, z.T. ständigen, z.T. wechselnden Institutsabteilungen anzustreben, in deren Rahmen die einzelnen Fachgebiete und ihnen entsprechende Lehrstühle einer ganzen Disziplin organisatorisch zusammengefaßt sind.
Wo die Bildung gemeinsamer Institute nicht zustandekommt oder wo sie aus sachlichen oder technischen Gründen nicht durchführbar ist, sollten der notwendige Kontakt und die Kooperation in der Forschung durch Arbeitsgemeinschaften der verschiedenen Institute und der Dozenten eines Faches oder durch Einrichtung einer zusammenfassenden Fakultätsabteilung und eines gemeinsamen Fach-Kollegiums erleichtert werden.
2) Für die Größe und Gliederung der Institute muß aber auch die möglichst zweckmäßige und durch die spätere Funktion der Studenten im Berufsleben mitbestimmte Organisation der Ausbildungals Maßstab herangezogen werden: Es ist nicht möglich, die Studenten in dem Maße spezialisiert auszubilden, wie es dem Aufgabenkreis eines kleinen Instituts für ein Fachgebiet entspricht, da die Studenten erstens nur für eine begrenzte Zeit an der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts teilnehmen können und außerdem durch eine so intensive Spezialisierung nicht umfassend genug für die Berufspraxis qualifiziert wären.
Zur Gewährleistung einer sinnvollen Ausbildung der Studenten, denen ein Überblick über mehrere verwandte oder sinnvoll kombinierte Spezialgebiete vermittelt werden muß, ist daher ebenfalls die Bewahrung des Zusammenhangs zwischen mehreren Fachgebieten einer größeren Fachrichtung in einem gemeinsamen Institut oder einem Kollegium bzw. in lockeren Arbeitsgemeinschaften zu fordern.
Derartige Fach-Gremien müßten sich vor allem systematisch mit der Planung und Koordinierung der Lehrpläne einer Fachrichtung und mit der Organisation gemeinsamer Studienprogramme beschäftigen.
Die Zusammenarbeit bzw. der engere Kontakt mehrerer Universitätslehrer im Rahmen eines größeren Instituts oder Kollegiums erleichtert auch die Veranstaltung von kollegialen Seminaren und Colloquien mehrerer Dozenten, die zur Belebung der wissenschaftlichen Diskussion als Anregung zum kritischen Denken für die Studenten erforderlich ist.
II.2.2 Institute jenseits der Fachgrenzen
Die Tendenz zu weiterer Spezialisierung bei gleichzeitiger verstärkter Kommunikation muß beim Studium oder bei der Erforschung bestimmter Objekte zwangsläufig auch den Rahmen einer Fachrichtung sprengen - wenn es der Charakter des Objekts erfordert.
Angesichts des unaufhebbaren und sich ständig steigernden Prozesses der Spezialisierung und Technisierung wissenschaftlicher Arbeit ist zur Aufrechterhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit und Gültigkeit wissenschaftlicher Arbeit auch die verstärkte und flexible Kooperation der hochgradig spezialisierten Fachwissenschaften notwendig, sollen nicht immer mehr mögliche Gegenstände aus dem Blickfeld der Forschung und des Studiums herausfallen bzw. in isolierte ‚Aspekte‘ aufgelöst werden. Die steigende Spezialisierung der Wissenschaften ist nur solange sinnvoll, als gleichzeitig auch eine steigende Kooperation der Spezialfächer bei der Arbeit am Objekt erreicht wird.
Es handelt sich bei der Forderung nach überfachlicher Kooperation nicht um das abstrakte, platonisch bleibende Postulat der „Wiederbelebung“ der universitas litterarum, der partiellen Rückführung der Einzelwissenschaften in den Schoß der Philosophie, sondern um faktische ‚Universalität‘ im bestimmten wissenschaftlichen Arbeitsprozeß, in der gemeinsamen Bewältigung von Zielen der Forschung und des Studiums. Nicht die scholastische Universalität der Wissenschaftsdisziplinen, organisiert in Ring-Vorlesungen und Festschriften, sondern nur die Totalität des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses in der Bewältigung seines konkreten Arbeitsobjekts ist noch realisierbar.
Die gegenwärtige vorherrschende organisatorische Gliederung der Hochschulen ist jedoch nicht schwerpunktmäßig auf die möglichen Gegenstände wissenschaftlicher Arbeit bezogen, sondern hat ihren Ursprung einerseits in der Wissenschaftsgeschichte, in der ‚Auffächerung‘ der klassischen Fakultäten der mittelalterlichen Universität, andererseits in der Entstehung und Spezialisierung der traditionellen und bürgerlichen akademischen Berufe. Vom Gegenstand her gibt es nur eine sehr grobe und selbstverständliche Gliederung in Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften.
Diese grundlegende Gliederung in wissenschaftstheoritische wie ausbildungsmäßig relativ homogene Wissenschaftsdisziplinen ist um der theoretisch und methodologisch bewußten wissenschaftlichen Arbeitsweise willen unbedingt erforderlich, darf aber nicht das ausschließliche Organisationsprinzip bleiben.
Es besteht zwar die Tendenz zu einer objekt-bezogenen Gliederung innerhalb der Fachwissenschaften (z.B. die ‚Organorientierten‘ Spezialkliniken, oder die sog. ‚Bindestrich‘ - Soziologien), aber dadurch wächst die Möglichkeit, daß zahlreiche relevante Gegenstände an keinem Ort in der Hochschule mehr in ihrer Totalität, sondern immer nur unter speziell-fachwissenschaftlich orientierten Aspekten erforscht und studiert werden. (z.B. die Bearbeitung der sozialen, wirtschaftlichen, verkehrs- und bautechnischen Probleme von Gemeinden jeweils in voneinander isolierten Institutionen).
Die erstarrte Gliederung der Hochschulen führt jedoch nicht nur zum Verlust der Totalität des Objekts und damit zur mangelnden Vollständigkeit und Gültigkeit von Forschungsergebnissen, sondern sie behindert auch die Lösung gesellschaftlich bedeutsamer Planungsaufgaben, die nur auf wissenschaftlicher Grundlage erfolgen kann, sowie die zweckmäßige Ausbildung von wissenschaftlich qualifizierten Fachleuten, die an der Lösung solcher Planungsprojekte mitarbeiten müssen.
Jede dem heutigen technisch-wissenschaftlichen Standard gemäße Planung von wirtschaftlichen oder technischen Projekten erfordert die korrekte und möglichst rationelle Anwendung von Forschungsergebnissen und Techniken zahlreicher Fachwissenschaften.
Aufgrund beider Erwägungen - dem wissenschaftsimmanenten Problem des Zerfalls von konkreten Gegenständen wissenschaftlicher Arbeit in isolierte ‚Aspekte‘, wie auch dem Problem der mangelnden Anpassung wissenschaftlicher Arbeit an die Lösung gesellschaftlich relevanter Aufgaben - muß eine Ergänzung der gegenwärtigen organisatorischen Gliederung erstrebt werden:
Es müssen in verstärktem Maße ‚objektbezogene‘ wissenschaftliche Institute gegründet werden, die die traditionelle Fakultäts- und Fächereinteilung in ihrem Bereich durchbrechen.
Diese interfakultativen Forschungs- und Ausbildungsinstitutionen sollen sich einen nicht zu eng begrenzten Komplex vorwiegend aus dem Bereich von Gesellschaft, Wirtschaft, Technik widmen. (In den Naturwissenschaften und in den technologischen Wissenschaften hat sich die Bildung ‚objektbezogener‘ Institute schon längst durchgesetzt.)
Als Maßstab für die Gründung solcher Institute muß
- die Bedeutung einer solchen Lösung für die bessere Erfassung von Forschungs- und Studienobjekten oder
- die gesellschaftliche Relevanz der Bearbeitung des gewählten Gegenstandes gelten.
Als bereits verwirklichte Beispiele solcher objektbezogener Institute können die Institute für Publizistik bzw. Zeitungswissenschaft, Rundfunk- und Fernsehwesen, Film genannt werden, für deren Gründung beide Erwägungen - bessere Erfassung des Forschungsobjekts und seine zunehmende gesellschaftliche Bedeutung - ausschlaggebend waren.
Ebenso bestehen bereits Spezielle auslandswissenschaftliche oder länderkundliche Institute, die das betreffende Land nicht nur unter sprachwissenschaftlichen und ethnologischen Gesichtspunkten, sondern im Gesamtzusammenhang studieren (Osteuropa-Institute, Amerika-Institute).
Unter dem Aspekt der gesellschaftlichen Bedeutung des Arbeitsgegenstandes sollten diese interfakultativen Institute schwerpunktmäßig in zwei Bereichen gegründet werden:
- zum Studium und zum umfassenden Erforschung von Entwicklungsländern durch Erweiterung der bestehenden Institute und Seminare für Orientalistik Sinologie, Indologie, zu vollwertigen interfakultativen Instituten (auch mit soziologisch-politischen, geographischen und wirtschaftswissenschaftlichen Abteilungen) und durch Neuaufbau von Afrika-Instituten, Ibero-Amerika-Instituten an mehreren Universitäten ebenfalls unter diesen Gesichtspunkten.
- zur Forschung und Ausbildung auf gesellschaftlich-wirtschaftlichen Gebieten, zur wissenschaftlichen Fundierung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Planung und Politik z.B. durch Institute für Städtebau, Kommunalwesen, Verkehrswesen oder durch spezielle betriebs- oder arbeitswissenschaftliche Institute, in denen die Erkenntnisse und Methoden der Soziologie, Sozialpsychologie, Medizin, Betriebswirtschaftslehre, Betriebstechnik, Volkswirtschaftslehre etc. besser zum Studium ganz bestimmter Betriebsformen und der Arbeit in diesen Betrieben angewendet werden.
Solche, als Ergänzung der Fach-Institute gedachten objektbezogenen Forschungs- und Ausbildungsstätten werden aber nur in dem Maße methodologisch korrekt und erfolgreich arbeiten können, als ihre integrierende und koordinierende Funktion deutlich bleibt, und nicht aus technisch-organisatorischen Lösungen heraus ein sachfremder Anspruch auf Konstituierung eines neuen ‚Faches‘ mit monistischer Methodologie erhoben wird, um eine bestimmte einseitig fachlich orientierte Konzeption durchzusetzen. (Wie es z.T. in den Instituten für Publizistik geschieht).
Daher sollten nicht nur die Studenten und Assistenten, sondern auch die Dozenten an diesen objektbezogenen Instituten nur für eine bestimmte Zeit tätig bleiben.
Die Zweckmäßigkeit der internen fachwissenschaftlichen Gliederung dieser Institute in Abteilungen muß ebenfalls von Zeit zu Zeit überprüft und dem Forschungsstand und der Funktion des Instituts angepaßt werden.
II.3 Die Organisationsformen von Forschung, Lehre und Studium
Grundcharakter und Ziele der wissenschaftlichen Arbeitsprozesse in der Hochschule - in Forschung, Lehre und Studium - sind bereits im einzelnen dargestellt worden. In diesem Zusammenhang sollen der Übersicht halber eine Reihe von konkreten Verbesserungsvorschlägen zur Gestaltung und Funktion der einzelnen Organisationsformen der wissenschaftlichen Arbeitsprozesse zusammengefaßt werden.
II.3.1 Das Kollegium
Als Koordinationszentrum der wissenschaftlichen Arbeit des Lehrkörpers sollte in jedem Institut (soweit es nicht eine rein technische Einrichtung ist) bzw. für den Bereich eines Faches oder Fachgebiets ein Kollegium gebildet werden, dem alle Lehrkräfte dieses Faches oder Instituts angehören, und das zu regelmäßigen Arbeitssitzungen oder Informationsbesprechungen zusammentrifft.
Die Sitzungen des Kollegiums sollen erstens der laufenden gegenseitigen Information und Diskussion über wissenschaftliche Fragen dienen, auf der Grundlage persönlicher Berichte oder Erläuterungen einzelner Dozenten oder von Forschungsteams über ihre Arbeitsergebnisse, soweit sie für die anderen Fachkollegen von Interesse sind; zweitens soll in diesem Gremium der Lehrplan des Faches diskutiert, geplant und aufgrund der individuellen Interessen der Einzelnen und der Erfordernisse einer sinnvollen, vollständigen Ausbildung der Studenten koordiniert werden.
II.3.2 Forschungsgruppen
Die hochgradige Spezialisierung selbst innerhalb einzelner Fachgebiete erfordert neue Arbeitsformen auch für die Forschungstätigkeit der Dozenten und Assistenten: An die Stelle der isolierten Arbeit der Professoren, die Aufträge an die abhängigen Assistenten und Hilfskräfte erteilen, sollte von Fall zu Fall die freie Zusammenarbeit mehrerer Dozenten mit Assistenten und älteren Studenten treten, die sich zur Bearbeitung einer begrenzten Aufgabe zu einem Forschungsteam zusammenfinden, dem im Rahmen des Forschungsprogramms eines Instituts oder eines Faches die notwendigen Arbeitsmittel und Einrichtungen zur Verfügung stehen sollen.
II.3.3 Studienprogramme
Als ein organisatorisches Mittel, die starre Institutionalisierung der wissenschaftlichen Lehre bei den einzelnen Lehrstühlen und Instituten aufzulockern, sind zeitlich und thematisch begrenzte ‚Studienprogramme‘ zu entwickeln, zu deren Vorbereitung, Organisation und Auswertung sich Dozenten, Assistenten und interessierte ältere Studenten (Doktoranden, studentische Tutoren) aus verschiedenen Instituten oder auch innerhalb einer Fachrichtung in Arbeitsgemeinschaften vereinen. Diese lockere Form der Zusammenarbeit in Lehre und Studium soll verhindern, daß innerhalb eines Faches die Lehrveranstaltungen der einzelnen Dozenten völlig beziehungslos nebeneinander herlaufen. Stattdessen sollten sich mehrere Dozenten auf verschiedene Aspekte eines ausgewählten, begrenzten Gegenstandes konzentrieren oder auch direkt Parallelveranstaltungen zum gleichen Thema durchführen. Der Sinn eines derartigen studium exemplare - Programms im Rahmen des Studiums wurde bereits aufgezeigt.
Die durch Arbeitsgemeinschaften koordinierten Studienprogramme bilden einen lockeren, von Fall zu Fall wechselnden Rahmen für verschiedene Organisationsformen der Lehre und des Studiums - Vorlesung, Colloqium, Seminar, Arbeitsgruppe - die sich jeweils um ein zentrales Thema gruppieren.
Die damit zugleich bezweckte Intensivierung des Studiums macht jedoch auch neue differenziertere Arbeitsformen des Studiums notwendig. Vgl. ANHANG, Nr. 1
II.3.4 Die Vorlesung
Der eigentliche Sinn der traditionellen, antiquiert anmutenden Vorlesung erweist sich immer dann, wenn es ein Professor versteht, den toten Stoff, das Erkenntnismaterial, zum Sprechen zu bringen, wenn das Kolleg den Studenten nicht als ein vorgelesenes Nachschlagewerk, sondern als Lebensäußerung eines Menschen bewußt wird, der seine persönliche wissenschaftliche Leistung, seine Weise der Interpretation des Wissens und der neuen Erkenntnis vorträgt. (74)
Sinn und Aufgabe einer Vorlesung kann daher nicht darin bestehen, nur Wissensstoff in Form des neuesten Handbuches zu vermitteln. In der Vorlesung muß das vorgetragene Objekt klar umrissen und die bestimmte Methode des Dozenten als Zugang zum Objekt in kritischer Auseinandersetzung mit anderen Lehrmeinungen verdeutlicht werden.
Der in der Vorlesung vermittelte Stoff muß zugleich in seiner Stellung im Gesamtprozeß der wissenschaftlichen Leistung und Arbeit eines Faches durchsichtig gemacht werden.
Zur Verbesserung und Ergänzung der Organisation der Vorlesung wird folgendes empfohlen:
In vervielfältigten Druckbögen muß auf die zugänglichen Darstellungen des zugrundeliegenden Materials (Lehrbücher, Quellensammlungen, Sekundärliteratur) hingewiesen werden, wobei besonders auf abweichende Interpretationen und Methoden eingegangen werden sollte. Es empfiehlt sich, möglichst viel von der in der Vorlesung behandelten Literatur in besonderen Lesesaal-Apparaten zur jederzeitigen Einsicht für alle Hörer zusammenzufassen.
In regelmäßig wiederkehrenden anschließenden ‚Fragestunden‘ oder Colloquien zur Vorlesung muß die Möglichkeit geschaffen werden, Fragen zu stellen, um Missverständnisse auszuschalten und die Interpretation oder Methodik des Dozenten zu kritisieren und mit anderen fundierten Interpretationen und Erkenntnissen in Vergleich zu setzen. Dazu wird es sich als dienlich erweisen, wenn grundlegende Thesen oder Forschungsergebnisse des Dozenten den Studenten in Kurzfassungen schriftlich vorliegen. (Bei der Anfertigung und Vervielfältigung dieser Skripten und der Bibliographien zur Vorlesung sollte angesichts der Überlastung der Dozenten und Assistenten die studentische Fachschaft Unterstützung leisten).
Die z.T. sehr hohe Wochenstundenzahl von Vorlesungen (die auch durch das bestehende Kolleggeld-System bedingt ist) sollte erheblich gesenkt werden, u.a. zu Gunsten anschließender Colloquien, um den Studenten die Teilnahme und die Mitarbeit durch Lektüre an mehreren Vorlesungen verschiedener Dozenten zu erleichtern
II.3.5 Seminar
Wenn auch die zu hohen Teilnehmerzahlen der Seminare die Möglichkeiten des Studenten zu eigener, aktiver Beteiligung stark vermindern, so ist doch das Seminar auch heute noch in vielen Fächern Zentrum selbsttätiger Arbeit. Nicht selten jedoch bleibt das Seminar für den einzelnen Studenten bloße Wissensvermittlung und verlangt von ihm die stille Teilnahme des Konsumenten, die er durch den Seminarschein bestätigt bekommt.
War der Seminar-Schein als Auszeichnung und Anerkennung für selbständige geistige Arbeit einst Ausdruck eigener geistiger Qualifikation, so erscheint das Seminar dem Studenten heute nicht mehr als eine Lebensäußerung der daran beteiligten Menschen, sondern als ‚gesellschaftliche Natureigenschaft‘ des Seminars, als sein eigentlicher Zweck, erscheint dem Studenten der Seminar-Schein, durch den ihm aber nur der ‚Schein‘ echter wissenschaftlicher Arbeit bescheinigt wird. Denn der Seminar-Schein gibt der ‚Verdinglichung‘ der wissenschaftlichen Arbeit zum ‚Stoff‘ dadurch seine besondere Note, daß er den Einzelnen der Fiktion überläßt, er habe wirklich etwas geleistet. In Wirklichkeit aber erleichtert das in den traditionellen, veralteten Formen abgehaltene Seminar nur die Aufnahme fertig bearbeiteter Denkresultate und autoritativer Feststellung (Referate von Studenten und Monologe des Professors). Der normale Seminarbetrieb ist daher nur eine zweckmäßige Art, fertige Resultate unter dem Scheine ihrer Produktion aufzunehmen. Die Aufrechterhaltung des Anspruches, daß das Seminar den eigentlichen Forschungsprozeß oder Erkenntnisvorgang widerspiegele und jeder Teilnehmer dadurch ‚ein kleiner Forscher‘ werde, wird zu einem zentralen Bestandteil der Universitätsideologie, die die Wirklichkeit der heutigen Arbeitsverhältnisse aus den Blick verloren hat, und findet seinen Niederschlag in dem sachlich nicht begründeten Sozialprestige des Akademikers, der sich durch ‚Berechtigungsscheine‘ das Privileg einer höheren, ‚akademischen‘ Stellung im Berufsleben sichert. (75)
Der Grund für diese mangelnde Leistungsfähigkeit ist einmal die Überfüllung der meisten Seminare, in noch stärkerem Maße aber ihre veraltete Organisationsform, die die Überfüllung noch unerträglicher werden läßt. (Fehlende Planung durch den Dozenten, mangelnde Vorbereitung des Studenten, bloßes Vorlesen von langen Referaten, die der Diskussion kaum noch Spielraum lassen).
Die notwendige Neugestaltung des Seminars wird aber nicht durch bloß organisatorische Änderungen zu erreichen sein, sondern das Seminar kann die ihm gestellte Aufgabe nur dann effektiv erfüllen, wenn es unter einer zentralen Frage steht, auf deren Klärung hin es angelegt ist und deren Notwendigkeit und Sinn den Studenten einsichtig ist. Erst dadurch erhalten die erforderlichen organisatorischen Verbesserungen ihre Berechtigung.
Zur Verbesserung der Organisation von Seminaren ist zu empfehlen -
bei der Themenstellung die offen gebliebenen Fragen früherer Seminare, das Forschungsinteresse des Professors und der an bestimmten Gebieten besonders in - teressierten Studenten zu berücksichtigen,
bei der Entwicklung der Pläne für ein Seminar bereits Assistenten und interessierte Studenten heranzuziehen und am Ende des vorhergehenden Semesters eine allgemeine Vorbesprechung einzuberufen,
bei der Vorbesprechung in einer vervielfältigten Übersicht auf die wichtigste, für den Gesamtzusammenhang unbedingt notwendige Literatur und gesondert auf Spezialliteratur hinzuweisen,
jeden Teilnehmer durch ein Referat oder Korreferat, ein Protokoll oder eine vergleichbare Arbeit direkt am Geschehen des Seminars zu beteiligen,
die Referate in mehreren Exemplaren in den Seminarbibliotheken eine Woche vor dem Vortrag auszulegen, den Vortrag auf die wesentlichsten Teile zu beschränken und nach jedem Referat eine ausführliche kritische Diskussion durchzuführen,
von jeder Sitzung ein Protokoll anfertigen zu lassen, dessen Aufgabe es weniger sein muß, eine chronologische Darstellung der Sitzung zu geben, als vielmehr die Leistung der Seminar-Sitzung für die Klärung der zentralen Frage aufzuzeigen, Ergebnisse zu referieren und neuentstandene Probleme aufzuweisen,
am Ende des Seminars in einer ausführlichen Diskussionssitzung das Ergebnis des Seminars in Bezug auf die zentrale Frage zu prüfen.
Größere Teilnehmerzahlen in den wichtigen Hauptseminaren werden sich selbst bei Behebung der akuten Notlage der Hochschule nicht vermeiden lassen, will man nicht die akademische Freiheit des Studiums durch einen „Frequenzzwang“ aufheben. Immer werden einige Dozenten weit mehr Anziehungskraft ausüben als andere. (76)
Daher müssen die meisten Seminare in Grippen aufgeteilt werden. Dabei ist es zweckmäßig -
Seminargruppen zu bilden, die etwa 3-4 Teilnehmer umfassen und gemeinsam eine gestellte Aufgabe bearbeiten und sie dem Gesamt-Seminar durch einen Referenten und ergänzende Beiträge vortragen. (Die Anzahl der Seminargruppen wird sich nach der Größe des Seminars und der Aufteilung des Seminarthemas richten.)
Diskussionsgruppen aus Seminarteilnehmern zu bilden, die den Gesamtzusammenhang, in dem das Seminarthema steht, ausführlicher behandeln, als es in der Seminarsitzung möglich ist. Die Diskussionsleiter sollten den Professor über den jeweiligen Diskussionsstand unterrichten und interessante Diskussionsergebnisse in der Seminarsitzung mitteilen.
Diese Aufteilung des Seminars in Gruppen, die unter dem Gesichtspunkt einer besseren Studienökonomie Bestehendes ausweitet, ist an den in einzelnen Fächern bestehenden Verhältnissen auf ihren sinnvollen Aufbau zu überprüfen.
Um den Studenten die innere theoretische und methodische Problematik ihres eigenen Faches deutlich werden zu lassen, und um die Zusammenarbeit zwischen den Dozenten zu fördern, sollten auch Seminare kollegial von mehreren Dozenten und Assistenten eines Instituts veranstaltet werden.
Außerdem ist es zweckmäßig, von Dozenten verschiedener Fächer kollegial veranstaltete Seminare durchzuführen, um Grenzgebiete zu behandeln, die von den bestehenden FachInstituten nicht voll erfaßt werden.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Mitarbeit des Studenten im Seminar in dem vorgetragenen Sinne sind Proseminare mit geringerer Teilnehmerzahl (maximal 20 Studenten), die die wissenschaftliche Denkfähigkeit des Studenten bereits in der Anleitung zum Gebrauch der Methoden und Techniken seines Faches fördern. In den Proseminaren mit geringer Teilnehmerzahl soll auch die Kunst der rationalen Diskussion und der kritischen Fragestellung an Hand wissenschaftlicher Gegenstände geübt werden. Um zahlreiche kleinere Proseminare als Zentrum der Studieneinführung veranstalten zu können, muß neben jüngeren Dozenten eine breite Schicht wissenschaftlicher Nachwuchskräfte mit Tutorenfunktion bereitstehen. (Vgl. Kapitel IV, Der Lehrkörper der Hochschule)
Als zweite Vorbedingung einer sinnvollen Arbeit im Seminar ist es in vielen Fächern notwendig, daß der Student in dafür bestimmten Kursen das erforderliche Grundlagenwissen lernend erarbeitet. (z.B. in sprachlichen und grammatikalischen Übungen) Diese Kurse unterscheiden sich in ihrem Ziel, Wissensstoff und Techniken zu vermitteln und ihre Anwendung zu üben, eindeutig vom Seminar.
II.3.6 Arbeitsgruppen
Damit die gekennzeichneten neuen Formen der Seminarorganisation nicht allein von der Gunst des Seminarleiters abhängig und damit ephemer bleiben und um auch andere Organisationsprinzipien neben dem traditionellen Seminar zu entwickeln, müssen die Studenten durch ihre Fachschaft versuchen, in eigener Initiative, auf dem Wege der Selbsthilfe eine sinnvolle Organisation ihres Studiums zu erreichen, Diese Studienselbsthilfe entsteht zwar aus der gegenwärtigen Notsituation der Hochschulen, ist aber zugleich ein Versuch, die dem Studium als einer spezifischen Form des freien wissenschaftlichen Arbeitsprozesses eigentlich immanente Organisationsform wieder freizulegen und zur Entfaltung zu bringen.
Es soll dem Studenten auf diesem Wege ständig deutlich gemacht werden, daß sein eigenes Studium sich nur im Gespräch und in der Zusammenarbeit mit anderen voll entfalten kann und welche Verantwortung er für ein sinnvolles Studium seiner Mitstudenten trägt. Denn die Leistung der Seminare und Arbeitsgruppen für die Wissenschaft und für die Ausbildung der an ihnen beteiligten Studenten hängt ab von dem Beitrag jedes einzelnen Teilnehmers.
Arbeitsformen der Studienselbsthilfe sind vor allem:
II.3.7 Tutorengruppen,
mit geringer Teilnehmerzahl (5-10), die nicht als Ersatz für Proseminare und Einführungsübungen, sondern in Verbindung zu Vorlesungen, Proseminaren, Anfängerübungen veranstaltet werden. Sie sollen am Beispiel der Thematik der Lehrveranstaltungen, auf die sie Bezug nehmen, oder unabhängig davon an Hand noch begrenzterer Gegenstände eine beispielhafte Einführung in die wissenschaftliche Problematik eines Studiengebietes geben und dabei die Studenten an die von der Schule unterschiedene Form wissenschaftlichen Arbeitens gewöhnen. In den kleinen Tutorengruppen kann auch eher die Scheu vieler Studenten, sich durch Beteiligung an der Diskussion oder Fragestellung ‚bloßzustellen‘, überwunden und ein lebhafter Gedankenaustausch über Probleme des Studiums und der Fachwissenschaft erreicht werden.
Als Tutoren sollten gegen eine Arbeitsentschädigung qualifizierte ältere Studenten, Diplomanden oder Doktoranden gewonnen werden.
In diesem Zusammenhang sind allerdings Versuche, Tutorengruppen vor allem als gemeinschaftsbildende ‚Kleinfamilien‘, als ‚kleine Zellen‘ zur menschlichen Erziehung der Studenten anzusehen, entschieden abzulehnen. ‚Gemeinschaft‘ entsteht rein zufällig und nur dort, wo sie nicht krampfhaft organisiert wird. Tutorengruppen dienen vielmehr nur der Beratung und Information des Studenten über sein Studium und über die Universität.
II.3.8 Arbeitsgruppen,
die der lernenden Erarbeitung u. Wiederholung von Stoff, Methoden und Techniken dienen. z.B. zur gemeinsamen Examensvorbereitung, zur Vorbereitung auf Klausuren und andere Leistungsprüfungen, ferner zur Übung in der Beherrschung fremder Sprachen und fremdsprachlicher Fachliteratur (in Konversationsgruppen) oder auch zum gemeinsamen Erlernen der Grundlagen neuer Sprachen, in Verbindung mit einem qualifizierten Tutor.
II.3.9 Arbeitskreise
sollten wissenschaftliche Themen zum Gegenstand wählen, die im Lehrplan sonst keinen Raum finden oder für die sich fortgeschrittene Studenten besonders interessieren. Die Themenstellung sollte mit Dozenten oder Assistenten beraten werden. Das Ergebnis der Arbeit, die sich evtl. über mehrere Semester erstrecken wird, soll Dozenten des Faches vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden, um Irrtümer und falsche Fragestellungen, die im Laufe der selbständigen Arbeit der Studenten entstanden sind, aufzudecken Der Übergang von diesen wissenschaftlichen Arbeitskreisen älterer Studenten zu den Forschungsteams wissenschaftlicher Nachwuchskräfte und Dozenten, zu denen auch qualifizierte Studenten herangezogen werden sollen, wird in vielen Fällen fliessend sein.
II.3.10 Die Arbeitsformen im Ablauf des Studiums
Bei diesen Vorschlägen zur Verteilung der Arbeit in Seminar-, Diskussion-, Arbeits- und Tutorengruppen und in wissenschaftliche Arbeitskreise ist selbstverständlich zu berücksichtigen, daß jede Organisationsform einen bestimmten Stellenwert im Gesamtverlauf des Studiums hat, womit gesagt werden soll, daß der Student sich in einer ganz bestimmten Phase seines Studiums einer dieser Gruppen anschließen wird.
In fast allen Semestern sollte sich der Student aber an den vier grundlegenden Arbeitsformen des Studiums gleichzeitig beteiligen:
- Die Seminarübung, die von Proseminaren im ersten Studienabschnitt über das zentrale Hauptseminar, die kleinere wissenschaftliche Übung bis zu Doktorandenseminaren reicht.
- Unabhängige kleine Gruppen, beginnend mit der Tutorengruppe in den ersten 3-bis 4 Semestern, über Diskussionsgruppen im Anschluß an Seminare oder ständige Diskussionskreise bis zu wissenschaftlichen Arbeitskreisen und Beteiligung an Forschungsgruppen, oder Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von Lernstoff und zur Examens vorbereitung in den letzten Studienabschnitten.
- Kurse, Lehrgänge und Praktika zum systematischen Lernen und Üben des Grundlagenwissens und bestimmter technischer Methoden.
- Vorlesungen und Colloquia, die alle Studenten nach freier Wahl in allen Studienabschnitten besuchen können.
Ein Student eines geistes- oder sozialwissenschaftlichen Faches wird sich in einem Semester seines Hauptstudiums (nach einer Zwischenprüfung) etwa folgenden Lehrveranstaltungen und Gruppen beteiligen:
Vorlesung mit anschliessendem Colloquium, Hauptseminar mit Beteiligung an einer Seminargruppe, die ein gestelltes Thema arbeitsteilig durcharbeitet, Diskussionskreis im Anschluß an das Seminar, ein Kursus im Rahmen eines Lehrgangs (zur Erlernung von Sprachstufen oder Grundlagen der Statistik, Mathematik), wissenschaftlicher Arbeitskreis von Studenten über ein frei gewähltes Thema.
Um die Arbeit in kleineren Gruppen zu verstärken, ist der Anteil der Vorlesungsstunden dem inoffiziellen oder geplanten Studentenplan des Studenten stark herabzusetzen. Mit der notwendigen ständigen Vergrößerung des Habilitierten-Lehrkörpers sollten zwar mehr Vorlesungen ‚angeboten‘ werden, um den Studenten eine individuellere Studiengestaltung nahezulegen und um den kritischen Vergleich von Lehrmeinungen zu fördern, aber gleichzeitig müssen die einzelnen Vorlesungen erheblich kürzer werden (etwa 2 Wochenstunden, einschließlich Colloquium).
Es ist ebenso offensichtlich, daß die Intensivierung des Studiums durch neue Arbeitsformen in kleinen Gruppen auf lange Sicht eine radikale Erweiterung des gesamten Lehrkörpers, besonders aber der wissenschaftlichen Nachwuchskräfte mit Tutorenfunktion, erfordert. (Vgl. Kapitel IV, Der Lehrkörper der Hochschule).
Solange dieses Ziel wegen der mangelnden finanziellen Förderung der deutschen Hochschulen und wegen der Versäumnisse in der Förderung und Auslese des wissenschaftlichen Nachwuchses nicht erreicht werden kann, muß sich die Studentenschaft auf die Mittel der Studien selbsthilfe konzentrieren. Da die Arbeitsformen der Studienselbsthilfe auch für solche Aufgaben eingesetzt werden müssen, die eigentlich von hauptamtlich beschäftigten Lehrkräften viel besser und reibungsloser zu erfüllen wären, so bedeutet das eine erhebliche Verlängerung der Studiendauer, da sich die Studenten durch verschiedene Experimente und Umwege ohne echte Beratung durch ihre Lehrer den Weg bahnen müssen. Die Hebung des Niveaus in der Ausbildung, die durch die Intensivierung der Selbsthilfe-Methoden zweifellos eintritt, kann nicht die sachfremde Verlängerung der Studiendauer beseitigen, solange die Studienselbsthilfe nicht sinnvoll mit arbeitsfähigen Lehrveranstaltungen verknüpft wird.
III. Akademische Freiheit und soziale Demokratie
Die Wissenschaft, der Prozeß der Wahrheitssuche, ist ein Ausschnitt aus dem Lebensprozeß der Gesellschaft und kann daher in ihrer Funktion nur begriffen werden, wenn sie in Beziehung gesetzt wird zur historischen Situation, der bestimmten Art der Lebensproduktion. Wissenschaft als Ausschnitt aus dem gesellschaftlichen Lebensprozeß und ihre institutionellen Einrichtungen innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsordnung gehören daher notwendig zusammen.
Im Folgenden sollen daher die Verhältnisse betrachtet werden, die die Hochschullehrer und Studenten innerhalb des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses untereinander eingehen: die ‚Produktionsverhältnisse‘ in der Hochschule, im wissenschaftlichen Betrieb, die nur einen Ausschnitt aus der Gesamtheit der Produktionsverhältnisse der arbeitenden Menschen in der Gesellschaft darstellen, aber durch spezifische Formen bestimmt sind.
III.1 Zur Verfassungswirklichkeit der gegenwärtigen Hochschule
Die durch die Erkenntnisse der neuzeitlichen Wissenschaft in einer günstigen historischer. Konstellation mitausgelöste explosionsartige Entfesselung der Produktivkräfte in der modernen Industrie mußte auch die Produktionsverhältnisse der Wissenschaft selbst, die sozialen Beziehungen der Wissenschaftler in der Hochschule tiefgreifend umformen.
Wurden die reine wie die angewandte Forschung zur Grundlage des Fortschritts der Industrialisierung, so wurden gleichzeitig die Erzeugnisse der Industrie und Technik als Forschungs- und Betriebsmittel in vielen Wissenschaftsdisziplinen zur notwendigen Bedingung des Fortschreitens der wissenschaftlichen Erkenntnis. Immer umfangreichere und kompliziertere Apparaturen, Labors, Maschinen, bzw. Bibliotheken, Karteien und Sammlungen wurden zur Voraussetzung sinnvoller und geplanter Forschungsarbeit und wissenschaftlicher Ausbildung.
Wissenschaft wurde vom Medium „spielerischer Muße“ und philosophischer Spekulation zur „Substanz des praktischen Handelns selbst“ (Schelsky) (77) , das Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnis zur ‚Wissenschaft als Beruf‘ - zum Beruf allerdings in einer kapitalistischen Industriegesellschaft und geprägt von deren Arbeitsverhältnissen.
Max Weber schreibt 1919 (in Wissenschaft als Beruf, S. 7):
„Die großen Institute medizinischer und naturwissenschaftlicher Art sind 1 staatskapitalistische‚ [FEHLER] Unternehmungen. Sie können nicht verwaltet werden ohne Betriebsmittel größten Umfangs. Und es tritt da der gleiche Umstand ein wie überall, wo der kapitalistische Betrieb einsetzt: die ‚Trennung des Arbeiters von den Produktionsmitteln‘. Der Arbeiter, der Assistent also, ist angewiesen auf die Arbeitsmittel, die vom Staat zur Verfügung gestellt werden; er ist infolgedessen vorn Institutsdirektor ebenso abhängig wie ein Angestellter in einer Fabrik -denn der Institutsdirektor stellt sich ganz gutgläubig vor, daß dies Institut ‚sein‘ Institut sei und schaltet darin - und er steht häufig ähnlich prekär wie jede ‚proletaroide‘ Existenz … diese Entwicklung wird weiter übergreifen auch auf die Fächer, wo der Handwerker das Arbeitsmittel (im wesentlichen die Bibliothek) selbst besitzt.. Die Entwicklung ist in vollem Gange.“
Auch in den von Helmuth Plessner herausgegebenen „Untersuchung zur Lage der deutschen Hochschullehrer“, Bd. II, S. 38, wird die Entwicklung des Professors als Institutsdirektors zum ‚Personalchef‘ eines wissenschaftlichen Betriebes beschrieben:
„Der Direktor verfügt über die ‚Produktionsmittel‘, die erst die vollen wissenschaftlichen Arbeitsmöglichkeiten erschließen, und auch über die ökonomischen Subsistenzmittel, auf welche Nachwuchskräfte ohne eigenes Vermögen angewiesen sind.“
Durch das Anwachsen der Universitätsinstitute zu wissenschaftlichen Betrieben bei gleichzeitiger Beibehaltung der überkommenen ständischen akademischen Verfassung, in der nur die privilegierte Oligarchie der Ordinarien über die Angelegenheiten der Universität entscheidet, setzte eine quasiklassenmäßige Spaltung der akademischen Bürgerschaft ein:
auf der einen Seite stehen die Direktoren der Institute, die durch ihre Machtstellung zu „Besitzern“ dieser Betriebe, der wissenschaftlichen Produktionsmittel, werden;
auf der anderen Seite die große Mehrheit der „Nicht-Besitzer“, der abhängigen Angestellten der Lehrstuhlbesitzer (Assistenten, Hilfskräfte, Lektoren, Kustoden, Bibliothekare).
Die freie akademische Konkurrenz, wie sie zur Blütenzeit des unabhängigen Privatdozenten teilweise wenigstens verwirklicht war, wird wieder ausgeschaltet durch die materielle Monopolstellung der Lehrstuhlinhaber, die nun allein die materiellen Voraussetzungen für den Gebrauch der in der Verfassung verankerten Freiheit der Forschung und Lehre besitzen.
Der Institutsdirektor hat in der sozialen und verfassungsmäßigen Realität der Hochschule die gleiche Funktion wie ein leitender Industriemanager, der faktisch schrankenlos über die seiner Verfügungsgewalt unterstellten Produktionsmittel verfügen kann.
Aber die Gewalt der Institutsdirektors begründet darüberhinaus ein abgewandeltes, wenn auch gemildertes Abhängigkeitsverhältnis zu den Studenten ‚seines‘ Instituts:
Die Studenten sind als Anstaltsbenutzer dem Hausrecht und der Institutsdisziplin unterworfen. Der Direktor als Herr im Haus verpflichtet sie auf die Einhaltung der Hausordnung und kann sie von der Benutzung des Instituts ausschließen. Da der Direktor auch den Lehrplan festsetzt, über die Arbeitsplätze der Studenten verfügt, über die Zulassung zu seinen Seminaren entscheidet, Zwischenprüfungen und die Bedingungen der Durchführung des Examens faktisch bestimmt, sind auch Studiengang und Studienbedingungen der Studenten weitgehend von der Entscheidung eines Institutsdirektors abhängig. Durch seinen Einfluß bei der Vergabe von Stipendien und der Eignungsfeststellung sind viele Studenten auch unmittelbar wirtschaftlich von ihrem ‚Hausherrn‘ abhängig.
II.1.1 Betriebsverhältnisse und Fortschritt der Wissenschaften
Die ‚Industrialisierung‘ der Hochschule, ihre Verwandlung in eine administrative Einheit von zahlreichen Forschungs- und Ausbildungsbetrieben war zwangsläufig und ist irreversibel. Dieser Prozeß, der noch nicht völlig abgeschlossen ist, wird ständig weiter getrieben a) durch den Bedarf von Industrie und Technik an der Verwendung und Anwendung aller nur erreichbaren neuen Forschungsergebnisse der technologischen und naturwissenschaftlichen Betriebe, deren Anwachsen wiederum die geisteswissenschaftlichen Institute in ihrer Funktion als Hilfs- und Ergänzungseinrichtung für die Naturwissenschaften verstärkt, b) durch den Massenbedarf an wissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften für immer weitere Bereiche des Berufslebens.
Aber trotz der betriebsförmigen Struktur der Hochschulen geraten die gegenwärtig in ihnen herrschenden Arbeitsverhältnisse in Widerspruch zu den Anforderungen, die die Weiterentwicklung der Wissenschaft und der Technik stellt. Die Betriebsverhältnisse der Hochschule werden zur Fessel eines ungehemmten Entfaltung aller wissenschaftlichen Kräfte (Begabungen, Methoden, Techniken). Drei Hemmungen dieser Art stehen dabei im Vordergrund:
- Die autoritäre Lenkung und Bevormundung qualifizierter wissenschaftlicher Mitarbeiter durch die Institutsleitung, die die „Forschungsrichtung“ oft einseitig festlegt.
- Die z.T. vertragliche Bindung der Forschungsarbeit vieler Institute an die oft unsachgemäßen Vorstellungen und Interessen von Dienststellen und Privatunternehmen, die als Geldgeber von Forschungsprogrammen auftreten.
- Die mangelnde Koordination zwischen den voneinander isolierten und immer noch zu kleinen Instituten, denn das „Lehrstuhlinstitut“, das um den selbstherrlich schaltenden Lehrstuhlinhaber ‚herumgebaut‘ wird, ist immer noch der Normaltyp.
Daß es sich dabei um ernstzunehmende Hemmnisse für den weiteren großzügigen Ausbau der deutschen Universitätsforschung handelt, darauf deutet die zunehmende Abwanderung der aktivsten und begabtesten wissenschaftlichen Nachwuchskräfte in Industrie und Wirtschaft hin oder in freier organisierte Hochschulinstitute des Auslands, Wie die bei Anger (Probleme der deutschen Universität), mitgeteilten Befragungsergebnisse bestätigen, beruht diese Abwanderung nicht in erster Linie auf der in der Wirtschaft oder im Ausland gebotenen höheren Bezahlung, sondern in vielen Fällen spielt dabei die Hauptrolle, daß selbst in einigen Industrie-Forschungsstätten dem Wissenschaftler oft ein größerer Spielraum für eigene, langfristige Forschungsvorhaben geboten wird als in den kleinen, unzureichend ausgestatteten und von Lehrstuhlinhabern reglementierten Universitätsinstituten. (78)
II.1.2 Die ‚Betriebsideologie‘ der Hochschule
Zur Rechtfertigung der gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse in den Hochschulen hat sich jedoch eine eigenartige 1 Betriebsideologie‚ herausgebildet, in der sich konservativzünftlerische mit moderneren industriell - betriebstechnischen Elementen vermischen:
- Es wird auf die Betriebsorganisation in der Wirtschaft und Industrie hingewiesen: die heute erforderlichen umfangreichen Betriebsmittel und die Vergrößerung der Beschäftigtenzahl machten eine straffe ‚Institutsdisziplin‘ und alleinverantwortliche Direktion durch einen einzigen Betriebsführer unerläßlich. Nimmt man aber die Forschungsabteilungen moderner Industriebetriebe zum Maßstab, so sind ihnen gegenüber die meisten Universitätsinstitute auf einer frühen, niederen Stufe industriell-kapitalistischer ‚Produktionsverhältnisse‘ stehen geblieben: Das traditionelle Lehrstuhl-Institut hat den Charakter eines Klein-Unternehmens, das isoliert von der Konkurrenz und den benachbarten ‚Branchen‘ arbeitet. Und wenn es nicht mehr die dementsprechende Größe hat, sondern zum ‚Großbetrieb‘ angewachsen ist, wie einige naturwissenschaftliche Institute und Kliniken, so ist es doch immer noch nach dem Organisationsschema des Kleinbetriebs strukturiert.
- Immer noch wird das aus der mittelalterlich-frühneuzeitlichen Zunftordnung überkommene Prinzip des befugten und privilegierten „Fachvertreters“ aufrechterhalten: es wird eine geistig-organisatorische Einheit, die „Wissenschaftsdisziplin“, das „Fach“ vorausgesetzt, dessen verantwortliche „Vertretung“ nach außen, gegenüber der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, und nach innen, im Rahmen der Hochschule, nur einem dazu Privilegierten, dem betreffenden Lehrstuhlinhaber, obliegt, während sich die anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter auf die wissenschaftliche Arbeit selbst bzw. auf den Unterricht zu beschränken haben, ohne das Recht zur „Verkündung“ von Forschungsergebnissen (in der Vorlesung, im Lehrbuch oder in der Studie, die offiziell der Professor herausgibt und verantwortet) zu besitzen, denn als ‚Gesellen‘ sind sie noch nicht von der wissenschaftlichen Zunft mündig gesprochen.
Die Funktion des kapitalistischen Betriebsführers oder managers wird in dieser Konzeption verschmolzen mit der des patriarchalisch-autoritativen Zunftmeisters des Faches. Vorbürgerlicher Universitätsfeudalismus und spätbürgerlicher Industrie- und Betriebsfeudalismus gehen nahtlos ineinander über. „Das ist die rationale Folge der immanenten Logik des wirtschaftlichen Prozesses selbst. Bei höchstem Stand der Technik werden vorbürgerliche, absolutistische Elemente wiederholt.“ (79)
II.1.3 Akademische Selbstverwaltung oder akademisches Herrschaftssystem?
Ist die Struktur der wissenschaftlichen Betriebe auf einer frühen Stufe kapitalistisch-industrieller Betriebsverhältnisse stehen geblieben, so sind in der Verfassung der akademischen Selbstverwaltung z.T. noch Elemente der vorbürgerlich-ständischen Zunftverfassung konserviert, wie sie z.B. vor zweihundert Jahren im Preußischen Allgemeinen Landrecht fixiert worden sind.
Die mittelalterlich-ständische Gelehrten- und Scholarenzunft, die „universitas doctorum, magistrorum et scholarium“ (80) hatte jedoch eine völlig andersartige soziale Funktion als die bis heute konservierten zunftartigen akademischen Organe. Denn ihr fehlte der im 19. Jahrhundert errichtete Unterbau der Institute: sie hatte einen echt-genossenschaftlichen Charakter; die Genossenschaften der Professoren und die der Scholaren (gegliedert in Landsmannschaften) standen sich unabhängig gegenüber.
Durch den geschilderten Prozeß der Industrialisierung der Wissenschaft, der Trennung des Wissenschaftlers von seinen ‚Produktionsmitteln‘, erhielt eines dieser genossenschaftlichen Gebilde, die Professorenschaft mit ihren Organen - Fakultäten, Dekane, Senat, Rektor - die Funktion eines Herrschaftsinstruments der wissenschaftlichen ‚Produktionsmittelbesitzer‘ über die nichtbesitzenden, abhängigen Wissenschaftler und Studenten.
So wie der Lehrstuhlbesitzer über sein Institut verfügt, so haben die Universitätsorgane der Professorenschaft die Gesamthochschule in ihrem Besitz. Der Hochschulzweck wird zum Privatzweck, „zu einem bloßen Machen von Karrieren“ (81).
Was Marx über den Charakter der Bürokratie sagt, das trifft auch auf diese Oligarchie der Lehrstuhlinhaber und ihre Verwaltungsorgane zu:
„Der allgemeine Geist der Bürokratie ist das Geheimnis, das Mysterium, innerhalb ihrer selbst durch die Hierarchie, nach außen als geschlossene Korporation bewahrt.“ (82)
„Der Besitz dieser einmal gewonnenen Monopolstellungen aber wird von ihren Inhabern verteidigt mit allen Mitteln unter der Sonne: Religion, Moral, Legenden, Fiktionen.“ (Prof. Eduard Baumgarten in seiner Rede vor dem Hochschulverband (Juli 1960) in Bezug auf die Hochschulverfassung.) (83)
Obwohl die kollegialen Organe der Professorenschaft Herrschaftsinstrumente sind, wird ihre Herrschaftsgewalt jedoch gleichzeitig durch den Partikularismus der Institutsdirektoren ausgehöhlt.
Die im traditionellen akademischen Verfassungswesen eigentlich gar nicht vorgesehenen und nicht erfaßten Institutsdirektoren mit ihrer Verfügungsgewalt über einen großen Personal - und Sachetat überspielen mehr oder weniger deutlich die akademischen Organe. Sie schließen z.B. selbständig Verträge mit staatlichen und privaten Stellen ab, die z.T. die Forschungsrichtung auf Jahre festlegen, ohne daß die akademischen Organe darüber eine Kontrolle ausüben könnten. Die innere Ordnung des Instituts ist natürlich ebenso eigene Angelegenheit des Direktors.
Daher bestehen die Hauptfunktionen der akademischen Organe der Professorenschaft nicht in der Verwaltung des eigentlichen Wissenschaftsbetriebs- das bleibt den Institutsdirektoren überlassen -oder in der Planung und Koordinierung der Forschung - das verhindert meist die selbstherrliche Art der Lehrstuhlbesitzer - sondern in mehr äußerlichen Zwecken, wodurch diese eigentlich personale und genossenschaftliche Selbstverwaltungsform zum bloßen mechanischen Verwaltungsapparat herabsinkt. Die akademische Selbstverwaltung ist gegenwärtig
– a) ein Mechanismus, der die äußere Organisation und Koordinierung der Lehrveranstaltungen in den Fakultäten regeln soll
– b) eine Karriere-Institution, die in geheimen Sitzungen über die Laufbahn wissenschaftlicher Nachwuchskräfte entscheidet
– c) eine Prüfungsbehörde
– d) das Aufsichtsorgan der Studentenschaft
– e) Vertretung der Ordinarien als Arbeitgeber gegenüber den Assistenten und Angestellten. (84)
Diese Verwaltung hat also mit dem Vollzug von Forschung und Lehre und seinen Anforderungen relativ wendig zu tun. Sie hat vor allem eine gesellschaftliche Funktion als Instrument der Herrschaft über die abhängigen Wissenschaftler und Studenten.
III.1.4 ‚Akademische Obrigkeit‘ und Staatsmacht
Durch die Beamtenstellung des Lehrstuhlinhabers erlangt dieser einerseits Anteil an der staatlichen Herrschaft, in dem der Staat als Kapitalgeber ihn zum selbstherrlich schaltenden Verwalter der Betriebsmittel macht, und zwar auf Lebenszeit, andererseits wird er nach den immer noch vorherrschenden obrigkeitsstaatlichen Verfassungstheorien ein ‚Staatsdiener‘ mit besonderer Treueverpflichtung, der einen Teil seiner Grundrechte nicht ausüben darf. Hier wird deutlich, daß die Machtstellung des Institutsdirektors nur abgeleitete, delegierte Macht der ‚Obrigkeit‘ ist. In seiner Stellung als Institutsleiter spielt er nur eine eingebildete Kapitalistenrolle, denn nach dem nach wie vor obrigkeitsstaatlichen Stil der Staatsverwaltung kann der Institutsdirektor staatlichen Weisungen unterworfen werden. Durch die gegenwärtige Form der staatlichen Finanzierung der Hochschulen wird er auch von zahlreichen Dienststellen der staatlichen Bürokratie abhängig, die auf dem Wege über die Mittelbewilligung für zahlreiche spezielle Bedürfnisse auch Forschung und Lehre beeinflussen.
Zweitens wird die akademische Selbstverwaltung durch ihre soziale Aufsichtsfunktion gegenüber der Studentenschaft immer wieder in die Rolle des staatlichen Herrschaftsinstruments gedrängt:
Indem die akademischen Organe die freie politische Betätigung und Opposition der ökonomisch abhängigen und politisch bevormundeten Studenten und Assistenten einschränken, indem sie eine Zensur über die Studentenpresse ausüben, politische Veranstaltungen der ‚akademischen Bürger‘ nach Belieben untersagen, machen sie sich selbst zum Instrument des staatlichen Herrschaftsapparates.
III.1.5 Die Stellung der Studentenvertretung im akademischen Herrschaftssystem
Durch die Polarisierung der akademischen Bürgerschaft in Besitzer und Nichtbesitzer der wissenschaftlichen Betriebsmittel haben die Studentenvertretungen innerhalb des akademischen Herrschaftssystems die Stellung einer einflußlosen, von der akademischen Obrigkeit lizensierten und durch die Satzung institutionalisierten Opposition, die jedoch eigentlich als Fremdkörper im System empfunden wird. Sie steht in ihrer sozialen Funktion als Interessenvertretung der Studenten den akademischen Organen der Professorenschaft wie ein Betriebsrat ohne jedes Recht auf Mitbestimmung gegenüber, wirkt jedoch wie ein solcher Betriebsrat teilweise stabilisierend für das System, indem ihr zweitrangige Aufgaben zur Erledigung übertragen werden., Ihre bloße Existenz dient als Alibi der Oligarchie der Ordinarien, als scheinbarer Beweis des genossenschaftlichen Charakters der Universität.
III.2 Zur Verfassungsideologie der deutschen Universität
Als repräsentative Fassade und zugleich als ideologische Stütze wurde jedoch von der geschilderten autoritären Verfassungswirklichkeit der Hochschule eine akademische ‚Verfassungsideologie‘ konserviert, der einst, als sie noch nicht zum bloßen Etikett einer rein formalen Autonomie des Hochschulbetriebs geworden war, ein realer geistiger und politischer Sinn zugrunde lag.
III.2.1 Das Modell der Universitätsverfassung in der historischen Entwicklung
Die gegenwärtige Apologetik der autoritär erstarrten Hochschulverfassung ist das Produkt eines verzweigten historischen Entwicklungszusammenhangs, in dessen Verlauf sich im Grunde zwei gegensätzliche ideologische Modelle vom Sinn und Umfang akademischer Freiheit und Selbstverwaltung schließlich in einer Mischform auflösten, die faktisch hinter den theoretischen Anspruch beider Ausgangspunkte zurückfiel.
Diese beiden Positionen in der Auseinandersetzung um die Stellung der Universität in der Verfassungs- und Gesellschaftsordnung lassen sich bezeichnen als -
das Modell einer Universität als Anstalt eines obrigkeitlichen Kulturstaates;
das Modell eines Universität als Personenverband im Rahmen eines bürgerlich-liberalen Rechtstaates.
Schon die Auffassung der Gelehrten, die an der Berliner Universitätsgründung führend beteiligt waren, polarisierten sich in dieser Frage. Während Humboldt und Fichte die akademische Freiheit der Professoren und Studenten nur als rein geistige, aber um so absolutere, völlig staatsfremde Freiheit in einem privilegierten Raum der „Einsamkeit und Freiheit“ verstanden wissen wollten, der aber vom Staat - faktisch von dem in Preußen ausgeprägten Obrigkeitsstaat -institutionell in der Form einer Staatsanstalt schützend umschlossen und von einer konzipierten vorbildlichen Unterrichtsverwaltung ‚gepflegt‘ werden sollte, ging es Schleiermacher in seinen „Gelegentlichen Gedanken über Universitäten im deutschen Sinne“ von vornherein darum, unter Aufnahme alter korporativer Traditionen die Universität in der Art eines wissenschaftlichen Vereins, einer Gelehrtenkorporation, zum Bollwerk der akademischen Freiheitsrechte gegen den Staat, im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft, auszubauen.
Das Ergebnis war ein ‚Kompromiß‘, in dem zwar die noch heute bestehende und an noch ältere Formen anknüpfende Organisation der akademischen Selbstverwaltung entstand (die weitgehend von Schleiermacher konzipiert wurde), jedoch ohne daß die gesellschaftliche Stellung der Universität noch das Wesen des preußischen Staates diesem Konzept entsprochen hätten. Ohne den Lebensraum einer politisch sich emanzipierenden bürgerlichen Gesellschaft blieb die ‚Akademische Selbstverwaltung‘ Instrument des Obrigkeitsstaates, der sich nicht zum weltoffenen ‚Kulturstaat‘ sublimierte, sondern schließlich zum nationalen Machtstaat sich auswuchs. Akademische Freiheit galt als (unpolitisches) Privileg, das an die ‚zünftige‘ Wissenschaft, die Oligarchie der Ordinarien verliehen wurde, und in dessen Genuß auch die Studenten in einem begrenzten Umfang gelangen sollten.
Mit der bürgerlichen Revolutionsbewegung von 1848, die besonders von der Studentenbewegung und einer liberal gesinnten Professorenschaft vorangetrieben wurde, schien sich ein neuer (politischer) Begriff der akademischen Freiheit durchzusetzen. Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und Lehre wurde nicht mehr als Privileg einer Zunftoligarchie angesehen, sondern als Bestandteil der allgemeinen bürgerlichen Freiheitsrechte des Individuums im Rahmen eines bürgerlich-liberalen Rechtsstaates. Die radikale Hochschulreformbewegung jener Jahre, deren Forderungen und Pläne z.T. heute noch nicht verwirklicht sind, hob die Universitätsselbstverwaltung in ihre Schutzfunktion für die Bewahrung der akademischen Freiheitsrechte vor Übergriffen der Staatsverwaltung wieder stärker hervor. Einem Verfassungsdenken, das sich an dem Modell einer Gesellschaft unabhängiger Privateigentümer orientierte - dem in der sozialen Wirklichkeit allerdings nur die schmale Schicht eines durch Besitz und Bildung ausgewiesenen Bürgertums entsprach - mußte eine möglichst freie Position des Gelehrten als ‚Privatdozent‘ oder doch eine Liberalisierung der Stellung der beamteten Professoren durch die Kooptationsfreiheit der Universitäten (gegen den staatlichen Oktroi) als erstrebenswert erscheinen.
Aber ebenso wie die Revolution blieb auch die Hochschulreformbewegung von 1848/49 eine Episode. Mit dem Gesinnungswandel der Professorenschaft von den liberalen Idealen von 1848 zur Betonung des „Nationalen“ im Sinne des Reiches von 1871 vollzog sich auch die Entleerung der akademischen Selbstverwaltungsformen zum rein technischen Verwaltungsinstrument des anwachsenden Universitätsbetriebs einerseits und zur repräsentativen Dekoration der Universitäten des Reiches andererseits (85). Akademische Freiheit und Autonomie verlor endgültig ihren politisch-progressiven Charakter, den sie in der Bewegung einer sich emanzipierenden bürgerlichen Gesellschaft gehabt hätte, verharrte stattdessen im a-politischen Raum der „Innerlichkeit“ des Gebildeten und der fiktiven „Objektivität“ des redlichen Gelehrten war aber damit hinterrücks zu „einer wunderbaren Stütze des preußisch-deutschen Obrigkeitsstaates“ geworden. (86)
In der Weimarer Republik ergab sich insofern eine andere Konstellation, als sich nun „nationale Universität“ und Studentenschaft als „nationale Elite“, als die angeblich wahrer. Repräsentanten des Nationalen zur autonomen Korporation gegen die Republik, gegen einen von der Sozialdemokratie beherrschten preußischen Staat zu konstituieren suchten. Denn: „Die dumpfen Gefühlsdemokraten der großen Massen werden überall dort, wo sie auftreten, die größten Feinde der rationalen Wissenschaft. “ (Max Scheler) „Das moderne Parlament ist offenbar nicht in der Lage, das Verhältnis von Staat und Wissenschaft so zu regeln, daß die Wissenschaft als solche dabei erhalten bleibt.“ (Arnold Köttgen, 1933).
III.2.2 Die Ideologie der „akademischen Gemeinschaft“
Von diesem historisch-gesellschaftlichen Hintergrund sind auch die neueren, gegenwärtig vorherrschenden Theorien des Hochschulrechts geprägt, die im Prinzip in der Weimarer Republik entwickelt wurden und eine bemerkenswerte historische Kontinuität aufweisen: Die Universitäts-Selbstverwaltung wird gesehen als Verbindung von völlig „unpolitischer“ Wissenschafts-Verwaltung durch die Hochschule als Staatsorgan mit einer korporativen berufsständischen Form der „akademischen Gemeinschaft“, im Rahmen und im Dienste der übergreifenden „nationalen Kulturgemeinschaft“ (87)
„Akademische Gemeinschaft ist einmal eine rein wissenschaftlich beinhaltete Einheit und als solche spezielle Verdichtung jener Raum und Zeit überspannenden größeren Gemeinschaft aller derer, die sich der wissenschaftlichen Wahrheit verpflichtet wissen. Akademische Gemeinschaft bedeutet aber zum anderen die innerhalb der übergreifenden nationalen Gemeinschaft gegebene ständische Einheit wissenschaftlich tätiger Personen. Nur in der einen Richtung ist die Universität, in der diese beiden Gemeinschaftsformen kunstvoll zu einem Ganzen verschlungen sind, autonome Körperschaft im Sinne einer spezifischen Distanz gegenüber Volk und Staat, während in der anderen die deutsche Universität stets nationale Universität gewesen ist.“ (Arnold Köttgen) (88)
Die Studenten sind demgemäß der Hochschule als Repräsentanz und Organ jener „nationalen Gemeinschaft“ zu Treue und Hingabe verpflichtet, während die Professoren als Beamte direkt dem Staat verpflichtet sind, der ihnen bei einer etwaigen politischen Betätigung die gebotene „Zurückhaltung“ auferlegt.
„Nur insoweit besteht zwischen dem Status des Beamten und dem des Studenten etwas Gemeinsames, als der Pflichtenkreis auf das Privatleben beider ausstrahlt und die komplexe Pflichtenbindung die ganze Persönlichkeit ergreift … Der Student ist als solcher also kein Privatmann! Seine Aufgabe gegenüber der staatlichen Gemeinschaft ergibt sich daraus, daß er sinnentsprechend nur dann zu studieren vermag, wenn er sich als aktives, d.h. aber zugleich als mitverantwortliches Glied der Hochschule weiß und an ihrer fortdauernden Sinnverwirklichung mitwirkt. Nur dann kann die Universität sein, was sie sein will und sein soll: die auf eine ganz besondere Art im staatlichen Lebenszusammenhang dargestellte … Repräsentanz der nationalen Kulturgemeinschaft. Auch jeder Student ist Mitträger dieser Repräsentationsaufgabe. Sein Verhalten erscheint darum als Verhalten der Hochschule. Er ist aus diesem Grunde seiner Hochschule zur Treue verpflichtet.“ (89)
Anstelle des auf ein Publikum gebildeter Privatleute bezogenen Arguments tritt die repräsentierende Darstellung der „nationalen Kulturgemeinschaft“.
Die Verfassungsideologie von der „akademischen Gemeinschaft“ dient jedoch nicht nur als Mittel zur Einordnung der Universität in das staatliche Herrschaftsgefüge, zur Bindung der akademischen Bürger an die Staatsmacht, sondern sie wird auf die innere Struktur der Hochschule projiziert und dient hier als Rechtfertigung der autoritären Verfassungswirklichkeit. Denn die Identität von Staatsmacht und akademischer Selbstverwaltung stellt sich fast reibungslos ein im Falle der privilegierten Ordinarien, die ihre Aufgaben als rein a-politische Wissenschaftsverwaltung deklarieren. Opposition wird jedoch vermutet in einer Studentenschaft, deren Vertreter ihre Aufgabe auch in der legitimen Teilhabe am Prozeß der politischen Willensbildung in der Gesamtgesellschaft sehen. „Sand im Getriebe“ des Wissenschaftsbetriebes wird befürchtet bei studentischer Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung.
Der Kern der akademischen Gemeinschaftsideologie, die solchen studentischen Ansprüchen entgegengehalten wird, ist die Transponierung der im Rahmen einer Demokratisierung der Gesellschaftsordnung die Tendenz zur Ausweitung nach unten in sich trägt, in die Ebene des rein „Geistigen“ und „Symbolischen“:
„Wahrheitsergriffenheit beruht auf persönlicher Hingabe an die Erkenntnis als Dienst an der Wahrheit. Im wissenschaftlichen Bereich steht also jeder neben jedem und es schließt sich zunächst jedes Rangverhältnis unter den Beteiligten aus. Wissenschaftspflege beruht auf der geistig genossenschaftlichen Beziehung aller Glieder der Hochschule.“ (Hans Gerber) (90)
Die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden ist also zunächst nur Gemeinschaft „ im Geiste“, akademisches Bürgertum ist eine Art Geisteszustand, das Bewußtsein, einer geistigen Elite-Gemeinschaft anzugehören, aber ohne daß dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwelche konkreten Rechte und eine Beteiligung an der Verwaltung dieser Gemeinschaft begründet. Denn:
Der akademische Bürger ist nicht Abbild des Gemeindebürgers, das Rathaus ist kein Vorbild für Senat und Fakultäten. Die genossenschaftliche Form der Willensbildung symbolisiert hier lediglich den aus Gründen der Freiheit der Wissenschaft gebotenen Verzicht auf jegliche Hierarchie.“ (91)
Am mitgliedschaftlichen Charakter der Hochschule soll nach dieser Verfassungstheorie deshalb festgehalten werden, um sie von der Staatsanstalt abzugrenzen, faktisch: um die Verfügungsgewalt der Oligarchie der Ordinarien, die die akademischen Organe bilden, über die Hochschule und ihre Disziplinargewalt über die Studenten aufrechtzuerhalten. Daher sollen die Studenten und Nichtordinarien formell (und „geistig“) Mitglieder, „akademische Bürger“ sein, mit konkreten Pflichten gegenüber „der“ Hochschule (d.h. den Organen des sozialen Gebildes, dem sie angehören). Die Stellung der Nichtordinarien und Studenten in der Universität gleicht daher durchaus der unmündigen Stellung von Untertanen in einem Obrigkeitsstaat:
„Wie die Pflichten brauchen auch die Rechte keineswegs in Ansehung aller Glieder der Universität gleichmäßig bemessen zu sein. Voran steht die grundsätzliche Gleichberechtigung aller akademischen Bürger und erst von dieser jede äußere Einmischung abwehrenden Position können dann interne Differenzierungen vorgenommen werden.“ (92)
Von diesem Ausgangspunkt hat dann z.B. Hans Gerber eine näher begründete Verfassungstheorie der abgestuften Mitgliedschaftsrechte entwickelt:
Die Universität sei zwar durch eine genossenschaftliche Selbstverwaltung ausgezeichnet, aber es gelte, das Genossenschaftliche vom Formaldemokratischen abzugrenzen. Die akademische Genossenschaft sei nur legitimiert durch das ihr gemeinsame Gut der „Wahrheitspflege“. Daher müsse sie auch ihre Glieder von der Wahrheitspflege her organisatorisch qualifizieren. In diesem Sinne sei der Lehrende grundsätzlich von Lernenden geschieden; auch die Grenzen zwischen wissenschaftlichen Meistern, Gesellen und Lehrlingen (Ordinarien, Nichtordinarien, Assistenten) müßten erhalten bleiben. Unter diesem Gesichtspunkt sei die Forderung nach Mitbestimmung von Studentenvertretern in den akademischen Organen abwegig. (93)
III.2.3 Studentische „Mitverantwortung“ als Element der Verfassungsideologie
Aber auch weiterreichende Interpretationen der studentischen „tVerantwortung“ in der Hochschule lassen sich daraus in den Rahmen dieser pseudo-genossenschaftlichen Verfassungsideologie einordnen, denn die Studentenvertretung erfüllt ihre Funktion in diesem System, indem sie die mitgliedschaftliche „Homogenität“ nach außen, zur Wahrung der Hochschulautonomie, sichtbar macht. Aus diesen Erwägungen heraus wurde von Prof. Arnold Köttgen schon 1933 eine Konzeption der studentischen Mitwirkung am Prozeß der akademischen Willensbildung entwickelt, über die die gegenwärtigen Forderungen des VDS im theoretischen Ansatz keineswegs herausreichen. (94)
Er forderte, „die schon heute im Prinzip bestehende korporative Zugehörigkeit der einzelnen Studenten zum Verband der Universität durch Verleihung aktiver Mitwirkungsrechte nun auch im Prozeß der akademischen Willensbildung nach außen in Erscheinung treten zu lassen. Der Idee nach ist der Student niemals, wie häufig behauptet worden ist, Objekt der Universitätsarbeit, sondern immer mitverantwortlicher Genosse gewesen. Nur darf nie vergessen werden, daß der Genossenschaftsgeist der deutschen Universität sich in erster Linie auf wissenschaftlichem Gebiet zu bewähren hat.“ (Hervorhebungen vom Verfasser) Im Einzelnen wird dann an die in einigen Universitäten schon seit langer Zeit verwirklichte Rektorwahl unter symbolischer Beteiligung von Studenten erinnert und die „Zuziehung studentischer Vertreter“ zu den Senatssitzungen und zu einzelnen akademischen Ausschüssen und den Studentendisziplinargerichten vorgeschlagen.
Die „Zuziehung“ von Studentenvertretern zu den Sitzungen des Senats und zu einigen Ausschüssen sollte die Inkorporierung der Studentenschaft in die Universität stärker nach außen (gegenüber dem Staat) dokumentieren, um den körperschaftlichen Charakter zu betonen und sollte ferner den „genossenschaftlichen Geist“ der Universität symbolisieren, ohne daß dadurch das akademische Herrschaftssystem, die Ordinarienoligarchie, auch nur im geringsten angetastet wurde.
Wenn sich selbst diese Konzeption studentischer Mitverantwortung bei den maßgeblichen Hochschulrechtlern in der Bundesrepublik nicht durchsetzen konnte, und wenn Köttgen selbst diese Frage heute völlig offen läßt und die Studentenvertretung auf „die Erledigung eigener Angelegenheiten“ verweist, so ist das vor allem ein Indiz für die veränderte und komplizierte politisch-gesellschaftliche Frontstellung:
Es stehen sich nicht mehr eine republikfeindlich und vom „Korpsgeist der Frontgeneration“, vom „Genossenschaftsgeist der Armee“ erfüllte Studenten- und Dozentenschaft und ein von der Sozialdemokratie beherrschter preußischer Staatsfeindlich gegenüber, die Studentenschaft kämpft nicht mehr durch „nationalpolitische Erziehung“ (einschließlich Wehrertüchtigung) gegen den „Parteienstaat“ und seine „formaldemokratische Staatsauffassung“, (95) sondern innerhalb der Universität, wie auch innerhalb der Staatsordnung der Länder rivalisieren liberal- und sozialdemokratische mit konservativ-autoritären und nationalistischen politischen Kräften.
Die Ansätze zu theoretischen Begründungen einer studentischen Mitbestimmung in der akademischen Selbstverwaltung, die in der Bundesrepublik von studentischer Seite bisher entwickelt worden sind, halten sich ebenfalls durchaus im Rahmen des traditionellen Hochschulverfassungssystems und berufen sich auf die herrschende Hochschulrechtslehre.
So ist man auch bei den Beratungen auf dem 6. Deutschen Studententag über „Autonome Selbstverwaltung und Obrigkeitsdenken“ (96) der Theorie der „abgestuften Mitgliedschaftsrechte“ gefolgt: „Erst wenn die Universitätsorgane Vertretungsorgane aller Universitätsangehörigen und nicht nur einer bevorzugten Minderheit sind, sind die Universitätsorgane legitimiert, im Namen aller Universitätsangehörigen zu sprechen. Dabei ist selbstverständlich nicht eine völlige „Gleichmacherei“ gefordert, abgestufte Mitgliedschaftsrechte sind mit dem korporativen Charakter, der Universität vereinbar.“
Der VDS und die Studententagsteilnehmer sind bei ihren Bemühungen um die Demokratisierung der Hochschulverfassung noch auf halbem Wege stehengeblieben. Es werden abstrakte Forderungen mit unzureichenden praktischen Improvisationen verknüpft: Einerseits wird gefordert, „die Assistentenschaft und die Studentenschaft“ sollten „gleichgeachtete und gleichberechtigte Glieder der Universitätskorporation“ sein, andererseits beschränkt man sich auf die Forderung nach „weitgehender Hinzuziehung von Rede- und stimmberechtigten Studentenvertretern zu den Sitzungen der akademischen Gremien“ bei allen Universitätsangelegenheiten (mit einer Liste von Ausnahmen).
Aber selbst die volle Mitg1iedschaft von ein oder zwei Studentenvertretern in den akademischen Gremien und ihre Mitwirkung an allen Universitätsangelegenheiten, ist mit der autoritären oligarchischen Struktur der gegenwärtigen Hochschulverfassung durchaus vereinbar, wie das Beispiel der Freien Universität nach 12jähriger Erprobung zeigt. Auch hier kann - wie an der Westdeutschen Universitäten - der Rektor mit Zustimmung der Mehrheit des Senats, ungehindert durch die vielgerühmte Mitwirkung der Studentenvertreter, Verbote gegen Veranstaltungen der Studentenvertretung oder studentischer Gruppen, gegen Unterschriftensammlungen unter der Studentenschaft erlassen, auch hier wird die Universitätsordnung, die die Disziplinargewalt über die Studenten und Zulassungsfragen regelt, einseitig vom Senat erlassen, notfalls auch gegen den erklärten Willen der Studentenschaft. Auch die heute an der FU geübte Form der studentischen Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung ist bloß formelle Mitwirkung minderen Rechts.
Die Oligarchie der Ordinarien bleibt in ihrer Vorherrschaft unangetastet. In den Instituten bestimmen allein die Direktoren. Die Assistentenschaft ist völlig von der Mitbestimmung ausgeschlossen.
Das Stimmrecht von ein oder zwei Studenten, die noch dazu an keine Weisungen gebunden sind, bleibt ein rein formeller Akt, der die tatsächlichen Verhältnisse verschleiert und den Anschein einer echten Mitbestimmung der Studentenschaft hervorruft, während es sich praktisch nur um eine, wenn auch nicht zu unterschätzende und oft fruchtbare, gemeinsame Beratung handelt.
(Es soll damit nicht über den Nutzen hinweggesehen werden, der in der Teilnahme von ein oder zwei studentischen Sprechern an den Sitzungen der Professoren zu erblicken ist; aber die darum gebildeten Legenden, durch die die FU zum Modell einer demokratischen Hochschulverfassung gemacht wird, müssen wir zurückweisen.)
III.3 Thesen zur Demokratisierung der Hochschule
Die Analyse der Verfassungswirklichkeit der Universität hat gezeigt, daß sich der Universitätsbetrieb nicht nur in seinen faktischen Zielen und Arbeitsergebnissen zunehmend blind an die aus der Gesellschaft und dem Staatsapparat kommenden Bedürfnisse anpaßt, sondern daß auch die Arbeitsverhältnisse innerhalb dieses Betriebs sich im Prinzip kaum von denen anderer Betriebe unterscheiden. Wie dort stehen sich auch in der Hochschule „management“, mit Verfügungsgewalt über die Arbeitsmittel und abhängige, von ihren Arbeitsmitteln getrennte Arbeiter gegenüber.
Aber gerade in der Universität wird, wie sonst kaum in einem anderen Betrieb, die tiefe Kluft deutlich, zwischen dem Anspruch einer Demokratie, die Gesellschaft mündiger Menschen zu verwirklichen, und der gesellschaftlichen Wirklichkeit der autoritären Arbeitsverhältnisse und sachfremden Herrschaftsstrukturen.
Gelingt es, diese Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Universität bewußt zu machen so scheint die Demokratisierung verstanden als Aufhebung sachfremder Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der Hochschulen noch eher eine Chance zu besitzen als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die dem eigentlichen Kern der heutigen Herrschaftsverhältnisse - der Verfügungsgewalt über die zentralen Produktions- und Manipulationsmittel - näher stehen. Dort stößt selbst eine beschränkte Selbstbestimmung der Produzenten im Sinne einer „Wissenschaftsdemokratie“ auf den erbitterten Widerstand der privaten Machthaber.
Zumindest deuten die bereits verwirklichten Ansätze und Experimente von demokratisch selbstverwalteten Hochschulen in den USA und in Lateinamerika daraufhin, daß Klassengesellschaft und innere Demokratisierung der Hochschule einander nicht prinzipiell auszuschließen.
Wenn daher im folgenden die volle Herstellung und Sicherung von Freiheit der Forschung und Lehre und der Autonomie der Hochschule gefordert wird, so erstens, weil diese rechtstaatlichen Schutzvorrichtungen angesichts der zunehmenden autoritären Tendenzen des Staatsapparates und gesellschaftlicher Machtgruppen eine erhöhte „existenzielle“ Bedeutung für einzelne Wissenschaftler erlangen, die aus politischen Motiven ausgeschaltet werden sollen (97); zweitens auch, weil nur dadurch die Chance einer inneren Demokratisierung der Hochschule durch die Aktivität verantwortungsbewußter Studentenvertretungen und Hochschullehrer erhalten werden kann.
Wenn Professoren und Studenten die zu Beginn formulierte Aufgabe, sich über den Charakter ihres Tuns und die Ziele von Wissenschaft und Universität neu zu verständigen, ernstnehmen, so müssen sie erkennen, daß die Hochschule nur dann zur Verwirklichung ihres ursprünglichen Anspruchs in der gesellschaftlichen Entwicklung fähig ist, wenn sie damit bei sich selbst beginnt:
Die Erfüllung einer jetzt nur formalen Autonomie vom Staat durch die selbstbewußte Distanz beim Vollzug ihrer vielgestaltigen Funktionen in der Gesellschaft ist der Universität nur möglich, wenn sie in ihrem eigenen Betrieb und Arbeitsprozeß jedem Einzelnen seine freie Entfaltung und demokratische Beteiligung gewährleistet. Wenn irgendwo, so ist in der Universität „die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller.“
Die Unabhängigkeit der Hochschule in Staat und Gesellschaft aber ist die Voraussetzung ihrer inneren Demokratisierung - und umgekehrt. Beides zusammen ermöglicht erst ihre kritische Funktion gegenüber der Gesellschaft.
III.3.1 Autonomie und Selbstverwaltung der Hochschule
Nur wenn die Hochschule alle mit ihrem Betrieb zusammenhängenden Angelegenheiten in eigener Verantwortung demokratisch selbst bestimmt, können daher Angriffe des Staates und gesellschaftlicher Kräfte auf die Freiheit im Bereich der Universität wirksam abgewehrt werden.
Diese erstrebte Freiheit der Universität sollte jedoch nicht mißverstanden werden als verantwortungslose Freiheit von Staat und Gesellschaft. Sie ist Unabhängigkeit vom Staatsapparat und den herrschenden gesellschaftlichen Kräften im Interesse der gesamten Gesellschaft.
Denn bevor nicht die Erfüllung der in allen Verfassungsnormen postulierten Prinzipien der sozialen Demokratie in allen Bereichen der Gesellschaft ermöglicht wird, müssen wenigstens die bestehenden demokratischen Verbände und Selbstverwaltungskörperschaften geschützt und ausgebaut werden. Daher ist besonders in allen Institutionen der Kultur- und Bildungswesens in den Schulen, in der Presse, den Rundfunk- und Fernsehanstalten, nicht nur in den Hochschulen, die Stärkung der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung anzustreben.
III.3.2 Demokratisierung der Hochschulverfassung
Eine wirkliche Demokratisierung der inneren Struktur der Hochschule wird durch eine symbolische „Mitverantwortung“ der Nichtordinarien und Studentenvertreter für die Beschlüsse der Ordinarien nicht erreicht. Aus der Analyse der Arbeitsverhältnisse und der Betriebsstruktur ergibt sich vielmehr, daß auch in der Hochschule die Verfügungsgewalt über die Arbeitsmittel und die Entscheidung über die Bedingungen und Ziele der Arbeit die eigentlich entscheidenden Fragen sind.
Demokratisierung der Hochschule bedeutet Aufhebung aller sachfremden Herrschaftspositionen und Abhängigkeitsverhältnisse in allen ihren Betrieben. Sie verwirklicht sich erst durch die gleichberechtigte Teilhabe der Dozenten, Assistenten und Studenten an der Verfügungsgewalt über die wissenschaftlichen Arbeitsmittel und an der Entscheidung über alle Universitätsangelegenheiten.
Die verschiedenen Rechte und Pflichten der Hochschullehrer, Assistenten und Studenten, die sich aus der Suche, aus Ihren naturgemäß verschiedenen Aufgaben ergeben, werden dadurch nicht berührt. Die aus den unterschiedlichen Aufgaben erwachsenden Sonderinteressen der drei Gruppen müssen auf dem Wege demokratischer Willensbildung und in gegenseitiger Achtung und Solidarität zu einem Ausgleich gebracht werden, ohne daß dabei eine der Gruppen von den anderen majorisiert werden darf.
Es spricht nicht für die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn solche Grundsätze zur Demokratisierung der Hochschule einen fast utopischen Eindruck hinterlassen, sind sie doch selbst nur der Versuch der Konkretisierung eines Anspruchs auf Freiheit und Demokratie, den auch die gegenwärtige Gesellschaftsordnung in ihren Verfassungsnormen für sich als verbindlich ausgibt.
Mögen die realen gesellschaftlichen Machtverhältnisse jenem Anspruch auch noch so sehr Hohn sprechen, so bleibt doch die Chance, daß im Bewußtsein der Menschen, nicht zuletzt der verantwortungsbewußten Hochschullehrer und Studenten, sich die fixierten Normen der Verfassung als kritisches Korrektiv gegen die autoritären Verhältnisse wenden. Um solches Bewußtsein der Spannung von Anspruch und Wirklichkeit weiter zu stärken, muß der Versuch unternommen werden, die Verfassungsnormen des Grundgesetzes auch in Bezug auf die Hochschulen beim Wort zu nehmen.
In der gegenwärtigen Phase der Auseinandersetzung um die Demokratisierung der Hochschulen reicht über die das ständige Wiederholen der studentischen Forderungen nach Sitz und Stimme in Senat und Fakultäten nicht aus, sondern es ist die Entwicklung einer neuen Theorie der Hochschulverfassung erforderlich, die den Aufgaben der Universität in der Gesellschaft und den -Verfassungsnormen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates gerecht wird.
Die im Folgenden entwickelten Thesen zur Theorie der Hochschulverfassung und des Hochschulrechts in der sozialen Demokratie sind nur als ein Diskussionsbeitrag zu einer Neuordnung des Hochschulrechts zu werten, die erst noch geleistet werden muß, und können in keiner Weise beanspruchen, mit der „herrschenden Meinung“ übereinzustimmen. Im Gegenteil: sie gehen von der Behauptung aus, daß die immer noch vorherrschende formalrechtsstaatliche Theorie des Hochschulrechts dem Wesen des Grundgesetzes unangemessen ist.
III.4 Zur Theorie des demokratischen und sozialen Rechtsstaates
Die Bundesrepublik soll nach ihrem Grundgesetz ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat sein. (Art. 20, Abs. 1)
In Art. 28., Abs. 1, Satz 1 wird dieser Verfassungsgrundsatz als normative Bestimmung für die verfassungsrechtliche Ordnung der Länder wiederholt:
„Die verfassungsmäßge Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates, im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.“
Dieser Wortlaut macht deutlich, daß mit Art. 20 auf keinen Fall eine unverbindliche deklaratorische Namensgebung beabsichtigt ist. Wie das Bekenntnis zur unantastbaren Würde des Menschen in Art. 1 ist Art. 20 durch den Art. 79, Abs. 3 der Verfassungsänderung entzogen. Aber:
„Es handelt sich nicht um einen unmittelbaren anwendbaren Rechtssatz, sondern um einen Rechtsgrundsatz, der das Grundrechtssystem legitimieren und In seiner Anwendung, durchdringen soll.“ (98)
In der verfassungsrechtlichen Diskussion um die Interpretation dieses Verfassungssatzes hat es zuerst Wolfgang Abendroth unternommen, den Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaates als Einheit zu fassen, im Gegensatz zu den zahlreichen Versuchen, die Bestandteile dieser Formulierung isoliert voneinander herauszustellen (Begriffe der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaatlichkeit additiv zusammenzufügen) oder willkürlich nur zwei Bestandteile miteinander zu kombinieren (rechtsstaatliche Demokratie sozialer Rechtsstaat) (99).
„Dieser unaufhebbare Verfassungsgrundsatz … bildet daher ein Strukturprinzip der verfassungsrechtlichen Ordnung. Er verbindet drei gedankliche Elemente zu einer Einheit. Sie werden dadurch zu Momenten in dieser Einheit, die einander durchdringen und isolierter Interpretation nicht mehr zugänglich sind.“ (100)
„Der Begriff des ‚sozialen Rechtsstaates‘ steht in beiden Formulierungen des Grundgesetzes im Zusammenhang mit dem Moment der Demokratie. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. In der Verbindung dieser drei Momente ist die Rechtsgrundlage des Verfassungssystems zusehen.“ (101)
Damit ist die innere Dynamik dieses Strukturprinzips bloßgelegt. Die Bundesrepublik ist nicht nur ein formal-rechtsstaatlich gebundener, sozusagen konstitutioneller Wohlfahrtsstaat, ein Staat der Daseinsvorsorge und der sozialen Gerechtigkeit, d.h. ein besonderes System der materiellen Güterverteilung, sondern sie soll zugleich ein demokratisch strukturierter Sozialstaat, eine soziale Demokratie sein.
Durch die volle Mithineinnahme des Prinzips der Demokratie in den Sozial- und Rechtsstaat kommt jedoch ein Element der Bewegung in dieses System: Rechtsstaat und Sozialstaat in der herkömmlichen Terminologie sind statische Systeme, die entweder nur formal oder quantitativ perfektioniert werden können. Demokratie dagegen „ ist nicht eine Staatsform wie jede andere. Ihr Wesen besteht vielmehr darin, daß sie die weitreichenden gesellschaftlichen Wandlungen vollstreckt, die die Freiheit der Menschen steigern und am Ende vielleicht ganz herstellen können. Demokratie arbeitet an der Selbstbestimmung der Menschheit, und erst wenn diese wirklich, ist jene wahr. “ (102)
„Noch die autoritär verformten Einrichtungen, die bis heute relative Freiheiten politisch sichern helfen (z.B. die Hochschulselbstverwaltung, d. Verf.) haben diese Idee, nämlich die Tendenz zur Realisierung der Demokratie, gleichsam mit ins institutionelle Gehäuse hineingenommen. Demokratie verwirklicht sich erst in einer Gesellschaft mündiger Menschen.“ (103)
Das erscheint auf der Ebene des Verfassungsrechts in Gestalt eines „radikal-egalitären Demokratisierungsprozesses“, in der „fortschreitenden Aufnahme sozialer Grundrechte und sozialstaatlicher Prinzipien in die modernen Verfassungen“, wodurch „radikal-egalitäre Vorstellungen in zunehmendem Maße von der politischen Sphäre auf die des gesellschaftlichen Lebens übertragen werden. “ (Leibholz (104), der ebenfalls Sozialstaatlichkeit und Demokratie als Einheit versteht.)
Daran wird deutlich, daß der Verfassungsgrundsatz „demokratischer und sozialer Rechtsstaat“ keineswegs ein „Sein“ bezeichnen sollte, sondern ein „Sollen“. Die „verfassungsmäßige Ordnung“, die bei Inkrafttreten des Grundgesetzes noch gar nicht voll ausgestaltet sein konnte, soll diesem Grundsatz entsprechen. Der Parlamentarische Rat sah die Verwirklichung des Sozialstaates und der sozialen Demokratie als eine langfristige Aufgabe an.
Durch den Verfassungsgrundsatz von Art. 20 und 28 ist der Staat in mehrfacher Weise gebunden worden:
- Die „gesamte künftige Rechtsgestaltung“ durch den Gesetzgeber und ebenso die gestaltende Tätigkeit der Exekutive (der Regierung und der Verwaltung) der Bundesrepublik und der Länder sind dadurch gebunden.
- „Das gesamte geltende Gesetzes- und Verfassungsrecht im Geltungsbereich des GG ist … den Auslegungsregeln unterworfen, die sich aus diesem Grundsatz ergeben.
Der Verfassungsgrundsatz wird zur „Gestaltungsmaxime“ und zur „Auslegungsregel“.
III.5 Gestaltung der Gesellschaftsordnung im Sinne sozialer Demokratie
„Das Bekenntnis des GG zum demokratischen und sozialen Rechtsstaat eröffnet deshalb nicht nur den Weg zu gelegentlichen Staatsinterventionen, sondern stellt grundsätzlich die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zur Disposition der demokratischen Willensbildung des Volkes. Die konkrete Inhaltsbestimmung des Sozialstaatsmoments im Dreiklang der demokratischen und sozialen Rechtsstaatlichkeit in Art. 28 GG kann also nur dahin verstanden werden, daß der demokratische Gedanke sich in rechtsstaatlicher Weise in die Wirtschafts- und Sozialordnung projiziert.“ (105)
In letzter Konsequenz wird damit aber der bisherigen Form der formalrechtsstaatlichen Demokratie die Existenzfrage gestellt:
„Der bürgerliche Rechtsstaat muß entweder den liberalen zu einem sozialen Rechtsstaat entfalten und Demokratie als eine soziale verwirklichen - oder am Ende wiederum in die Formen eines autoritären Regimes zurückfallen.“ (106)
Denn in der gegenwärtigen Situation einer von unkontrollierten ökonomischen und politischen Kräften gelenkten Konsumgesellschaft bedeutet das Beharren auf der bloß formalen Demokratie die Auslieferung des Staates an solche Machtgruppen, die eine perfektere Absicherung der spätbürgerlichen Herrschaftsform durch Aufhebung von Demokratie überhaupt betreiben.
Auch das Grundgesetz ist auf der Basis eines Kompromisses in ihrer politischen Tendenz nicht übereinstimmender gesellschaftlicher Kräfte formuliert worden, von denen nur die eine Seite den Übergang zur sozialen Demokratie anstrebte. Der Verfassungskompromiß bestand darin,
- daß man sich auf ein für alle tragbares Minimum von Verfassungsprinzipien einigte und
- die Möglichkeit zu weitestgehender Ausgestaltung sozialer Demokratie ausdrücklich offen ließ (d.h. dem Gesetzgeber und damit der Majoritätsentscheidung des Volkes überließ).
Zu den Minimalinhalten des Sozialstaatesgrundsatzes gehören nach Abendroth
– a) das Prinzip der öffentlichen Daseinsvorsorge
– b) die Norm, daß das Verhältnis des Einzelnen zur staatlichen Macht nicht lediglich als eine Frage individueller Freiheit, sondern auch als eine Frage demokratischer Teilhabe an den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen gesehen werden muß.
Gesetzgeber, Rechtsprechung, Regierung und Verwaltung sind an dieses „Vorstellungsminimum“, ohne daß der Verfassungsgrundsatz sinnentleert wäre, direkt gebunden, Darüber hinaus enthält der Grundsatz eine „Gestaltungsaufgabe“ in der Form eines Appells an den Gesetzgeber, der sich vorbehält, ob und wie weit er diese weitergehende Gestaltungsmöglichkeit ausfüllen will. (107)
Zum Charakter des Verfassungskompromisses gehört vor allem, daß ein Gleichgewicht zwischen dem Moment der Rechtsstaatlichkeit und dem Moment der Sozialstaatlichkeit, zwischen Schutz individueller Freiheit auf der einen Seite und Verwirklichung sozialer Bindung und demokratischer Teilhabe auf der anderen Seite bestehen soll.
Der Staat ist als Gesetzgeber zwar zu aktiver Gestaltung der gesamten Gesellschaftsordnung durch den Verfassungsgrundsatz des demokratischen Sozialstaates verpflichtet, aber gerade in die Richtung der Stärkung der sozialen Eigenverantwortlichkeit seiner Bürger in allen gesellschaftlichen Verbänden und Institutionen.
Die Weckung und Ermöglichung sozialer Eigenverantwortlichkeit und Teilhabe der Bürger ist das Ziel der sozialgestaltenden Tätigkeit des Staates. Daraus folgt die Verpflichtung zum Ausbau derjenigen gesellschaftlichen Gebilde, die soziale Eigenverantwortlichkeit und demokratische Teilhabe ihrer Angehörigen ermöglichen, die „Ausbreitung des Genossenschaftsgedanken und der Ausbau der Selbstverwaltung … als Selbstverwaltung im politischen Sinne verstanden. . in politischen Parteien, berufsständischen Verbänden, Gewerkschaften, und auch in der Wirtschaft.“ (108)
Selbst aus einer verengten Theorie des sozialen Rechtsstaates, wie sie Ch. F. Menger vertritt, der damit im Unterschied zum formalen Rechtsstaat den materialen Rechtsstaat oder „Gerechtigkeitsstaat“ identifiziert, ergeben sich für die Gestaltung der Gesellschaftsordnung durch den Staat ähnliche Konsequenzen, die ausdrücklich in den Bereich des Minimalgehalts dieses Grundsatzes gehören.
„Die vom Staat zu übende Gerechtigkeit erschöpft sich nicht in der Gewährung der Rechtsgleichheit, Art. 2, Abs. 1 bedeutet Verzicht der Verwirklichung geringerwertiger Staatsinteressen zugunsten der dort gewährleisteten höherwertigen Interessen der Bürger. Der föderale Charakter des GG und die Garantie des Rechts auf Selbstverwaltung (Art. 28, Abs. 2) enthalten die gleiche Forderung zugunsten der sog. „engeren Verbände“. Den Ländern, Selbstverwaltungskörperschaften, engeren Verbänden, und den einzelnen Bürgern muß vom Staate her Gerechtigkeit werden, d.h. der Staat darf niemanden ungerecht in seiner Rechtsstellung beeinträchtigen, er muß „jedem das Seine“ geben, wenn die Austeilung von Gütern jedweder Art ihm übertragen ist.“ (109) Vgl. Begriff des „bundesfreundlichen Verhaltens“ der Bundesregierung gegenüber den Bundesländern im Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Fernsehstreit zwischen Bund und Ländern.
III.5.1 Ausdeutung der Grundrechte im Sinne sozialer Demokratie
Das Grundgesetz kennt im Unterschied zur Weimarer Verfassung und der UNO-Deklaration der Menschenrechte kaum besonders soziale Grundrechte (z.B. Recht auf Arbeit), sondern begnügt sich fast nur mit den klassischen Bürgerrechten, die aber durch den sozialstaatlichen Grundcharakter des GG eine andere Funktion haben müssen als in einem formalen oder liberalen Rechtsstaat:
„Es muß geprüft werden, inwieweit die liberalen Grundrechte, zunächst als Ausgliederungsrechte gegenüber der Staatsgewalt formuliert und gedacht, nun, weil es sich um einen demokratischen und sozialen Rechtsstaat handelt, in Teilhaberechte umgedacht werden müssen, die gleichzeitig mit dem früheren bloßen Ausgliederungscharakter dieser Grundrechte - soweit notwendig und soweit möglich - versöhnt werden müssen.
Die enge Verkoppelung von „demokratisch“, „sozial“ und „ rechtsstaatlich“ impliziert den Gedanken, daß es möglich und notwendig ist, den Wert, den die liberalen Grundrechte zum Ausdruck bringen, in eine neu zu gestaltende Gesellschaftsordnung zu übernehmen, die auch den Wert der sozialen Gerechtigkeit, der weitgehend offen und ungelöst gebliebenen Gestaltungsaufgabe des GG, entspricht.“ (110)
Die liberalen Grundrechte waren auf eine vom Staat grundsätzlich getrennte Gesellschaft ausgerichtet. Wird aber der Staat selber zum Gestalter der Gesellschaftsordnung, so müssen neben den negatorisch wirkenden liberalen Grundrechten positive Anweisungen eingeführt werden, wie Gerechtigkeit im Sozialstaat zu verwirklichen sei. Geschieht das nicht durch einen neuen Katalog von sozialen Grundrechten, so tritt eine „Umfunktionierung des Grundrechtskatalogs“ (111) ein, von der Abgrenzung der Gesellschaft und der einzelnen Staatsbürger gegenüber dem Staat zur Garantie der Teilnahme von gesellschaftlichen Verbänden und Einzelnen an der Gesamtwillensbildung im Staatsverband.
III.6 Der Verfassungsgrundsatz der sozialen Demokratie und die Hochschule
Der Grundsatz der demokratischen und sozialen Rechtsstaatlichkeit muß in seiner zweiseitigen Funktion, als „Auslegungsregel“ und als „Gestaltungsmaxime“ auch für den Bereich des Hochschulrechts Anwendung finden:
- Da das gesamte geltende Gesetzes- und Verfassungsrecht, auch wenn es älteren, vor Inkrafttreten des GG geschaffenen Rechtsschichten zugehört, den Auslegungsregeln unterworfen werden muß, die sich aus den Verfassungsgrundsätzen des GG ergeben, muß auch das Grundrecht der Universität, Art. 5, Abs. 3, die Freiheit der Forschung und Lehre, anders interpretiert werden als zu Zeiten der Weimarer Verfassung, die ein ähnliches Grundrecht enthielt, aber an Stelle des Verfassungsgrundsatzes der sozialen Demokratie nur ein deklaratorisches, nicht unmittelbar bindendes Sozialprogramm kannte, jetzt hingegen die Sinndeutung der Freiheitsrechte maßgebend von der „Sozialstaatsklausel“ des Grundgesetzes bestimmt wird.“ (112)
- Da die gesamte Gesel1schaftsordnung zur Disposition des Gesetzgebers steht, der durch das GG den Gestaltungsauftrag der Neuordnung der Gesellschaft im Sinne demokratischer und sozialer Rechtsstaatlichkeit erhalten hat, und da die Hochschulverfassung und der Status der Studenten und Dozenten „Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung“ (der Länder) sind (113), die unmittelbar „den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates entsprechen (muß)“ (Art. 28, Abs. 1), so besteht eine direkte Bindung der Landesgesetzgeber (bei der Verabschiedung von Hochschulgesetzen) wie auch der Exekutive (bei der Bestätigung von Universitätssatzungen und -ordnungen) an diesen Rechtsgrundsatz, ebenso bei der Gestaltung der die Hochschulen betreffenden Verwaltungstätigkeit.
Entscheidend ist aber auch die Frage, ob - angesichts der gesellschaftlichen Kompromiß-Situationen, auf der das GG beruht, die Gestaltung des Hochschulverfassungsrechts entsprechend den Grundsätzen der demokratischen und sozialen Rechtsstaatlichkeit zu dem vom GG vorausgesetzten „Minimalprogramm“ oder zur „Chance der Verwirklichung weiterer gesellschaftlicher Ziele“ im Sinne der oben getroffenen Unterscheidung gehört:
Die gegenwärtige Eigentumsstruktur, die kapitalistische Wirtschaftsfreiheit (mit gewissen Einschränkungen), also das Privateigentum an gesellschaftlich entscheidenden Produktionsmitteln gehört zweifellos in dieser Kompromiß-Lage nicht zum Minimalprogramm der Verwirklichung sozialer Demokratie.
Dagegen gehört eine demokratisch-sozialstaatliche Gestaltung des Hochschul- und Bildungswesens unzweifelhaft zu diesem Minimalprogramm, besonders da dessen Institutionen schon öffentlich-rechtlich organisiert sind.
III.7 Die Hochschule als öffentliche Körperschaft in der sozialen Demokratie
Im demokratischen und sozialen Rechtsstaat bedeutet die Verankerung von gesellschaftlichen Verbänden durch institutionelle Garantien in der Verfassung etwas völlig anderes als im liberal-bürgerlichen Rechtsstaat:
Im formalen Rechtsstaat verleiht der Staat dem betreffenden Verband eine begrenzte Kompetenz, ein Sachgebiet, zur Selbstverwaltung, innerhalb dessen ihm ein hoheitliches Aufsichtsrecht zusteht. Der im Gehäuse des klassischen liberalen Rechtsstaates sich ausbildende hoheitliche Verwaltungsstaat ordnete sich öffentlich-rechtliche Körperschaften als Instrumente der „Sozialdisziplinierung“ (114) ein.
Darauf gründet sich auch der Kern der Hochschulrechtslehre von Arnold Köttgen: Die Universität wird als „unpolitische“ öffentliche Institution verstanden, in der Verwaltungstätigkeit allein im Sachlichen, in den „Materialprinzipien der Wissenschaft“ ihre Legitimation findet.
„Das Grundrecht der deutschen Universität ist kein Beitrag zu dein verästelten Thema „soziale Autonomie und Staat“. „Durch diese bloße Sachbezogenheit akademischer Selbstverwaltung sei auch jeder Vergleich mit der Gemeinde-Selbstverwaltung fehl am Platz. (115)
Aber schon mit der Entwicklung des „egalitär-radikaldemokratischen“ (Leibholz) und plebiszitären Elements (Abendroth) innerhalb des formalen Rechtsstaates setzte in dieser Frage eine rechtspolitische Unsicherheit ein:
„Die Rechtsordnung war bisher nicht in der Lage, den öffentlichen Verbänden einen festen Platz zuzuweisen. Ihre politische Position und ihr repräsentativer Charakter wurden durch Verleihung eines fiktiven Rechtscharakters anerkannt und sie wurden in der Verfassung institutionell garantiert.“ (116) In einer Verfassungsordnung, die der Tendenz nach die Distanz zwischen „Staat“ und „Gesellschaft“ aufheben soll, indem sie die bisher nur abstrakte Demokratie zur sozialen werden läßt, muß die rechtliche Organisierung eines Personenverbandes als integrierender Bestandteil von Staatsverwaltung notwendig fiktiv werden.
Daher sind die Hochschulen, gegenwärtig eine der größten öffentlich-rechtlich organisierten Personenverbände, eigentlich nur noch „Titular-Körperschafte des öffentlichen Rechts“, (117) hinter deren juristischer Kulisse sich teils wissenschaftliche Betriebe, teils genossenschaftlich strukturierte Gruppen - Professoren-Kollegien, Studentenschaften, z.T. Auch Assistentenschaften verbergen.
III.7.1 Dreifache Funktion der Hochschulselbstverwaltung
In der Verfassungsordnung einer rechtsstaatlichen sozialen Demokratie hat die Hochschulselbstverwaltung eine dreifache Funktion, oder anders ausgedrückt: Sie ist institutionelle Ausformung von drei verschiedenen, zunächst widersprüchlich erscheinenden Verfassungsgrundsätzen, die miteinander zu verschmelzen sind. Diese drei Verfassungsnormen in ihrer Anwendung auf die Hochschulselbstverwaltung sind zugleich Ausdruck der drei Seiten der Verfassungsordnung, in der die Prinzipien der Sozialstaatlichkeit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit eine unlösbare Einheit bilden.
III.7.2 Hochschule und Sozialstaat:
– 1 Die objektive Funktion der Hochschulselbstverwaltung ergibt sich aus der Verpflichtung des Staates als Sozialstaat, in ursprünglich gesellschaftliche Funktionen einzutreten,
Der Staat soll zumindest solche öffentlichen Dienstleistungen und Sozialleistungen gewähren und garantieren, die einerseits zur Aufrechterhaltung und dynamischen Ausweitung der gesamtgesellschaftlichen Produktion und Organisation unabdingbare Voraussetzungen sind und von keiner anderen, gesellschaftlichen Instanz mehr geleistet werden können, oder die andererseits zur materiellen Gewährleistung und Sicherung der Ausübung bestimmter bürgerlicher Freiheitsrechte unbedingt erforderlich sind.
Da erstens eine umfassende Entfaltung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte eine Grundvoraussetzung der Aufrechterhaltung des gesamtgesellschaftlichen Produktions- und Lebensprozesses einer modernen Industriegesellschaft ist, die von privater Seite oder auf genossenschaftlicher, wirtschaftlicher Basis, etwa der Wissenschaftler und Studenten selbst, nicht gewährleistet und durchgeführt werden kann, so muß der Staat diese Funktion übernehmen und die Einrichtungen und Arbeitsmittel dafür zur Verfügung stellen.
Da zweitens der Staat als Sozialstaat die „freie Entfaltung der Persönlichkeit“ (Art. 2, Abs. 1 GG) in ihren einzelnen Konkretisierungen, in diesem Zusammenhang also die freie Betätigung jedes Geeigneten in Forschung und Lehre bzw. im Studium (Art. 5, Abs. 3 GG) sowie die freie Wahl des Berufs und der Ausbildungsstätte (Art. 12, Abs. 1 GG) materiell zu gewährleisten hat, ist er verpflichtet, auch die Einrichtungen, Arbeitsmittel und eine angemessene, d.h. sozial gerechte Arbeitsentschädigung jedem zu wissenschaftlicher Forschung und Lehre bzw. zum wissenschaftlichen Studium geeigneten und begabten Staatsbürger zur Verfügung zu stellen, bzw. zu gewähren.
Der Staat ist also aus beiden Erwägungen heraus - dem objektiv-öffentlichen Interesse an der Erhaltung und Erweiterung der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft u n d dem subjektiv-öffentlichen Recht des Einzelnen auf freie Entfaltung seiner Interessen und Begabungen - zur Errichtung und laufenden Ausstattung der Hochschulen und zur Förderung und Entlohnung der wissenschaftlichen arbeitenden Studenten und Wissenschaftler verpflichtet. (Vgl. unten. Das Grundrecht auf freie wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung in der Hochschule).
Andererseits ist der Staat auf Grund anderer, gleichwertiger Verfassungsnormen (Vgl. im Folgenden Funktion 2 und 3) gehalten, die Verwaltung und spezielle Verwendung der von ihm zum Zwecke der Wissenschafts- und Begabtenförderung zur Verfügung gestellten Mittel, Einrichtungen und Sozialleistungen gesetzlich den Beteiligten selbst zu überlassen.
Daher hat die Hochschulselbstverwaltung auch durchaus den Charakter mittelbarer (aber weisungsfreier) Staatsverwaltung, die treuhänderisch im Rahmen der Gesetze die staatlichen Mittel und Einrichtungen verwaltet. Indem der von der Gesellschaft getrennte Rechtsstaat sich zum Sozialstaat entfaltet, wird auch Hochschulverwaltung vom „Ordnungsgaranten“ der akademischen Freiheit zum „Leistungsträger“ staatlicher Wissenschafts- und Studentenförderung.
III.7.3 Hochschule und Rechtsstaat:
– 2 Die zweite Funktion der Hochschulselbstverwaltung ist Ausdruck der „klassischen“ formal-rechtsstaatlichen Normen zum Schutz der bürgerlichen Freiheitsrechte gegenüber dem Staat.
Hochschulautonomie und akademische Selbstverwaltung sind in dieser Funktion institutionelle Garantie der Freiheit der Forschung und Lehre und des Studiums gegen Eingriffe des Staates, aber auch vor Übergriffen gesellschaftlicher Kräfte. Diese Garantie entspringt der Verpflichtung des Gesetzgebers als Garant des Rechtsstaates, die freie wissenschaftliche Betätigung und Ausbildung des Einzelnen auch unter den modernen Bedingungen eines institutionalisierten, technisierten Wissenschaftsbetriebs zu schützen.
Durch sie wird daher erstens der „Substanzkern“ der Hochschule, der Raum des eigentlichen Vollzuges von Forschung, Lehre und Studium garantiert, über den die Hochschule volle Autonomie, im Sinne der Freiheit auch von staatlicher Gesetzgebung, besitzen muß, und in dem andererseits alle Beteiligten wiederum völlig frei sind in der Ausübung ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Gemäß dieser akademischen Freiheit jedes Einzelnen ist daher in diesem Rau m nur freiwilliges, kollegiales Zusammenwirken möglich. Der Kernbereich der Wissenschaft unterliegt auch keiner Willensbildung auf demokratischer Grundlage. Wissenschaftliche Erkenntnis und Bildung sind nicht in Verwaltung zu nehmen (auch nicht in demokratische Selbstverwaltung).
Zweitens ergibt sich aus der institutionellen Garantie zwingend die Verpflichtung des Gesetzgebers, der Hochschule auch die Verwaltung aller ihr vom Staat zur Verfügung gestellten Einrichtungen und Mittel, die insgesamt Voraussetzung freier wissenschaftlicher Betätigung und Ausbildung sind, zu eigenständiger weisungsfreier Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze und unter staatlicher Rechtsaufsicht gesetzlich zu übertragen, weil „die in Betracht kommenden Zuständigkeiten mit dem eigentlichen „Vollzuge“ der Wissenschaft derartig spezifisch verquickt sind, daß um der Eigenständigkeit von Forschung und Lehre willen auch die Chance eigenständiger Verwaltung geboten werden muß.“ (118)
III.7.4 Hochschule und Demokratie:
– 3 Die dritte Funktion der Hochschulselbstverwaltung ergibt sich aus dem Verfassungsauftrag des Gesetzgebers zur Realisierung sozialer Demokratie, d.h. zur Demokratisierung der Gesellschaft.
Da in der Hochschule nicht nur eine „Sache“ (Wissenschaft) verwaltet wird, sondern ein Zusammenwirken von Personen in den Einrichtungen und Arbeitsstätten an einer Sache konstituiert wird, obliegt der Hochschule in einer sozialen Demokratie als organisiertem gesellschaftlichem Teilbereich auch die Regelung und Organisation des kooperativen und sozialen und politischen Interessen im gesamtgesellschaftlichen Prozeß der politischen Meinungs- und Willensbildung, und zwar gegenüber anderen gesellschaftlichen Kräften wie auch gegenüber dem Staat.
In einer Verfassungsordnung der sozialen Demokratie muß den akademischen Bürgern und ihren gewählten Vertretern die „Kompetenz-Kompetenz“ über Ziele und Umfang ihres politischen Handelns gewährleistet sein, da ihre sozialen Interessen und ihre politische Engagement mit dem Interesse auf freie wissenschaftliche Betätigung und mit dem Sinn der Wissenschaft überhaupt - kritische Rationalität im Dienste des Menschen zu sein - eng verknüpft sind, gleichgültig ob die Einzelnen oder die Hochschule in ihrer Gesamtheit diese von der Verfassungsordnung geboten Chance auf Teilhabe am gesellschaftlich-politischen Prozeß wahrnehmen und damit den ursprünglichen Anspruch aufklärerischer Wissenschaft einlösen oder nicht.
Durch die veränderte Funktion akademischer Selbstverwaltung und Hochschulautonomie in einer neuen Verfassungsordnung wachsen der Hochschule durchaus nicht neue oder fremde Aufgabenbereiche zu, sondern die Wahrnehmung und Erfüllung ihrer gleichbleibenden zentralen Aufgaben - Erarbeitung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse und Vermittlung wissenschaftlicher Bildung und Ausbildung - erfolgt nur unter anderen gesellschaftlichen und verfassungsmäßigen Bedingungen und Formen. Die Vertretung sozialer und politischer Interessen der akademischen Bürger, die Organisation ihres Zusammenwirkens und Zusammenlebens in den Einrichtungen der Universität sind nicht neue, zusätzliche Aufgaben der Hochschule, sondern sie gehören im Rahmen einer demokratische organisierten und gegliederten Gesellschaft zu den selbstverständlichen Organisationsformen eines Personenverbandes, dessen Angehörige in einer gemeinsamen Arbeitsstätte oder Institution zusammenarbeiten.
Auch im Verfassungsmodell des formalen Rechtsstaates - des preußisch-deutschen konstitutionellen Obrigkeitsstaates wie auch der formal-rechtsstaatlichen Weimarer Demokratie sollte die Hochschulselbstverwaltung nicht allein die Funktion eines staatlichen Verwaltungsinstruments zur „unpolitischen“ Verwaltung einer „Sache“ haben, sondern sie sollte zugleich als „nationale Universität“ Repräsentantin der „nationalen Kulturgemeinschaft“ deutscher Kultur und Wissenschaft sein, und ihre Mitglieder sollten dem Staat in Gestalt seines Organs Hochschule zu Treue und Gehorsam verpflichtet sein. (Vgl. Abschnitt „Die Ideologie der akademischen Gemeinschaft“)
Im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dagegen hat die Hochschulselbstverwaltung einerseits die Bedeutung einer umfassenden institutionellen Garantie der akademischen Freiheit im weitesten Sinne, andererseits ist sie eine der politischen, demokratischen Organisationsformen der Gesellschaft, d.h. Ausformung sozialer Demokratie.
Akademische Freiheit und soziale Demokratie müssen in einem neuen verfassungskonformen Hochschulrecht und in entsprechenden neuen Hochschulverfassungen zu einem Ausgleich gebracht werden.
Aus zwei verschiedenen Gestaltungsaufgaben des Gesetzgebers - der Verpflichtung zur institutionellen Garantie akademischer Freiheit und dem Auftrag zur Realisierung sozialer Demokratie durch engere öffentliche Verbände und Selbstverwaltungseinheiten, - ergibt sich, daß die Hochschulen gemäß Art. 5 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 GG als mitgliedschaftlich organisierte Personenverbände in der Form öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit eigenständiger d.h. weisungsfreier Selbstverwaltung in allen ihren Angelegenheiten zu konstituieren sind.
Daher ist vor allem die Zerlegung des Verwaltungsbereichs der Hochschule abzulehnen, wie sie von den Vertretern der traditionellen formal-rechtsstaatlichen Hochschulrechtslehre gerechtfertigt wird, indem etwa neben dem autonomen Substanzkern des Vollzugs von Forschung und Lehre ein begrenzter Raum weisungsfreier akademischer Selbstverwaltung konstruiert wird, dessen Aufgaben eng mit Forschung und Lehre verknüpft und streng an die Sache gebunden sein sollen und darüberhinaus ein weiterer Bereich allgemeiner Hochschulverwaltung im Sinne einer vom Staat nach freiem Ermessen delegierten weisungsgebundenen Auftragsverwaltung vorgesehen wird, zu dem besonders die Verwaltung wirtschaftlicher und sozialer Fragen gehören soll.
Denn erstens ist schon unter dem Gesichtspunkt der Garantie akademischer Freiheit eine Abgrenzung zwischen Verwaltungsaufgaben, die eng oder weniger eng mit Forschung und Lehre (und dem Studium) verknüpft sind, nach freiem Ermessen der Staatsverwaltung willkürlich und geeignet, in diesem Bereich eine Rechtsunsicherheit zu verewigen, die im deutschen Hochschulwesen eine lange Tradition hat. (119)
Darüberhinaus verlangt aber der Leitsatz der sozialen Demokratie, gerade die Regelung sozialer und wirtschaftlicher Fragen und die Vertretung sozialer Interessen von Personengruppen den engeren öffentlichen Verbänden und Selbstverwaltungseinrichtungen weitgehend zur Selbstbestimmung zu überlassen (120) und n i eh t durch eine direkte staatliche oder unter staatlicher Fachaufsicht und Weisungsgewalt stehende Wirtschafts- und Sozialverwaltung zu organisieren. Aus diesem Grunde ist z.B. auch die Schaffung von staatlich dirigierten Sozialverwaltungen für Studenten (etwa durch Studentenwerke als öffentlich-rechtliche Anstalten) abzulehnen zu Gunsten einer gesetzlichen Übertragung dieser Aufgaben an freie Selbstverwaltungseinrichtungen, in denen Vertreter der Studentenschaft dominieren. (Vgl. dazu im einzelnen Kapitel V)
III.7.5 Demokratisierung der inneren Struktur
Der Verfassungsleitsatz des demokratischen und sozialen Rechtsstaates wird aber nicht nur wirksam für die Rechtsstellung und soziale Funktion der Hochschulselbstverwaltung im Rahmen der gesamten Verfassungs- und Gesellschaftsordnung, sondern diese Verfassungsnorm bestimmt auch die innere Ausgestaltung der Hochschulverfassung.
Art. 20, Abs. 1 und Art. 28, Abs. 1 GG begründen die Verpflichtung des Gesetzgebers in den Ländern zur Gewährleistung, Ausgestaltung und Kontrolle (durch Rechtsaufsicht) der demokratischen Binnenstruktur aller öffentlichen Personenverbände (Parteien, Gewerkschaften, öffentlich-rechtliche Körperschaften) und damit auch der Hochschule.
Alle verwaltungsmäßigen und politischen Entscheidungen der akademischen Selbstverwaltung sind formal streng an die Regeln demokratischer Willensbildung und Beteiligung gebunden: Die Selbstverwaltungs- und Vertretungsorgane müssen ihr Mandat von der Mehrheit der Mitglieder ableiten; diese Mehrheit muß in freier Abstimmung festgestellt werden und bei der Stimmabgabe muß die politische Gleichheit verwirklicht sein. (121)
Denn der innerhalb des Staates geltende politische Gleichheitsgrundsatz gilt in einer Verfassungsordnung der sozialen Demokratie auch innerhalb aller engeren öffentlichen Verbände. Demokratische Willensbildung ist selbstverständliche Norm in Selbstverwaltungsverbänden, die vom Gesetzgeber gerade deshalb konstituiert oder in ihrer Funktion gestärkt werden, um die Demokratisierung der Gesellschaftsordnung, eine intensivere und reale demokratische Beteiligung der Staatsbürger in gesellschaftlichen und öffentlichen Verbänden zu erreichen.
Dieser formale Grundsatz besagt allerdings noch nichts über die konkrete Ausgestaltung der demokratischen Binnenstruktur, bei der der Gesetzgeber und die Verbände selbst einen mehr oder weniger großen Ermessensspielraum haben.
Denn eine demokratische Organisation der Hochschulselbstverwaltung muß auch einer möglichst sinnvollen und effektiven Erfüllung der Aufgaben der Hochschule gerecht werden und darf zum anderen nicht die natürliche Gliederung der Mitgliedschaft in verschiedene Personengruppen mit unterschiedlichen Interessen außer acht lassen, die sich aus der differenzierten Aufgabenstellung der Hochschule - wissenschaftliche Forschung und Lehre, Ausbildung wissenschaftlich qualifizierter Arbeitskräfte für zahlreiche Berufe und Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses - ergeben müssen.
Es wird daher an Hand der praktischen Organisation der Hochschulselbstverwaltung zu untersuchen sein, ob die Hochschule überhaupt faktisch eine homogene Einheit von formal gleichberechtigten Mitgliedern ist und sein kann oder ob sich nicht vielmehr hinter der formal homogenen Rechtsform der Körperschaft bereits verschiedene Personenverbände verbergen, deren innere Struktur und gegenseitiges Zusammenwirken in der Hochschulselbstverwaltung sich allerdings mit demokratischen Grundsätzen in Einklang befinden muß (vgl. Kapitel VI, Die demokratische Hochschulverfassung).
III.8 Das Grundrecht auf freie wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung in der Hochschule
Wurde bisher lediglich der übergreifende Rahmen der Verfassungs- und Gesellschaftsordnung im Sinne der Verfassungsnorm der demokratischen und sozialen Rechtsstaatlichkeit für die Gestaltung und Funktion der Hochschulselbstverwaltung in Betracht gezogen, so soll im Folgenden auch von den individuellen Grundrechten der Hochschullehrer und der Studenten ausgegangen werden.
Aus dieser Perspektive ergeben sich weitere Elemente für die Gestaltung der Verfassung der Hochschule und der Arbeitsverhältnisse ihrer Mitglieder.
Ausgehend von einer verfassungskonformen Umdeutung der bisherigen und der im Grundgesetz neu begründeten Grundrechte im Sinne demokratischer Sozialstaatlichkeit von bloßen Ausgliederungsrechten gegenüber der Staatsgewalt zu sozialen und demokratischen Teilhaberechten ist auch das Grundrecht der Freiheit der Forschung und Lehre (Art. 5, Abs. 3 GG) in Verbindung mit den anderen hochschulrechtlich relevanten Grundrechten neu zu deuten, in bewußter Abgrenzung von der Deutung, die es im Rahmen der Weimarer Verfassung erfuhr, die noch nicht vom Verfassungsleitsatz der Sozialstaatlichkeit und der sozialen Demokratie bestimmt wurde.
Das spezielle Grundrecht in Art. 5 Abs. 3 GG ist nur eine Konkretisierung der grundlegenden Verfassungsnorm in Art. 2 Abs. 1 GG - „Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.. . “ die den nachfolgenden Grundrechtsbestimmungen übergeordnet ist. ([Fußnote fehlt]) Art. 5 Abs. 3 GG ist ferner eng verknüpft mit Art. 12, Abs. 1 GG - „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“
Nach allgemeiner Auffassung (auch der‚ [FEHLER] Vertreter des traditionellen Hochschulrechts) beinhaltet die Freiheit der Forschung und Lehre automatisch, als Spiegelbild der Lehrfreiheit, das „komplementäre Grundrecht“ (Köttgen) der Lernfreiheit des Studenten. Die Bezogenheit von Art. 5 Abs. 3 GG auf die generelle Verfassungsnorm in Art. 2 Abs. 2 GG ist entscheidend für den Bedeutungsgehalt und die Funktion des Grundrechts der Freiheit der Forschung und Lehre im Rahmen des Grundgesetzes (abweichend von seiner Bedeutung in der Weimarer Verfassung). Als Konkretisierung des zentralen Grundrechts der freien Entfaltung der Persönlichkeit handelt es sich nicht um ein Grundrecht, das allein um der Wissenschaft willen, aus sachlichen Erfordernissen, dazu besonders berufenen oder beamteten Personen verliehen wird, sondern das vor allem der freien Entfaltung der auf die Wissenschaft gerichteten Begabungen, Interessen und Ideen von Menschen dienen soll. (Diese Funktion des Grundrechts der Freiheit der Forschung und Lehre kommt noch zusätzlich darin zum Ausdruck, daß im Grundgesetz dieses Grundrecht mit dem Recht der freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit in einem Artikel zusammengefaßt ist, während der entsprechende Artikel 142 der Weimarer Verfassung nicht im Rahmen des der Einzelpersonen und ihren Rechten gewidmeten Abschnitts I, sondern zu Beginn des Abschnitts über Schul- und Bildungsfragen seinen Standort hatte.) Die immer noch vorherrschende formalrechtsstaatliche Hochschulrechtslehre wird der veränderten Funktion des Rechtes auf Freiheit der Forschung und Lehre im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes nicht gerecht, wenn sie es weiterhin einseitig und vorrangig als institutionelle Garantie der Hochschulfreiheit und nicht auch als eines der Freiheitsrechte des Individuums interpretiert: „(Des akademischen Bürgers) Freiheit ist das Recht eines interventionsfreien Verhältnisses des Staates zur Wissenschaft.“ (A. Köttgen, 1959) Eine solche Auslegung steht noch in der Kontinuität des Hochschulrechts der Weimarer Zeit:
„Nicht im individualistischen, sondern im institutionellen Sinne … ersteht die Weimarer Verfassung das Grundrecht der Lehrfreiheit. Um der sachlichen Notwendigkeit der Forschung und nicht um der Würde der Einzelperson willen verzichtet der Staat auf Eingriffe in die Forschung. Die Wissenschaft ist frei und nicht der Professor. (A. Köttgen, 1933) (122)
Im Grundgesetz ist dagegen beides unlösbar miteinander verknüpft: denn Wissenschaft in Forschung und Lehre ist auch eine individuelle Lebensäußerung von Menschen. Das Grundrecht der freien Forschung und Lehre als Konkretisierung des Rechts der freien Entfaltung der Persönlichkeit ist bezogen auf den obersten Rechtsgrundsatz der gesamten Verfassungsordnung: den Satz von der Unantastbarkeit der Würde des Menschen (in Art. 1 Abs. 1 GG). Der Mensch soll sich zu dem frei entfalten können, was nach Art. 1 sein Wesen und darum seine Würde ausmacht. Die freie Entfaltung der wissenschaftlichen Erkenntnis und Bildung gehört damit auch auch in den Bereich der individuellen Freiheitsrechte.
Für den Bereich der Hochschule ist die Freiheit der Forschung und Lehre, besonders hinsichtlich des darin enthaltenen „Komplementärgrundrechts“ der Lernfreiheit sinngemäß auch mit Art. 12, Abs. 1 GG, dem Recht auf freie Wahl des Berufs und der Ausbildungsstätte verknüpft, dessen Fassung nach Köttgen auf eine „Anregung aus studentischen Kreisen“ zurückgeht. (123) Denn damit ist die Hochschule ausdrücklich nicht nur als Ort zweckfreien wissenschaftlichen Forschens und Studierens, sondern auch als Ausbildungsstätte, die auf die Ausübung von Berufen vorbereitet, anerkannt. Nicht nur in der von den Dozenten betriebenen Forschung und Lehre ist Wissenschaft zum Beruf geworden, sondern auch das Studium wird als Ausbildungsweg zu einem Beruf hin angesehen, Freiheit des Studiums („Lernfreiheit“ des Studenten) wird nicht nur um der Wissenschaft willen, sondern als eine Vorbedingung der freien Berufswahl des Einzelnen, der freien Entfaltung seiner Persönlichkeit im Berufsleben garantiert.
Damit wird die Freiheit der Forschung und Lehre und des Studiums in Verknüpfung mit der freien Wahl der Ausbildungsstätte und des Berufs überhaupt erst wieder in den Rang eines klassisch-liberalen Rechtsstaates erhoben, einen Rang, den die herrschende, anti-liberale formal-rechtsstaatliche Hochschulrechtslehre der letzten Jahrzehnte ihm streitig gemacht hatte.
Die verfassungskonforme Umdeutung des überkommenen Grundrechts der freien Forschung und Lehre im Sinne sozialer Demokratie kann nur auf der Basis eines liberalen Verständnisses dieses Grundrechts erfolgen, wonach damit nicht nur das „Grundrecht der Universität“ (Köttgen) sondern auch ein grundlegendes Freiheitsrecht des Einzelnen begründet wird.
Vor dem Hintergrund des Art. 2 (freie Entfaltung der Persönlichkeit) wird durch die Verknüpfung von Art. 5 Abs. 3 mit Art. 12, Abs. 1 für den Bereich der Hochschule ein individuelles Recht auf freie wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung in der Hochschule geschaffen.
Die miteinander zu kombinierenden Grundrechte der Forschungs- und Lehrfreiheit und der Ausbildungsfreiheit müssen in einer Verfassungsordnung der Sozialstaatlichkeit und der sozialen Demokratie eine Ausdeutung erfahren, die ihren liberal-rechtsstaatlichen Gehalt als individuelle bürgerliche Freiheitsrechte im Sinne von negativen „Ausgliederungsrechten“ gegen staatliche Eingriffe und Machtansprüche nicht aufhebt, sondern mit einbezieht, sie aber zugleich ausweitet zu positiven sozialen und demokratischen „Teilhaberechten.“
Damit hat auch das Grundrecht auf freie wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung eine dreifache Funktion (analog zu den drei Funktionen der Hochschulselbstverwaltung), die der Einheit der drei Elemente des Verfassungsgrundsatzes der demokratischen und sozialen Rechtsstaatlichkeit entspricht:
Das Recht auf freie wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung läßt sich unter den Bedingungen eines modernen Wissenschaftsbetriebs nur realisieren, indem es zugleich ausgeweitet wird zum sozialen Teilhaberecht, zum Rechtsanspruch an den Sozialstaat auf Gewährleistung der notwendigen Arbeitsmittel und Einrichtungen im Rahmen der Hochschule, auf soziale Sicherstellung und gerechte Entlohnung des wissenschaftlich Arbeitenden. Um jedoch die ursprüngliche Freiheit der wissenschaftlichen Arbeit und Ausbildung auch in ihrer Bindung an umfangreiche staatliche Betriebsmittel in der Hochschule zu bewahren, ist seine weitere Ausdeutung zu einem demokratischen Teilhaberecht, zum Recht auf Teilhabe an der Verfügungsgewalt über die Arbeitsmittel, unabdingbar.
III.8.1 Freiheit der Forschung, Lehre und Ausbildung als soziales Teilhaberecht:
1. Der Rechtsanspruch jedes Einzelnen, der dazu geistig qualifiziert ist, auf materielle Sicherung einer freien wissenschaftlichen Ausbildung und freier Forschungs- und Lehrtätigkeit verpflichtet den Sozialstaat als Träger kollektiver „Daseinsvorsorge“ im Dienste der Würde des Menschen und der freien Entfaltung seiner Persönlichkeit (Art. 1, Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG) zunächst dazu, allen Begabten die Bildungswege zu eröffnen, die zu einer wissenschaftlichen Ausbildung oder Arbeit in der Wissenschaft selbst hinführen, und hierfür die sachlichen und persönlichen materiellen Voraussetzungen zu schaffen:
– a) durch den umfassenden Ausbau des Schulwesens und anderer Bildungseinrichtungen, die auf ein wissenschaftliches Studium vorbereiten.
– b) durch eine systematische, geplante Nachwuchsförderung, durch ein System von differenzierten, der jeweiligen sozialen Stellung der Begabten angepaßten Ausbildungsbeihilfen (für Oberschüler, aber auch für Begabte, die sich in der Lehre und Berufsarbeit befinden und sich auf ein Studium vorbereiten).
Im Bereich der wissenschaftlichen Arbeit und Ausbildung selbst ist der Staat ebenfalls verpflichtet, allen Geeigneten je nach dem Grad ihrer Qualifikation (Abitur, Akademische Zwischenprüfung, Promotion, Habilitation, Berufung) die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen der freien Entfaltung ihrer Ausbildung und Arbeit in der Hochschule zu gewährleisten, d.h.
– a) ihnen im Rahmen eines planvollen, allseitigen Ausbaus der Hochschulen die jeweils sachlich notwendigen wissenschaftlichen Arbeitsmittel und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen,
– b) ihnen durch differenzierte persönliche Sozialleistungen mindestens eine solche soziale Sicherstellung zu gewährleisten, die für ein ungestörtes freies wissenschaftliches Arbeiten und zur Erfüllung ihrer jeweiligen Funktionen in der Hochschule (als Student. Tutor, Assistent, Dozent, Lehrstuhlinhaber) erforderlich ist, (d.h. unter Ausschaltung des Zwangs zur Werkarbeit als „Eigenbeitrag“ zur Finanzierung des Studiums und des Zwangs zum Nebenverdienst bei den Dozenten und Professoren.)
Doch wird mit einer derartigen materiellen Sicherstellung der freien Entfaltung wissenschaftlicher Arbeit und Bildung der Einzelnen nur eine Seite dieser Tätigkeit und daher auch nur ein Aspekt des Sozialstaatsprinzips erfaßt:
Wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung sind nicht nur Formen der freien Entfaltung der Persönlichkeit im Geiste wissenschaftlicher Erkenntnis und Bildung, sondern die Ergebnisse dieses Arbeitsprozesses - anwendbare Forschungsergebnisse und wissenschaftlich qualifizierte Arbeitskraft - sind unabdingbare Voraussetzungen der Aufrechterhaltung und dynamischen Ausweitung der gesamtgesellschaftlichen Produktion im weitesten Sinne, „allgemeine Garantien der sozialen Entwicklung“ (124). Daher ist die Tätigkeit der Hochschullehrer, wissenschaftlichen Mitarbeiter und Studenten in der Hochschule als produktive Arbeit für die Gesellschaft zu bewerten. Die Arbeit und Ausbildung im Prozeß einer Wissenschaft, die zur „Substanz des praktischen Handelns selbst“ (Schelsky) geworden ist, stellt eine Leistung in gesamtgesellschaftlichen Interesse dar, die sich umsetzt in ökonomische Werte im weitesten Sinne.
Aus diesem Charakter der wissenschaftlichen Arbeit und des Studiums ergibt sich eine weitere Funktion des sozialen Teilhaberechtes der freien Forschung und Lehre: der Rechtsanspruch auf einen gerechten Anteil am Sozialprodukt, als Entgelt für die geleistete Arbeit.
Denn im Unterschied zu einer verengten statischen Deutung des Sozialstaates als Träger der Daseinsvorsorge zur Sicherstellung der freien Entfaltung der Persönlichkeit auch für sozial schwächere Gruppen im Rahmen des bestehenden Systems zielt das Grundgesetz mit der engen Verknüpfung von Sozialstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und sozialer Demokratie auf den weiteren Begriff des Sozialstaates als eines dynamischen sozialen Gerechtigkeitsstaates (und nicht auf die Perfektionierung bis zum bürokratisch erstarrten Wohlfahrtsstaat).
Der Norm der sozialen Gerechtigkeit, die den gerechten Anteil am Sozialprodukt für alle Arbeitenden fordert, wird aber auf dem Wege der bloßen Sicherung des Existenzminimums für Bedürftige nicht Genüge getan, sondern nur durch Gewährung einer Arbeitsentschädigung, differenziert nach dem jeweiligen Beitrag, den die verschiedenen Gruppen innerhalb der Hochschule (Lehrkörper, Mitarbeiter, Studenten) zur Gesamtleistung der Hochschule liefern.
Die Sicherung der persönlichen materiellen Voraussetzungen freier wissenschaftlicher Arbeit und Ausbildung muß daher nach der Norm sozialer Gerechtigkeit in der Form der Entschädigung für eine gesellschaftlich notwendige und produktive Arbeitsleistung erfolgen. Gradmesser für eine sozial gerechte Entschädigung wissenschaftlicher Arbeit muß. ständig steigende Bedeutung für den gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozeß sowie die Höhe der Arbeitsentschädigung für annähernd vergleichbare Arbeitsleistungen in der Wirtschaft sein.
III.8.2 Freiheit der Forschung, Lehre und Ausbildung als demokratisches Teilhaberecht
2. Da eine effektive wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung in steigendem Maße an umfangreiche und kostspielige Arbeitsmittel und Einrichtungen gebunden ist, die den Hochschulen vom Staat zur Verfügung gestellt werden, so ist eine freie Gestaltung und Entfaltung der wissenschaftlichen Tätigkeit der Einzelnen nur gewährleistet, wenn sein individuelles Freiheitsrecht zum demokratischen Teilhaberecht erweitert, wenn der Schutz eines persönlichen Freiheitsraumes, in dessen Isolation wissenschaftliche Arbeit nicht mehr möglich ist, durch Garantie der Teilhabe des Einzelnen an der Verfügungsgewalt über wissenschaftliche Arbeitsmittel und Einrichtungen auf Grund demokratischer Willensbildung ergänzt wird. Anders ausgedrückt: Freies wissenschaftliches Arbeiten und Studieren setzt unter den Bedingungen eines modernen Wissenschaftsbetriebes die Demokratisierung der Verfügungsgewalt über die vom Staat bereitgestellten Mittel und Einrichtungen in einer demokratisch aufgebauten Hochschulselbstverwaltung voraus.
Im Prozeß der Demokratisierung der akademischen Selbstverwaltung wird allerdings die grundlegende Differenzierung des allgemeinen Grundrechts auf freie wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung in das Recht auf freie Forschung und Lehre und das komplementäre Recht auf freies Studieren sowie das Recht auf freie wissenschaftliche Ausbildung als Berufsvorbereitung entscheidend:
Dieser Differenzierung entspricht die Gliederung der Hochschulkorporation in Lehrkörper, Studentenschaft und Assistentenschaft (wobei den Assistenten und anderen wissenschaftlichen Nachwuchskräften auf Grund ihres Rechtes auf freie wissenschaftliche Ausbildung zum Beruf des Hochschullehrers die Mitarbeit in Forschung und Lehre zukommt, weil sie sich andernfalls nicht auf ihren Beruf vorbereiten können,
Die Erweiterung dieser verschiedenen Seiten der allgemeinen Freiheit der wissenschaftlichen Arbeit zu besonderen demokratischen Teilhaberechten bedeutet
– a) daß innerhalb der drei Personenverbände - Lehrkörper, Assistentenschaft, Studentenschaft - die Teilhabe jedes Einzelnen an der demokratischen Willensbildung und Entscheidung über die Ausgestaltung der Rechte seiner Gruppe garantiert sein muß, d.h. besondere Vorrechte Einzelner, wie z.B. der Ordinarien gegenüber den Nichtordinarien, sind nicht gerechtfertigt, weil dadurch die demokratischen Teilhaberechte anderer Mitglieder der gleichen Gruppe verletzt oder ausgeschaltet werden.
Daher ist vor allem die Demokratisierung der Selbstverwaltung des Lehrkörpers durch gleichberechtigte Mitwirkung aller habilitierten Mitglieder des Lehrkörpers an den Entscheidungen ihrer Vertretungsorgane (Fakultäten, Senat, Instituts- oder Fachkollegium) zu fordern. (Während die Selbstverwaltung der Studentenschaft und - sofern überhaupt vorhanden - der Assistentenschaft bereits demokratisch gestaltet ist);
– b) daß die drei Gruppen oder Teilverbände der Hochschule ihre verschiedenen demokratischen Teilhaberechte, die eng aufeinander bezogen sind, gegenseitig zu einem Ausgleich bringen müssen; denn das Recht der Studenten auf freie Gestaltung ihres Studiums findet seine Begrenzung in der Lehrfreiheit der Dozenten und umgekehrt. Daher sind allgemeine akademische Selbstverwaltungsund Vertretungsorgane zu schaffen, in denen die gewählten Vertreter der Teilverbände gleichberechtigt zusammenwirken, ohne daß dabei eine Seite majorisiert werden könnte.
III.8.3 Freiheit der Forschung, Lehre und Ausbildung als rechtsstaatliches Schutzrecht
3.) Neben ihrer Funktion als soziales und demokratisches Teilhaberecht im Rahmen der Gestaltung des modernen Wissenschafts- und Ausbildungsbetriebes behält die Forschungs-, Lehr- und Studienfreiheit ihren ursprünglichen Grundcharakter als rechtsstaatliches „Ausgliederungsrecht“ zum Schutz einer individuellen Freiheitssphäre. Eine sinnvolle und freie wissenschaftliche Arbeit, selbst wenn sie sich in einem komplizierten Arbeitsprozeß zahlreicher wissenschaftlicher Forscher und Mitarbeiter und unter Verwendung und Benutzung umfangreicher Betriebsmittel vollzieht, bedarf der Spontaneität des persönlichen Denkansatzes und der individuellen Arbeitskonzeption. Die eigentliche wissenschaftliche Tätigkeit des Einzelnen, seine Entscheidung über Ziel und Methode der Forschung oder des Studiums dürfen keiner fremden auch nicht demokratischen Willensbildung unterworfen werden. Eine Kooperation von Dozenten, Assistenten oder Studenten ist in diesem Bereich allein auf kollegialer, freiwilliger Basis möglich.
Andererseits ist heute Forschung und Lehre an den Universitäten vielfach bis in ihren Kernbereich an bestimmte Arbeitsmittel und Einrichtungen gebunden, deren Verwendung und Verwaltung sozial organisiert werden muß; um aber kontinuierliche und planvolle Verwaltung zu ermöglichen, sind verbindliche Mehrheitsentscheidungen der akademischen Selbstverwaltungsorgane erforderlich.
Es ist für die freie Entfaltung und Leistungsfähigkeit wissenschaftlicher Arbeit In der Hochschule eine Lebensfrage, inwieweit es gelingt, die akademische Freiheit des einzelnen Wissenschaftlers und Studenten mit der sozialen Demokratisierung der Hochschule und ihrer Einrichtungen in Einklang zu bringen.
Kapitel IV.
IV.1 Der Lehrkörper der Hochschule
Nach der grundsätzlichen Betrachtung der Gesamtverfassung der Hochschule - der Idee und Wirklichkeit ihrer Verfassung - und der Entwicklung von Prinzipien und Normen einer allseitigen Reform sollen in den folgenden Abschnitten praktische Lösungsmöglichkeiten in den verschiedenen Bereichen der Arbeit und der Verwaltung der Hochschule aufgezeigt werden: die Arbeitsbedingungen und die soziale Lage der Hochschullehrer und der Studenten, die Organisation einer demokratischen Hochschulselbstverwaltung, die Regelung der Beziehungen zwischen Hochschule und Staat und der finanziellen Förderung der Hochschulen.
Dabei wird stets an den letzten Maßstab aller dieser organisatorischen und ökonomischen Maßnahmen zu erinnern sein:
die möglichst freie Entfaltung der geistigen Kräfte und Begabungen der in der Hochschule tätigen Menschen.
Denn erst dadurch erhält eine effektive wissenschaftliche Forschung und Ausbildung ihren Sinn.
IV.2 Zur gegenwärtigen sozialen Lage der Hochschullehrer
Die Stellung der Hochschullehrer und ihre sozialen Probleme müssen in engem Zusammenhang mit den „Betriebsverhältnissen“ der Hochschule, vor allem der Struktur der Institute, gesehen werden, in denen die Hochschullehrer tätig sind.
Durch den bereits geschilderten Prozeß der Trennung der Wissenschaftler von ihren „Produktionsmitteln“ stehen sich in den Instituten der Hochschule zwei „Klassen“ von Wissenschaftlern gegenüber: vom Staat eingesetzte Institutsdirektoren und Lehrstuhlinhaber, ausgestattet mit der Verfügungsgewalt über die Betriebsmittel und mit Privilegien bei der Lehre und im Prüfungswesen, und eine ständig anwachsende Zahl von subalternen Wissenschaftlern und Lehrkräften.
Der Lehrkörper ist in der Form einer pyramidenartigen Hierarchie mit zahlreichen Stufen aufgebaut: Hilfskräfte und Hilfsassistenten, Assistenten und Oberassistenten, Lehrbeauftragte, Privatdozenten, apl. Professoren, (neuerdings) wissenschaftliche Räte, Abteilungsvorsteher, Extraordinarien und Ordinarien.
Eine relativ unabhängige Stellung haben dabei nur die Extraordinarien und Ordinarien inne. Alle anderen Lehrkräfte müssen unter der Leitung eines Direktors, der die Forschungseinrichtung bestimmt, arbeiten, denn es werden ihnen die notwendigen Arbeitsmittel nicht zur Verfügung gestellt. Der Direktor verfügt über die vorhandenen Arbeitsmittel und entscheidet, für welche Forschungsvorhaben des Instituts neue Mittel beantragt oder beschafft werden.
Die im 19. Jahrhundert als Ergänzung der autoritativen Lehrstühle geschaffene Privatdozentur konnte nur solange als eine „institutionelle Garantie“ der akademischen Freiheit wirken, wie ihre „plutokratische“ Voraussetzung - ein ökonomisch gesichertes Besitz - wie Bildungsbürgertum - erhalten blieb. Mit der Auflösung dieser Schicht und der steigenden Bindung wissenschaftlicher Arbeit an teure Betriebsmittel, sanken die Privatdozenten in die Stellung von abhängigen Assistenten, Oberassistenten, Lehrbeauftragten ab, oder sie wurden schließlich als „Diätdozenten“ schlecht und recht besoldet, wofür sie sich in den vom Lehrstuhlbesitzer geleiteten Betrieb einzufügen hatten. (125)
Wenn etwa ein Drittel der habilitierten Nichtordinarien als Assistenten tätig ist und damit direkt der Weisungsgewalt eines Ordinarius untersteht, so ist die Freiheit und Gleichberechtigung innerhalb des Kollegiums der Habilitierten vollends zerstört. (126) Aber neben der direkten Unterstellung unter die Weisungsgewalt eines Institutsdirektors bestehen noch andere, verwickelte Abhängigkeitsverhältnisse:
Die Freiheit der Lehre, die freie geistige Konkurrenz der Hochschullehrer - die zugleich Voraussetzung für ein freies Studium ist - wird ebenfalls stark eingeschränkt. Die Mehrzahl der Lehrkräfte, besonders in den naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächern, ist in der Lehre auf enge Spezial- und Randgebiete verwiesen, während den Ordinarien die Veranstaltung der großen Haupt- und Pflichtvorlesungen und von bevorrechteten Seminaren vorbehalten ist. Die Vorrechte der Ordinarien bei den Prüfungen führen dazu, daß sich die Studenten notgedrungen einseitig auf diese Lehrveranstaltungen ausrichten, während oft interessante Seminare und Vorlesungen von Nichtordinarien kaum besucht sind. So wird die überholte zunftmäßig-autoritäre Verfassung der Universität noch zu einem zusätzlichen Grund für die Überfüllung vieler Seminare und Vorlesungen.
Diese zunftmäßige Einschränkung der freien Lehre beruht auf dem erstarrten System der Kolleggelder und Prüfungsgebühren, das immer noch zu grotesken Ungerechtigkeiten führt, wenn es auch durch die vielfach geschaffene Kolleggeld-Garantie gemildert erscheint. Die ungünstigen Auswirkungen für Lehre und Studium bleiben jedoch die gleichen.
Die Laufbahn der wissenschaftlichen Nachwuchskräfte hängt im Wesentlichen vom Urteil und dem Einfluß ihres zuständigen Ordinarius ab. Es ist offenkundig, daß dabei oft rein persönliche Motive den Ausschlag geben: Vorurteile und Bequemlichkeit des Ordinarius, der Grad der Anpassungsbereitschaft auf Seiten der Nachwuchskräfte. Dieses System der Auslese stößt gerade die besten, selbständigen und aktiven Naturen ab, während die unselbständigen, anpassungsbereiten sich nach oben „dienen“. Nach einer 1954 durchgeführten repräsentativen Befragung (127) sprechen 50 % der befragten Hochschullehrer dem gegenwärtigen System der Ergänzung des Lehrkörpers eine ausgesprochen negative, nur 12% eine positive Auslesewirkung zu.
Da auf Grund der unzureichenden materiellen Förderung der Hochschulen immer noch zu wenig Lehrkräfte zur Verfügung stehen, werden die Assistenten und Lehrbeauftragten vom Institutsdirektor, der sich einen Freiheitsraum für die Forschung erhalten will, derart mit Verwaltungs- und Unterrichtsaufgaben überlastet, oder in den Dienst der Forschungsvorhaben des Direktors eingespannt, daß ihnen vielfach überhaupt keine Zeit zur eigenen freien wissenschaftlichen Arbeit bleibt.
Zu den verschiedenen Formen der Privilegierung und Abhängigkeit, die eine freie Entfaltung der Fähigkeiten und Initiativen der meisten Hochschullehrer nicht zulassen, tritt aber noch die relativ schlechte und ungesicherte soziale Lage der meisten Hochschullehrer hinzu.
Dabei ist vor allem an die völlig ungesicherte berufliche Zukunft der nicht planmäßigen Lehrkräfte zu denken. Selbst gut qualifizierte Assistenten, die fünf oder mehr Jahre in einem Institut tätig waren, können bei einem „Chefwechsel“ einfach - nach kurzer Kündigungsfrist - hinausgeworfen werden, oder sie verlieren dadurch ihren „Fürsprecher“ für eine Habilitation, wodurch ihre Laufbahn in den allermeisten Fällen beendet ist.
Die kleine Zahl der Lehrstühle und Diätdozenten macht die Laufbahn des Hochschullehrers, wie sich Max Weber ausgedrückt hat, zum reinen „Hazard“ (128). Wie verhängnisvoll sich dieses verfehlte Auslesesystem in den letzten 15 Jahren ausgewirkt hat, ergibt sich aus einem statistischen Querschnitt für das Wintersemester 1953/54, wonach für rd. 2000 habilitierte Nichtordinarien nur 400 Diätdozenturen zur Verfügung standen, von denen 5-10 % nicht besetzt waren. (128) Da die Mehrzahl dieser Habilitierten auf Assistentenstellen oder eine Tätigkeit außerhalb der Hochschule angewiesen war, trat eine bedenklich Verschiebung der Altersstufen ein: Das Durchschnittsalter der habilitierten Assistenten war 39,8, der Oberassistenten 42,9, der Diätdozenten 45,7, das durchschnittliche Erstberufsalter betrug 45,4 Jahre. (129) Leider wurden seitdem keine genauen Erhebungen angestellt. Eine prinzipielle Veränderung hat sich jedoch noch nicht ergeben. Immer noch - auch nach allmählicher Einführung der auf der Honnefer Hochschulkonferenz (1955) konzipierten Stellen für „Wissenschaftliche Räte“ - nimmt die Zahl der Assistenten und Hilfskräfte der festbeamteten Mitglieder des Lehrkörpers. (130) Außerdem ist auch für ein Überwechseln von Assistenten und Habilitierten in andere, verwandte Berufe kaum Vorsorge getroffen.
Obwohl sich seit einigen Jahren die Bezahlung der Assistenten und Hilfskräfte verbesserte, werden diese Verbesserungen oft dadurch unwirksam, daß die bestehenden Stellen z.T. auf mehrere Anwärter aufgeteilt werden, weil viel zu wenig Stellen eingeplant sind. Auf jeden Fall ist die Bezahlung der Assistenten und nicht planmäßigen Lehrkräfte im Verhältnis zu vergleichbaren „Laufbahnstufen“ von Akademikern außerhalb der Hochschule unzureichend.
Bedenklich ist also nicht nur, daß durch die wissenschaftsfremden Abhängigkeitsverhältnisse und Privilegien die freie Entfaltung der Fähigkeit und Begabungen innerhalb des Lehrkörpers verhindert wird, sondern die ungünstige soziale Lage der meisten Hochschullehrer bildet für viele wissenschaftlich qualifizierte Kräfte keinen Anreiz mehr, sich dem Glücksspiel einer solchen Laufbahn zu widmen. Die Hochschule gerät in die Gefahr, selbst bei ausreichender Finanzierung von Planstellen keinen ausreichenden geeigneten Nachwuchs mehr zu finden. Die Besetzung der vom Wissenschaftsrat als Minimalforderung empfohlenen 1200 neuen Lehrstühle ist daher auf Grund der bisherigen Versäumnisse in .der Nachwuchsförderung noch für längere Zeit in Frage gestellt.
IV.3 Die Probleme des Lehrkörpers im Rahmen der Hochschulreform
Nach diesem Überblick über die gegenwärtige Situation sollen einige Reformversuche zur Verbesserung der sozialen Lage und zur Neugliederung des Lehrkörpers geprüft werden, die im Zentrum der bisherigen Hochschulreformdiskussion gestanden haben.
Das Dogma dieser zumeist konservativen Reformkonzeptionen war die mißverstandene Formel von der „im Kern gesunden“ deutschen Hochschule. Hatte der Hamburger Studienausschuß von 1948 in seinem. „Blauen Gutachten“ die Hochschulen als die „Träger einer alten und im Kern gesunden Tradition“ bezeichnet, die aber einer ständigen Reform bedürften, so wurde im Verlauf der weiteren Hochschulreformdiskussion kurzerhand die Wirklichkeit der Hochschulen für „kerngesund“ erklärt. Galt der Kernbereich der Hochschule als gesund, so bedurfte es nur der Reparatur an der Peripherie.
Im Rahmen der allgemeinen Verengung der Hochschulreformbestrebungen wurde bald auch die Lösung der sozialen Probleme des Lehrkörpers nicht mehr in seiner Verknüpfung mit der autoritär erstarrten Hochschulverfassung gesehen, wie es z.B. noch in dem Gutachten der „British Association of University Teachers“ aus dem Jahre 1947 zum Ausdruck kommt, wo es u.a. heißt:
„Was uns am meisten auffiel, war die persönliche Abhängigkeit von Dozenten gegenüber Professoren und die daraus erwachsende Unsicherheit ihrer Stellung. Die Professoren halten zu oft an diesem autoritären Zwang fest, und die angehenden Dozenten entwickeln zu oft eine servile Haltung, die einen sehr schlechten Einfluß auf sie selber, auf ihre Vorgesetzten und auf die Studenten ausübt. “(131)
Es wurden bald nur noch isoliert von diesem Gesamtzusammenhang verschiedene Konzeptionen für eine Ergänzung der bestehenden Lehrkörper-Hierarchie entwickelt. Solche Pläne sollten zwei Aufgaben erfüllen: die völlig ungesicherte Stellung der Lehrkräfte des sog. Mittelbaus zu mildern und die Anpassung der Anzahl der Lehrkräfte an die gestiegenen Studentenzahlen zu erreichen.
Schon im „Blauen Gutachten“ wurde als Lösung die Schaffung einer neuen Klasse von Lehrkräften, der sog. „Studiendozenten“ und „Studienprofessoren“ vorgeschlagen, die sich nicht der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, sondern dem davon begrifflich getrennten akademischen Unterricht und der Einführung des Studenten in das Studium widmen sollten. In dem Gutachten „Neugliederung des Lehrkörpers“ des Hofgeismarer Kreises von 1956 wird die Tendenz zur Bewahrung und Absicherung des Kerns der erstarrten Universitätsstruktur ganz deutlich: Es wird starr festgehalten an der Konzeption des Lehrstuhlinhabers als des autoritativen einzigen „Fachvertreters“, an der „Festlegung der wissenschaftlichen Richtung“ des Faches durch den Institutsdirektor, besonders „in den großen Instituten, vor allem bei den Kliniken. “ (132)
Die Planstellen sollten in erster Linie auf der mittleren und unteren Ebene vermehrt werden. Relativ zu den anderen Stufen der Hierarchie gesehen würde die Zahl der Lehrstuhlinhaber sogar noch verkleinert werden. Im Sinne einer „vernünftigen Funktionsteilung“ zwischen „Funktionsgruppen“ für Forschung und Lehre einerseits und für Unterricht und Berufsvorbildung andererseits sollte ein materiell gesicherter zweiter Stand von Hochschullehrern („Unterrichtsgruppe) geschaffen werden, wodurch den Lehrstuhlinhabern im „Zeitalter der Massengesellschaft“ wieder ein Weg zur Freiheit gebahnt werden sollte. Dadurch würde die bestehende Hierarchie unter fester Kompetenzabgrenzung noch um eine weitere Stufe erhöht und verfestigt werden, und die Idee der kollegialen Gleichberechtigung der akademischen Lehrer wäre auch formell aufgegeben. Es gäbe zwei „Stände“ von Hochschullehrern für zwei Klassen von Studenten, Forscher und Lehrer für die „ Elite“ der wissenschaftlich Studierenden, Unterrichtskräfte für die „Masse“, die „nur“ Berufsvorbildung sucht.
Das Modell des Hofgeismarer Kreises wurde vor allem deshalb abgelehnt, weil es hinterrücks gerade den „gesunden Kern der Tradition“ nämlich das Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre verlassen hatte. Mit Recht ist dagegen auch eingewendet worden, daß es zweifelhaft sei, ob dadurch die Lehrstuhlinhaber wieder für ihre eigentlichen wissenschaftlichen Aufgaben freigesetzt wären. Denn:
„Mit zunehmendem Größenwachstum der Institution und fortschreitender Differenzierung der Aufgaben ist die Aufrechterhaltung des Herrschaftsanspruchs nur bei zunehmender Beschränkung auf Herrschaftsfunktionen denkbar. Herrschaft im modernen Sinne aber ist Verwaltung, die zur „eigentlichen“ Arbeit der Institutsleiter wird. Als die einzigen verantwortlichen und repräsentativen Fachvertreter werden sie zu bloßen Anregern, Koordinatoren, „Managern“ der wissenschaftlichen Arbeit.“ (133)
Die Hochschultagung in Honnef, 1955 von der WRK und den Kultusministern veranstaltet, die sich zuerst mit der „Gliederung und Ergänzung des Lehrkörpers“ beschäftigte, wählte einen anderen Weg der Reparatur am Rande, ohne den Kern der Hierarchie anzutasten: Die Zahl der Diätdozenturen sollte vermehrt werden, und vor allem wurde die Einrichtung neuer Dauer-Planstellen (auf Lebenszeit) für sog. „Wissenschaftliche Räte“ beschlossen. Diese Institution wurde in einigen Hochschulen z.T. dazu benutzt, Nachwuchskräfte auch ohne Habilitation in gesicherte Stellungen zu bringen. Aber in vielen Fällen obsiegte das Vorurteil der beamteten Ordinarien gegen die frühzeitige „Verbeamtung“ ihrer jüngeren Kollegen und es wurden nur ältere, bewährte Nichtordinarien, die bisher z.T. noch Assistentenstellen besetzten, zu Wissenschaftlichen Räten ernannt, wodurch auch die Forderung nach Einrichtung von Parallellehrstühlen entschärft werden konnte.
Diese Praxis entsprach auch durchaus der Grundeinstellung der Mehrzahl der Hochschullehrer, wie aus der Hochschullehrer-Untersuchung von H. Anger hervorgeht. Danach treten nur 34 % der Befragten ohne das Vorurteil der „Verbeamtungsgefahr“ für die Einrichtung einer wirklich gesicherten Durchgangsstellung in der Art der Wissenschaftlichen Räte ein, z.T. allerdings nur als Abstellgleis für ältere Nichtordinarien. Nur 13 % fordern, die Zahl der Lehrstühle zu erhöhen, aber 51 `%, meistens Ordinarien, verlangen lediglich mehr Geld und mehr Assistentenstellen und Hilfskräfte für die Lehrstuhlinhaber. (134) Damit würde die seit Jahrzehnten bestehende Tendenz zur Ausweitung der Unterschicht aus wirtschaftlich ungesicherten, vom Lehrstuhlinhaber abhängigen Mitarbeitern bei gleichzeitiger relativer Verkleinerung der Mittel- und Spitzengruppe noch beschleunigt werden.
Der Wissenschaftsrat ist mit seiner „Empfehlung über die Eingliederung neuer Dauerstellen in die Lehrkörper der wissenschaftlichen Hochschulen“ zwar dieser Tendenz nicht bewußt gefolgt, aber seine Empfehlungen können in der Praxis leicht in diese Richtung verbogen werden, da sie widerspruchsvolle Elemente enthalten:
Einerseits soll die Zahl der Lehrstühle radikal vermehrt werden, auch durch Einrichtung von Parallellehrstühlen, aber andererseits werden keine annehmbaren und-zahlenmäßig ausreichenden Durchgangsstellen für Nachwuchskräfte geschaffen: stattdessen wird die Einrichtung von sog. „Auffangstellen“ für Nichtordinarien im „Mittelbau“ in den Vordergrund gestellt, um die Nichtordinarien von der einseitigen Orientierung auf den Lehrstuhl als Berufsziel abzulenken. Es werden Dauerstellen für „Abteilungsvorsteher“ und „Wissenschaftliche Räte“ vorgesehen, für die im Unterschied zu Honnef (s. o.) die Habilitation zur Vorbedingung gemacht wird. Das bedeutete gegenüber der an einigen Universitäten üblichen Praxis der Verwendung der wissenschaftlichen Ratsstellen zur Sicherung von Habilitanden einen Rückschritt in der Lösung des Nachwuchsproblems. Für die Vorbereitung auf die immer schwieriger werdende Habilitation und zur Erreichung einer Dauerstelle bleibt wiederum nur der Weg über eine langjährige Assistentur, die weiterhin als Sieb zur Abschreckung selbständiger begabter Nachwuchskräfte wirkt, die lieber in die Berufspraxis oder in die außeruniversitäre Forschung abwandern. Dadurch aber muß die Besetzung der zahlreichen neuen Lehrstühle in den nächsten Jahrzehnten vollends zweifelhaft erscheinen.
Außerdem legen es diese Empfehlungen den Fakultäten geradezu nahe, selbst die ältesten bewährten Nichtordinarien zunächst in der neueingebauter Hierarchie-Stufe „Abteilungsvorsteher“ und „Wissenschaftlicher Rat“ (in der Regel mit Professorentitel) „aufzufangen“, wodurch die Besetzung vakanter oder empfohlener Lehrstühle wieder einmal geschickt umgangen werden kann.
Außerdem kommt der Wissenschaftsrat den Wünschen der Ordinarien entgegen, wenn er an dem System der Unterordnung mehrerer Assistenten unter einen Lehrstuhlinhaber festhält, diese Lösung sogar noch ausgebaut wissen will (in den naturwissenschaftlichen Fächern und in der theoretischen Medizin im Durchschnitt 4 Assistenten je Lehrstuhl). Die Mehrzahl dieser Assistenten besteht jedoch gar nicht mehr aus echten „Gehilfen“ des Professors, sondern sie erfüllen Aufgaben von selbständigen Lehrkräften (als sog. „Unterrichtsassistenten“ des Ordinarius, die in seinem Namen - „Prof. XY durch Assistent“ - Seminare und Übungen veranstalten), ohne deren Rechte und Unabhängigkeit zu besitzen, oder sie sind z.T. bereits habilitiert, aber dienstlich von Weisungen ihres „Kollegen“ abhängig. Diese Tendenz zur Festigung der Machtstellung der Lehrstuhlinhaber wird sich sogar noch eindeutiger durchsetzen, als es der Wissenschaftsrat vorgesehen hat, denn es ist zu berücksichtigen, a) daß die Vermehrung der Lehrstühle wegen der Versäumnisse in der Nachwuchsförderung und der restriktiven Berufungspraxis vieler Fakultäten im großen Maßstab sich erst in einigen Jahrzehnten auswirken wird, b) daß die Westdeutsche Rektorenkonferenz in ihrer Stellungnahme zu den Empfehlungen sich für eine noch stärkere Vermehrung der Assistentenstellen je Lehrstuhl ausgesprochen hat, was vom Standpunkt der Studienverhältnisse sicher zu begrüßen, aber für die Nachwuchsförderung eine einseitige, unzureichende Maßnahme ist.
Nach den Vorstellungen des Wissenschaftsrates sollen außerdem die zahlenmäßigen Relationen zwischen dem gesamten Mittelbau (einschließlich „Studienräte im Hochschuldienst“ und Diätendozenten) und der Spitzengruppe der Lehrstuhlinhaber nur 2:3 betragen, das Zahlenverhältnis zwischen Assistenten und Lehrstühlen (im Gesamtdurchschnitt) dagegen 2,3:1.
Außerdem hat der Wissenschaftsrat auch den durch die Stationen „Blaues Gutachten“ und „Hofgeismar“ bezeichneten Faden wieder aufgenommen, die Konzeption einer zweiten Klasse von Hochschullehrern: „ … für Unterrichtstätigkeiten …, die der Wissenschaftsvermittlung, der methodischen Schulung, der Berufsvorbildung sowie der Beratung von Studenten dienen“ (135) sollen Dauerstellen für „Studienräte im Hochschuldienst“ geschaffen werden und zusätzlich Beamte des höheren Dienstes befristet für Unterrichtstätigkeiten an die Hochschulen abgeordnet werden. Der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Prof. Raiser, hat dazu ausdrücklich erklärt, die Studienräte im Hochschuldienst sollten sich nur der Lehre widmen, wobei diese Funktionsteilung entgegen bestehenden Ansichten durchaus heilsam sein könne. (136)
Dieser Vorschlag ist in erster Linie daran zu messen, inwieweit er den Bedürfnissen des Unterrichts, besonders in der ersten Hälfte des Studiums - vor den projektierten oder schon bestehenden Zwischenprüfungen - gerecht wird. Wie bereits ausgeführt wurde (Vgl. Kapitel II) müssen im ersten Studienabschnitt zwei Aufgaben erfüllt werden:
- Der Student muß bestimmte Fachkenntnisse, Methoden und Techniken in Übungen, Kursen und Praktika lernend erwerben.
- Der Student muß gleichzeitig in die vom Schulunterricht grundsätzlich sich abhebende Form selbständig-kritischen wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens durch Mitarbeit in kleinen Proseminaren und Tutorengruppen eingeführt werden.
Nur für die erste Aufgabe erscheinen besonders ausgebildete Fachleute in Dauerstellen, in der Art von Studienräten im Hochschuldienst und Lektoren geeignet. Für die zweite Aufgabe dagegen müssen Wissenschaftler, die selbst intensiv mit wissenschaftlicher Forschungsarbeit beschäftigt sind, herangezogen werden; da die Zahl der habilitierten Lehrer nicht ausreicht auch jüngere wissenschaftliche Nachwuchskräfte.
Es besteht die Gefahr, daß bei der nach wie vor unzureichenden Anzahl von Assistenten und Dozenten, die für eine intensivere (d.h. in kleinen Gruppen erfolgende) Einführung der Studenten in die wissenschaftliche Arbeitsweise zur Verfügung stehen, diese Aufgabe ebenfalls mehr und mehr nur noch den Studienräten (Akademischen Räten) überlassen wird, die im allgemeinen nicht die erforderliche enge Beziehung zur wissenschaftlichen Forschung ihrer Fachrichtung haben können, da sie stark durch Routinearbeiten in Anspruch genommen werden und zu den Forschungsarbeiten ihres Instituts nicht herangezogen werden. Eine noch stärkere Verschulung des Unterrichtsbetriebs zumindest im ersten Studienabschnitt wäre die Folge.
IV.3.1 Der Lehrkörper und die Struktur der Institute
Der Wissenschaftsrat hat andererseits im Unterschied zu den bisherigen Plänen zur Gliederung des Lehrkörpers diese Frage im Zusammenhang mit der Struktur der Institute gesehen und behandelt.
Die Verknüpfung von autoritärer Betriebsstruktur der Institute und der Lehrkörperhierarchie ist der eigentliche „ungesunde Kern“ der gegenwärtigen Problematik des Lehrkörpers.
Der Wissenschaftsrat bekennt sich ganz offen und kritiklos zu diesem Prinzip, wenn er als Maßstab für die Größe der Institute vor allem die „Überschaubarkeit“ des Instituts durch den Lehrstuhlinhaber und Direktor einführt. Nur wo es sich aus technischen und wissenschaftlichen Gründen auf keinen Fall vermeiden läßt, sollen größere, in Abteilungen gegliederte und kollegial von mehreren Ordinarien geleitete Institute zugelassen werden. Im allgemeinen sollen die Institute nicht den Arbeitsbereich eines Lehrstuhlinhabers überschreiten, und bei Errichtung von Parallellehrstühlen des gleichen Faches „ist die Errichtung von Parallel-Instituten für die betreffende Disziplin der Entwicklung übermäßig grosser Institute grundsätzlich vorzuziehen (137).“
Wird aber bei der ständig zunehmenden Spezialisierung der Forschung und der „Auffächerung“ traditioneller Disziplinen an dem Direktorialprinzip festgehalten, so müssen auf lange Sicht zwangsläufig immer mehr und immer enger spezialisierte kleine Lehrstuhlinstitute gegründet werden, denn obwohl die „Parallel-Lehrstuhlinhaber“ theoretisch die gesamte traditionelle Disziplin vertreten sollen, werden sich in der Praxis der Forschung und damit indirekt auch in der Lehre und im Studium einseitige Schwerpunkte herausbilden müssen, die einer Untergliederung des Faches gleichkommen, aber einer Gliederung, die nicht arbeitsteilig koordiniert wird.
Aber auch bei Errichtung der ausnahmsweise etwas größeren Institute soll zwar geprüft werden, „ob die monokratische Leitung durch eine kollegiale Verwaltung gleichberechtigter Ordinarien ersetzt werden kann“ (138), aber andererseits werden gerade für die „Leitung von größeren Abteilungen“ Nichtordinarien als Abteilungsvorsteher vorgeschlagen, die ausdrücklich nur beratend an der „Führung des Instituts“ durch den Direktor beteiligt sein sollen. (139) Auch die Abteilungen arbeiten im Zweifelsfalle auf Anweisung von oben, von Seiten eines allmächtigen Direktors. Es ist nicht ersichtlich, warum ein erfahrener, habilitierter Wissenschaftler, der als Leiter einer größeren Abteilung Aufgaben eines Lehrstuhlinhabers in einem kleinen Institut ausfüllt, nicht die Rechte eines solchen besitzen soll. Mit dem Prinzip der zentralen Führung aller Abteilungen eines großen Instituts wird das Direktoralprinzip geradezu auf die Spitze getrieben: die mangelnde Überschaubarkeit eines Instituts durch einen Direktor soll Anlaß zur Bildung größerer Abteilungen sein, die dann wiederum alle von einem vorgesetzten Direktor beaufsichtigt werden.
Damit wird der Wissenschaftsrat seinem Anspruch, darauf zu ächten, daß der Grundcharakter der Hochschule als „Gemeinschaft gleichberechtigter Gelehrter“ überall wieder voll zur Geltung kommt nicht gerecht. (140)
IV.4 Neuordnung der Arbeitsverhältnisse des Lehrkörpers
Nach dem Rückblick auf die bisherigen Versuche einer Lösung der sozialen Probleme des Lehrkörpers und der Anpassung seiner Struktur an die heutigen Anforderungen in Forschung und Lehre soll im folgenden versucht werden, einen neuen Ansatz zu finden, für die volle Verwirklichung und Weiterentwicklung der im Kern durchaus gesunden Tradition, die in dem tragenden Organisationsprinzip der modernen deutschen Universität liegt - dem Prinzip der Freiheit und Einheit von Forschung und Lehre - unter den Bedingungen der heutigen „industrialisierten“ und spezialisierten Wissenschaft und in einer Hochschule, die sich der Verfassungsnorm der sozialen Demokratisierung konfrontiert sieht. Dabei ist davon auszugehen, daß die Lösung der sozialen Probleme und die Sicherung der freien wissenschaftlichen Betätigung der Hochschullehrer nur im Zusammenhang mit einer Umgestaltung der gegenwärtigen Betriebsstruktur der Hochschulen erfolgen kann.
Es muß daher vor allem geprüft werden, ob und wie die wichtigste Arbeitsstätte der Hochschullehrer, das Institut bzw. die Klinik auf Grund der sachlichen Erfordernisse von Forschung und Lehre nach dem Prinzip der akademischen Freiheit des Einzelnen und nach dem demokratischen Grundsatz der Ausschaltung sachfremder Autorität organisiert und geleitet werden kann.
IV.4.1 Der wissenschaftliche Arbeitsprozeß und die Struktur des Lehrkörpers
Der Ausgangspunkt ist somit nicht ein abstraktes Prinzip der Demokratie, das schematisch als leere formalistische Gleichmacherei von außen, an die wissenschaftlichen Betriebsverhältnisse herangetragen wird, sondern die Überzeugung, daß aus der immanenten Tendenz aller Wissenschaft, die diesen Namen verdient, sich in einem Prozeß freier kritischer Auseinandersetzung zu entfalten, notwendig das demokratische Prinzip der Ablösung aller wissenschaftsfremden, wissenschaftsfeindlichen Abhängigkeitsverhältnisse erwächst.
Die Universität kann ihre Aufgabe in der Gesellschaft - wissenschaftliche Erkenntnisse zu erarbeiten und zu vermitteln und damit verknüpft Studenten und Wissenschaftlern Ausbildung und Bildung zu ermöglichen - nur dann sinnvoll und effektiv erfüllen, wenn sie organisatorische Vorkehrungen trifft, die eine möglichst selbständige Entfaltung der geistigen Kräfte und Begabungen aller ihrer Angehörigen fördern. Sicherlich müssen diese organisatorischen Mittel heute andere sein, als in der Universität Humboldts, aber das Ziel bleibt dasselbe.
Die gegenwärtige Situation der Betriebsverhältnisse in der Hochschule und die Stellung des Lehrkörpers darin scheint oberflächlich betrachtet, durch zwei widersprüchliche Tendenzen bestimmt zu sein: Die steigende Technisierung und Bürokratisierung des Wissenschaftsbetriebs rechtfertigt scheinbar die Übertragung von Organisationsformen der Wirtschafts- und Verwaltungsbürokratie auf die Hochschule - das monokratische Direktorialprinzip mit klarer Kompetenzabgrenzung nach Instituten und Abteilungen und verschiedenen Stufen der Abhängigkeit (Hilfskraft, Assistent, Wissenschaftlicher Rat, Abteilungsvorsteher, Direktor) erscheint „rationeller“ als die scheinbar antiquierte kollegiale akademische Selbstverwaltung, die darum auf die Institutsverwaltung keine Anwendung findet; andererseits hat die Technisierung und Bürokratisierung und die parallel laufende Spezialisierung der Wissenschaft dazu geführt, daß die Direktoren der Institute entweder nur noch Spezialisten unter anderen oder aber nur noch Wissenschafts-Manager sind. In beiden Fällen können sie die wissenschaftliche Arbeit der ihnen unterstellten Wissenschaftler kaum noch überblicken, geschweige denn sinnvoll koordinieren und leiten. Ihre Herrschaftsansprüche „werden heute plötzlich betriebsfremd, betriebsstörend. “ (Baumgarten)
Es ist paradox, daß erst der Hinweis auf die im allgemeinen fast als Entartung kritisierte hochgradige Spezialisierung die Eigenart des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses gegenüber den Arbeitsgängen in einem Industriebetrieb wieder bewußt macht. Denn obwohl in beiden Betriebsformen z.T. umfangreiche technische Mittel und Einrichtungen zu verwalten sind und technisches Hilfspersonal zu leiten ist, haben diese beiden „Produktionsprozesse“ ganz verschiedene Vorzeichen:
Die angewandte Forschungs- und Entwicklungsarbeit in einem Industrieinstitut erfolgt (abgesehen von einigen Institutionen der freien Forschung) wie die Produktion selbst, in deren Ablauf und Gesetzmäßigkeit sie eingeordnet ist, nach einem vorgegebenen Plan, dessen Ziel, möglichst rationell und wirtschaftlich, zweckmäßig zu erfüllen ist. Dafür ist ein Direktor verantwortlich, dessen Anweisungen die Mitarbeiter sich unterzuordnen haben.
Die nicht zweckgebundene wissenschaftliche Forschung dagegen läßt sich ihres spezifischen Charakters wegen nicht in ein bürokratisches Verwaltungsschema nach den Regeln wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit pressen. Die Originalität und Spontaneität jeder wissenschaftlichen Erkenntnis oder Entdeckung, die niemand voraussagen oder im voraus fordern kann, macht es unmöglich, daß Wissenschaftler auf Anweisung eines Vorgesetzten zur Erfüllung eines vorgegebenen Planzieles arbeiten, das entweder von außen (von der Wirtschaft, vom Staat) der Universität aufgetragen oder von einigen wenigen Institutsdirektoren dem Gros der abhängigen wissenschaftlichen Mitarbeiter auferlegt würde. Die Wissenschaftler würde*' [FEHLER] stets entweder viel weniger oder viel mehr oder etwas völlig anderes erarbeiten, als im Planziel vorgesehen.
Andererseits kann ein kontinuierlicher, im Überblick verständlicher und allgemeingültiger wissenschaftlicher Fortschritt nur dadurch erzielt werden, daß mehrere Wissenschaftler ihre Erkenntnisse, die jeweils nur einen kleinen Bruchteil des gesamten Wissensbestandes ': [FEHLER] und Erkenntnisfortschritts darstellen, zur Lösung weitgespannterer und dadurch umso sinn vollerer Probleme zusammentragen und gegenseitig überprüfen. Diese Grundtatsache, daß jede wissenschaftliche Erkenntnis unberechenbar und nur ein Beitrag zur Lösung größerer ' [FEHLER] oder anderer Forschungsprobleme darstellt, wird durch die hochgradige Spezialisierung nur noch besonders zugespitzt.
Das Grundproblem besteht also darin, daß einerseits die Spontaneität wissenschaftlicher Erkenntnis garantiert und einkalkuliert werden muß, andererseits ein kontinuierlicher Fortschritt und Sinnzusammenhang der Wissenschaft nur durch die in Kooperation umschlagende gegenseitige Kritik und Konkurrenz einer Gruppe von Wissenschaftlern möglich ist, von denen jeder nur einen Beitrag liefert.
In der Universität müssen Organisationsformen entwickelt werden, die diesen dialektischen Ablauf von Spontaneität-Konkurrenz-Kooperation (oder von schöpferischer Einzelleistung - kritischer Auseinandersetzung - koordinierender Planung) möglichst sinnvoll und effektiv gestalten.
Forschung und rationelle Organisation schließen sich also nicht aus; aber die Übertragung derjenigen rationellen Organisationsprinzipien, die in Wirtschaft und Verwaltung noch unvermeidlich erscheinen auf die Wissenschaft in der Hochschule ist irrational und sachfremd.
Das durch einen privilegierten Direktor monokratisch geleitete Institut ist eine wissenschafts fremde bürokratische Organisationsform, mag sich der Institutsleiter noch so sehr bemühen, diesen Eindruck durch menschliche Autorität und Toleranz zu mildern.
Die Universität wird also ihrer Aufgabenstellung nur gerecht, wenn sie die ihr gemäßen besonderen Organisationsformen ständig selbstkritisch überprüft und weiterentwickelt.
Allein schon auf Grund solcher wissenschaftsimmanenter Maßstäbe müßten im Hinblick auf die gegenwärtige autoritär-erstarrte Struktur des Lehrkörpers einige einschneidende Konsequenzen gezogen werden:
1. Um die Spontaneität wissenschaftlicher Erkenntnis zur Geltung kommen zu lassen, um dem einzelnen Wissenschaftler die Chance eigener selbständiger Forschungsarbeit zu garantieren, muß die monokratische Direktorialverfassung der Institute ersetzt werden durch die kollegiale Selbstverwaltung des Lehrkörpers auch im Rahmen des Instituts.
Das wäre keine der Universität fremde „Gleichmacherei“, sondern die der heutigen Größe und Betriebsstruktur der Universität adäquate Realisierung der alten Idee der Gelehrtenrepublik, nicht mehr nur für einige Privilegierte (in der Fakultät), sondern für alle Lehrkräfte und wissenschaftliche Mitarbeiter. Denn in den Instituten fallen heute die für Forschung und Lehre in erster Linie relevanten Entscheidungen. Im Rahmen der kollegialen Selbstverwaltung in den Instituten müssen sich die habilitierten Hochschullehrer mit den nichthabilitierten wissenschaftlichen Mitarbeitern unter Mitwirkung der Studentenschaft über die Ziele ihrer gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeit und über die Verwendung der notwendigen Betriebs- und Arbeitsmittel einigen. Dabei müssen allen wissenschaftlichen Lehrern und Mitarbeitern für individuelle oder kooperative Forschungsarbeiten Mittel und Einrichtungen des Instituts zur Verfügung gestellt werden.
Um allen Lehrkräften die Chance zu eröffnen, sich durch wissenschaftliche Veröffentlichungen einen Namen in ihrer Wissenschaft zu machen, müssen sie neben ihrer Lehr- und Verwaltungstätigkeit mehr Zeit für ihre eigenen Forschungsarbeiten erhalten. Jeder wissenschaftliche Lehrer und Assistent sollte nach einem bestimmten Turnus für ein Jahr von seinen Pflichten in Lehre und Unterricht entbunden werden, um Forschungsreisen zu unternehmen und wissenschaftliche Veröffentlichungen fertigzustellen. (Vgl. die Einrichtung des sog. „sabbatical year“ in englischen Universitäten).
2. Um die freie Konkurrenz aller Mitglieder des Lehrkörpers in der wissenschaftlichen Lehre zu verwirklichen, müssen die Vorrechte der Ordinarien bei der Abhaltung von Prüfungen und zur Veranstaltung von Pflichtvorlesungen und bevorrechteten Seminaren beseitigt werden. Das ist nur durch Abschaffung der Kolleggelder und Prüfungsgebühren zu erreichen. An ihre Stelle muß eine noch differenzierter gestaffelte Besoldung treten, die eine wissenschaftliche Laufbahn im Vergleich zu ähnlichen Berufswegen anziehend macht und die es den Hochschulen gestattet, Professoren auch nach dem Ruf, den sie in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit genießen, zu besolden.
Die Aufgaben der Hochschullehrer in Lehre und Unterricht müssen auf Sitzungen, an denen alle Lehrkräfte eines Instituts teilnehmen (auch die an den Lehraufgaben beteiligten wissenschaftlichen Mitarbeiter, wie z.B. Assistenten, Tutoren), je nach den Forschungsinteressen den Fähigkeiten der einzelnen sowie aufgrund ihrer festgelegten Mindestverpflichtungen zur Wahrnehmung von Lehraufgaben aufgeteilt werden.
Dabei sollten möglichst Lehrveranstaltungen verschiedener Lehrkräfte zum gleichen Thema stattfinden oder Seminare und Colloquien von mehreren Hochschullehrern gemeinsam veranstaltet werden, um unter den Studenten die kritische Urteilsbildung zu fördern und um unter den Lehrern das wissenschaftliche Streitgespräch und die Kooperation wieder zu beleben.
3. Nach dem Grundsatz „hochgradige Spezialisierung bei engster Zusammenarbeit“ muß auch in den deutschen Hochschulen die Kooperation von Wissenschaftlern im freien teamwork gefördert werden, wie es in Hochschuhen und Forschungsstätten anderer Länder schon vielfach der Fall ist (besonders in den USA und England).
Die Methoden und Formen solcher Zusammenarbeit sind der Soziologie als Forschungsobjekt seit langem vertraut. Aber es geschieht relativ selten, daß sie es der wissenschaftlichen Arbeit der Hochschule angewendet und erprobt werden. Der Soziologe Professor Baumgarten hat die deutschen Hochschullehrer in seinen Vorträgen und Aufsätzen auf diese Arbeitsformen hingewiesen:
„Neue Formen der Rollen-Delegation, der Arbeitsteilung und Arbeitsverbindung, kurz: Techniken neuartiger, intensiverer Kooperation sowohl zwischen über- und untergeordneten Rangträgern sind nötig geworden. Mit der Delegation von Aufgaben und Korn-. petenzen, Qualifikationen, muß eine Delegation auch von Machtbefugnissen stattfinden, es sei denn, daß wir uns mit immer wachsenden, durchaus bösartigen Spannungen abfinden wollen. “ (141)
Jüngere und ältere Wissenschaftler mit verschiedenen, sich ergänzenden Spezialkenntnissen und Erfahrungen sollten sich aus eigener Initiative zur Arbeit an begrenzten Forschungsaufgaben zusammenfinden, um sich in regelmäßigen Arbeitssitzungen und Konsultationen laufend zu informieren und ihre Arbeitsergebnisse kritisch zu überprüfen und zu ergänzen.
Derartige Formen der Kooperation könnten dadurch gefördert werden, daß besondere finanzielle und technische Mittel nicht in erster Linie einzelnen Professoren, sondern Forschungsgruppen zur Verfügung gestellt werden. Auch die Finanzierung von Veröffentlichungen der Arbeitsergebnisse solcher Gruppen sollte vorrangig gefördert werden.
Die Maxime intensiver Spezialisierung bei gleichzeitiger engster Zusammenarbeit muß auch Maßstab bei der Prüfung der optimaler Größe von Instituten sein. Die ständige Kooperation von wissenschaftlichen Lehrern und Mitarbeitern in wechselnden, freien Forschungsgruppen und Informationsbesprechungen läßt sich in größeren Instituten, die in mehrere Abteilungen gegliedert sind, leichter herstellen als in voneinander relativ isolierten kleinen Lehrstuhlinstituten.
Durch die Einordnung benachbarter Spezialfächer in größere Institute kann auch die Konkurrenz und gegenseitige Beeinflussung verschiedener theoretisch-methodischer „Schulen“ einer Fachwissenschaft gefördert werden.
Auch eine sinnvolle wissenschaftliche Fachausbildung der Studenten erfordert die Vermittlung eines Überblicks über einen größeren Zusammenhang mehrerer benachbarter Spezialrichtungen eines Faches. Bei der Ausbildung der Studenten müssen Lehrkräfte mehrerer Fachgebiete zusammenwirken, da auch die Ordinarien nicht mehr den vollen Überblick über eine ganze Disziplin haben können. Andernfalls besteht die Gefahr, daß das Niveau der Ausbildung sinkt und sich von der eigentlichen - aber notwendig spezialisierten - wissenschaftlichen Arbeit noch weiter entfernt, indem sich die Professoren auf einen oberflächlichen, nicht am neuesten Stand der Forschung überprüften Überblick beschränken müssen und die notwendige exemplarische Vertiefung des Studiums nicht erfolgt.
Nicht die Arbeitsteilung zwischen einer Funktionsgruppe hochspezialisierter Wissenschaftler, die nur noch am Rande für den wissenschaftlichen Nachwuchs in die Ausbildungsaufgaben eingeschaltet sind, und einer zweiten Gruppe weniger spezialisierter Hochschullehrer, die den oberflächlichen Überblick an die Studenten vermitteln, ist erforderlich, sondern das Zusammenwirken von Wissenschaftlern, die intensiv an der Forschung beteiligt sind, auch im Ausbildungsprozeß, durch gemeinsame Planung und Koordination von Lehrveranstaltungen.
IV.4.2 Das Prinzip der sozialen Demokratie und die Arbeitsverhältnisse der Hochschullehrer
Die aus dem Wissenschaftsprozeß sich immanent aufdrängenden rationellen Organisationsprinzipien bilden jedoch nicht den einzigen theoretisch-praktischen Ausgangspunkt für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse der Hochschullehrer. Die „Betriebsverfassung“ der Hochschule muß nicht nur dem spezifischen, wissenschaftlichen Charakter ihrer Arbeit gerecht werden, sondern sie steht in einem allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenhang, in den die Hochschullehrer als Arbeitnehmer und Staatsbürger eingeordnet sind. Daß die aufgezeigten Arbeitsformen innerhalb des Lehrkörpers der Hochschule den Notwendigkeiten freier wissenschaftlicher Arbeit entsprechen, bedeutet noch nicht, daß die Chance ihrer Realisierung in einer konkreten Gesellschaftsordnung gegeben wäre. Es bleibt die Frage nach der Durchsetzung des aus der Wissenschaft immanent gefolgerten Anspruchs auf freie wissenschaftliche Betätigung eines jeden Hochschullehrers, nach der Aufhebung bestehender sachfremder Privilegien in der Lehre und Verwaltung.
Die Lösung aller wissenschaftlichen Lehrer und Mitarbeiter aus den wissenschaftsfremden Abhängigkeitsverhältnissen ist nicht in einer Gesellschaftsordnung möglich, die bei der Deklaration der unveräusserlichen Menschenrechte stehen bleibt, die das Recht auf freie Forschung und Lehre für einige Privilegierte garantiert, sondern sie ergibt sich aus dem Gedanken einer Demokratie, die sich als ein gesellschaftlicher Prozeß der Realisierung der Menschenrechte versteht.
Eine Demokratie, die sich zu diesem Ziel in ihrer Verfassung bekannt hat, muss auch in dieser konkreten Frage beim Wort genommen werden, mag auch ihre Verfassungswirklichkeit der Verfassungsnorm noch so sehr Hohn sprechen.
Der zweite Ausgangspunkt für die Neuordnung der Arbeitsverhältnisse der Hochschullehrer ist daher die Tendenz zur allgemeinen Umgestaltung der Arbeitsverhältnisse, die sich aus dem zentralen Verfassungsleitsatz des Grundgesetzes der Bundesrepublik ergibt, aus dem Prinzip der demokratischen und sozialen Rechtsstaatlichkeit, dessen unmittelbare Relevanz für das Hochschulrecht bereits untersucht worden ist. (Vgl. Kapitel III Akademische Freiheit und soziale Demokratie).
Die durch das Grundgesetz eröffnete Tendenz zur Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse nach dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit und der sozialen Demokratie muß im Rahmen einer verfassungskonformen Anpassung des traditionellen Hochschulrechts auch auf die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer ausgedehnt werden.
Daher ist eine umfassende Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer und wissenschaftlichen Mitarbeiter in entsprechenden Hochschullehrergesetzen und in den Satzungen und Ordnungen der Hochschulen anzustreben.
Das traditionelle formalrechtsstaatliche Hochschulrecht, dessen heutige Vertreter nach wie vor den mit Inkrafttreten des Grundgesetzes eingetretenen Wandel nicht zur Kenntnis nehmen, durch den die herrschende einseitig rechtsstaatliche Theorie des Hochschulrechts in Frage gestellt wird, kann nicht für eine solche gesetzliche Neuordnung herangezogen werden.
IV.4.3 Akademische Freiheit - Demokratisierung - soziale Gerechtigkeit
Aufgrund einer verfassungskonformen Theorie des Hochschulrechts (Vgl. Kapitel III) müssen die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer nach den folgenden grundlegenden Prinzipien im einzelnen geregelt werden:
- Das Grundrecht der Freiheit der Forschung und Lehre enthält zunächst die Verpflichtung zur Wahrung der Freiheit des einzelnen wissenschaftlichen Lehrers (bzw. wissenschaftlichen Mitarbeiters) im traditionellen Sinne der akademischen Freiheit, und zwar
a) gegenüber dem Staat, zur Abwehr staatlicher Eingriffe in die Freiheit des Hochschullehrers in Forschung und Lehre (zur näheren Ausgestaltung des Verhältnisses Hochschule - Staat vgl. Kapitel VII);
b) im Kernbereich des Vollzugs von Forschung und Lehre innerhalb der Hochschule selbst. Auch hier, bei der Entscheidung über die Ziele seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, darf der einzelne Hochschullehrer keinen bindenden Mehrheitsbeschlüssen kollegialer, demokratischer Selbstverwaltungsgremien der Hochschule unterworfen werden. Innerhalb eines äußeren, weit gespannten Rahmens, der die allgemeinen Pflichten des Hochschullehrers zur Wahrnehmung von Lehr- und Forschungsaufgaben innerhalb einer Fakultät festlegt, ist nur frei gewählte Kooperation und kollegiale Willensbildung im Sinne von Einstimmigkeit möglich. - Als demokratisches und soziales Teilhaberecht verstanden, beinhaltet die Freiheit von Forschung und Lehre ein Recht auf freie wissenschaftliche Arbeit im Rahmen der Hochschule für jeden, der dazu qualifiziert ist. Da aber Forschung und Lehre im modernen Wissenschaftsbetrieb an umfangreiche Arbeitsmittel und Einrichtungen gebunden sind, kann das Recht auf freie wissenschaftliche Arbeit in Forschung und Lehre nur durch die Demokratisierung der Verfügungsgewalt über die wissenschaftlichen Arbeitsmittel (im weitesten Sinne) in der Hochschule verwirklicht werden. Das bedeutet in der Praxis der akademischen Selbstverwaltung die Beteiligung aller wissenschaftlichen Lehrkräfte und Mitarbeiter an den Entscheidungen über die Verwendung der vom Staat frei zur Verfügung gestellten Mittel, an der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen und sozialen Angelegenheiten des Lehrkörpers.
Das gilt besonders für die Institute u.a. Einrichtungen der Hochschule. Sie sind nicht als Betriebsmittel eines Lehrstuhlinhabers und Institutsdirektors anzusehen, sondern als der Ort der Zusammenarbeit von Hochschullehrern, Assistenten und Studenten, die daher bei der Regelung der Angelegenheiten, die sich aus ihrer Zusammenarbeit ergeben und bei der Verwaltung der Arbeitsmittel des Institutes zusammenwirken sollen. - Freiheit der Forschung und Lehre als soziales Teilhaberecht beinhaltet ferner den Rechtsanspruch desjenigen, der dazu qualifiziert ist, auf die persönlichen materiellen Voraussetzungen für die freie wissenschaftliche Betätigung. Der Hochschullehrer erhält daher mit der Habilitation und Erteilung der venia legendi einen Anspruch auf materielle Sicherung der Ausübung der verliehenen. Rechte durch eine angemessene Besoldung und soziale Sicherstellung, die ihm die erforderliche wirtschaftliche Selbständigkeit gewährt, ohne Zwang zu Nebentätigkeiten wissenschaftlich zu arbeiten. Darüberhinaus hat ein Bewerber aufgrund Art. 12 GG, dem Grundrecht der freien Berufswahl, auch einen Rechtsanspruch auf Durchführung eines Habilitationsverfahrens (als Berufszulassungsprüfung) sofern er bestimmte, rein sachlich motivierte Vorbedingungen erfüllt (z.B. Einreichung einer vollständigen Habilitationsschrift), die in gesetzlich anerkannten Habilitationsordnungen niedergelegt sind.
Das Recht der Hochschullehrer auf eine angemessene Besoldung ergibt sich jedoch nicht nur aus ihrem Anspruch auf ein Minimum an materieller Sicherung ihrer freien wissenschaftlichen Arbeit, sondern darüber hinaus aus dem übergreifenden Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit, des gerechten Anteils am Sozialprodukt. Da die Ergebnisse des gesamten Arbeitsprozesses der Hochschule für die Aufrechterhaltung und dynamische Ausweitung der gesamtgesellschaftlichen Produktion (im weitesten Sinne) unabdingbare Voraussetzungen sind - somit ökonomische Werte darstellen - so ist die Beteiligung der Hochschullehrer an diesem Arbeitsprozeß als gesellschaftlich notwendige und produktive Arbeitsleistung zu bewerten.
Die Tätigkeit der Hochschullehrer muß in Relation zu vergleichbaren sozial relevanten produktiven Arbeitsleistungen in der Wirtschaft und Verwaltung sozial gerecht entlohnt werden.
Die Rechte der wissenschaftlichen Mitarbeiter, d.h. der nicht habilitierten wissenschaftlichen Hilfs- und Lehrkräfte (Assistenten, Tutoren, Hilfskräfte), die sich gegenwärtig in unangemessenen Abhängigkeitsverhältnissen befinden, müssen aufgrund der genannten Prinzipien grundsätzlich überprüft werden.
Das Prinzip der Demokratisierung der Arbeitsverhältnisse erfordert die korporationsrechtliche Eingliederung der wissenschaftlichen Mitarbeiter als Mitglieder der Hochschulkörperschaft, von der sie bisher im Gegensatz zu den Studenten (die formell, in erster Linie aus disziplinarischen Gründen, als „akademische Bürger“ gelten) ausgeschlossen sind. (Zum ersten Mal sieht das neue Berliner Hochschullehrergesetz die korporationsrechtliche Eingliederung der wissenschaftlichen Mitarbeiter vor; vgl. Anhang, Nr. 2)
Sobald auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter Mitglieder der Hochschulkorporation sind, stehen sich die Fakultäten (als Organe der Professoren) und die Assistentenschaft (die in einigen Hochschulen bereits als Interessenvertretung konstituiert ist) nicht mehr wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenüber (142), sondern beide Gruppen des gesamten Lehrkörpers stehen im gleichen Verhältnis zu ihrer Hochschule, als Mitglieder mit dem Recht auf Mitbestimmung bei der Willensbildung der akademischen Selbstverwaltung.
Die Arbeitsverhältnisse der wissenschaftlichen Mitarbeiter müssen daher grundsätzlich ebenso wie die Rechte und Pflichten der habilitierten Mitglieder des Lehrkörpers in den Hochschulsatzungen und im einzelnen in Assistentenordnungen geregelt werden, die von den Organen der Gesamthochschule, unter Mitwirkung der Vertretung der wissenschaftlichen Mitarbeiter (Assistentenvertretung) zu beschließen und von der Rechtsaufsichtsbehörde (Kultusminister) zu bestätigen sind. Die Assistentenordnungen müssen sich mit den Normen der sozialen Demokratisierung der Hochschule, insbesondere dem Recht auf freie wissenschaftliche Arbeit und dem Prinzip der Demokratisierung der Betriebsstruktur, in Einklang befinden.
- Die wissenschaftlichen Mitarbeiter müssen auch innerhalb ihrer Dienstzeit Gelegenheit zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit haben, unter Benutzung der Einrichtungen und Arbeitsmittel des Instituts, dem sie angehören, und zwar in dem Umfang, der zu ihrer laufenden wissenschaftlichen Fortbildung und für ihre weitere wissenschaftliche Qualifizierung (durch Promotion, Habilitation) erforderlich ist.
- Bei Veröffentlichungen von wissenschaftlichen Arbeiten eines Hochschullehrers bzw. eines Instituts, an denen wissenschaftliche Mitarbeiter beteiligt waren, sind sie entsprechend ihrer Beteiligung als Mitverfasser oder Mitarbeiter zu nennen. Wissenschaftliche Arbeiten, die sie in dem Institut selbständig angefertigt haben, dürfen sie unter ihrem Namen veröffentlichen.
- Die Stellung der wissenschaftlichen Mitarbeiter als einer besonderen Gruppe innerhalb der Hochschule rechtfertigt es, ihnen bestimmte Aufgaben zu freier Selbstverwaltung zu übertragen (ähnlich den Aufgaben der Fakultäten der Professorenschaft), z.B. die Bildung von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, Forschungsteams, für die von der Hochschule der Assistentenvertretung besondere Mittel und Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden müßten.
IV.5 Neugliederung des Lehrkörpers
Nachdem so der äußere Rahmen für die Stellung und Tätigkeit der Hochschullehrer skizziert worden ist, sollen einige Grundsätze für eine Neugliederung des Lehrkörpers aufgestellt werden.
Die Gliederung des Lehrkörpers muß unter vier Gesichtspunkten gesehen werden:
- in bezug auf die Forschung und ihre möglichst rationelle und freie Organisation
- in bezug auf die Ausbildung, die Bedürfnisse der Einführung ins Studium, der methodischen Schulung, der Berufsvorbildung
- in bezug auf die Lehrkräfte selbst, ihre sozialen Probleme und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- in bezug auf die Hochschule, die zweckmäßige und freie Organisation ihrer Selbstverwaltung.
Die zur Zeit bestehende vielstufige Hierarchie des Lehrkörpers, die sich an die Zweckmäßigkeit einer autoritären Betriebsführung anpaßt, nicht aber an die Notwendigkeiten der freien Forschung und Lehre, muß durch eine einfachere Gliederung in drei Stufen abgelöst werden, die allein durch die klassischen Stufen der Laufbahn eines Wissenschaftlers bezeichnet werden sollen: Promotion - Habilitation - Berufung. Allein diese im Kern sinnvollen traditionellen Prüfungs- und Ausleseverfahren können - falls es gelingt, sie durch einige Ergänzungen und Sicherungen zu objektivieren einen zuverlässigen Maßstab für die Bildung von Rangstufen abgeben. Andere, künstlich geschaffene Rangstufen und Vorrechte die nicht auf einer sorgfältigen und allgemein wissenschaftlich anerkannten Prüfung beruhen, zerstören den Geist der Kollegialität und kritik-offenen Zusammenarbeit.
Für die Struktur dieses Drei-Stufen-Baus von Promovierten, Habilitierten und Ordinarien sollten die folgenden grundlegenden Prinzipien gelten:
1. Schaffung einer möglichst breiten Schicht von jüngeren wissenschaftlichen Nachwuchskräften in Durchgangsstellen als Beamte auf Widerruf, die durch Verwaltungskräfte von technisch-administrativen Aufgaben zu entlasten wären.
Diese Schicht von Lehrkräften soll aus den wissenschaftlichen Assistenten und einer neu zu bildenden Gruppe von „Wissenschaftlichen Tutoren“ bestehen.
Die meisten Assistenten haben gegenwärtig nicht mehr nur die Funktion von Gehilfen eines Professors bei der Durchführung seiner Forschungs- und Lehraufgaben, sondern sie erfüllen Aufgaben von Hochschullehrern - durch Leitung von Proseminaren, Übungen - ohne deren Selbständigkeit zu besitzen.
Um die Assistenten aus der dauernden Abhängigkeit von einem bestimmten Lehrstuhlinhaber zu lösen, ist die „Aufspaltung“ der heutigen Assistentur in Stellen für reine Verwaltungsassistenten eines Professors oder eines Instituts und solche für selbständige wissenschaftliche Assistenten zu empfehlen, die im Rahmen einer Fakultät oder eines Instituts selbständig an den Unterrichtsaufgaben mitwirken. Die wissenschaftlichen Assistenten können aber nur nebenamtlich als Lehrbeauftragte und Tutoren tätig sein. Denn es muß ihnen ausreichend Zeit bleiben für die eigene wissenschaftliche Arbeit oder die Mitarbeit in einer Forschungsgruppe, damit sie sich sinnvoll auf die Habilitation vorbereiten können.
Die Verwaltungsassistentur wäre dann die erste Stufe einer erweiterten Laufbahn für wissenschaftliche Verwaltungsbeamte der Universitäten und Institute (Akademische Räte, Kustoden; Kuratoren von großen Instituten).
Die Einstellung von zahlreichen Assistenten mit Funktion soll der Intensivierung des Studiums, besonders im ersten Studienabschnitt, dienen. Zu den Aufgaben dieser wissenschaftlichen Tutoren wurde die Durchführung kleiner Proseminare, von Einführungspraktika, sowie eine systematische persönliche Studienberatung gehören. Diese Tutoren müssen jedoch selbst in der Praxis der wissenschaftlichen Arbeit stehen, um die Studenten lebendig in die vom Schulunterricht grundsätzlich verschiedene wissenschaftliche Arbeitsweise und Methodik einführen zu können.
Eine besondere Gruppe von Lehrkräften (in Beamtenstellen auf Lebenszeit), die nicht mehr an intensiver wissenschaftlicher Arbeit beteiligt oder interessiert wären (z.B. als „Studienräte im Hochschuldienst“) würde durch ihre Unterrichtsmethode den Charakter des Studiums verzerren.
Jüngere wissenschaftliche Nachwuchskräfte finden erfahrungsgemäß auch besser den notwendigen persönlichen Kontakt zu Studenten der ersten Semester, die angesichts des zunehmenden Massenbetriebs und der mangelnden Vorbereitung auf das Studium in der Oberstufe der höheren Schule im steigenden Maße Schwierigkeiten bei der Umstellung vom Schulbetrieb auf ein wissenschaftliches Studium haben.
Die Tätigkeit studentischer Tutoren im Rahmen einer Studienselbsthilfe durch die studentischen Fachschaften soll durch die Schaffung wissenschaftlicher Tutorenstellen wieder an ihren ursprünglichen Aufgabenbereich angenähert werden. Es würde dadurch wieder stärker zum Ausdruck kommen, daß diese studentischen Tutoren von den Studenten nicht als „Assistentenersatz“ und ihre Gruppen als Ersatz für Proseminare aufzufassen sind, sondern nur einer ganz praktischen persönlichen Einführung in das Universitätsleben und zur Diskussion von Fragen der Studenten dienen sollen. Da es auch immer schwieriger wird, geeignete ältere Studenten für die Leitung von Tutorengruppen zu finden und in vielen Fakultäten überhaupt kein Tutorensystem besteht, ist die Einführung fester wissenschaftlicher Tutoren um so dringender.
2. Soziale Sicherstellung und kollegiale Gleichberechtigung einer homogenen (nicht hierarchisch abgestuften) mittleren Schicht von habilitierten Lehrkräften in Dauerstellen.
Die Hochschullehrer dieses Mittelbaus sollten beamtenrechtlich gesehen in Dauerstellen, also Beamte auf Lebenszeit sein, aber innerhalb der wissenschaftlichen „Laufbahn“ sollte es sich eindeutig um Durchgangsstellen handeln. Ein Anfang zur Schaffung eines solchen Mittelbaus wäre bereits mit der verstärkten Ernennung von Wissenschaftlichen Räten getan. Sie sollen auf keinen Fall eine besondere Klasse von Hochschullehrern „auf dem Nebenoder Abstellgleis“ sein, sondern aus dieser Schicht soll der größte Teil der Berufungen auf Lehrstühle erfolgen, allerdings nicht aufgrund des Dienstalters, sondern nach dem Leistungsprinzip.
Sie sollten ihren Kollegen, den Lehrstuhlinhabern, korporationsrechtlich vollkommen gleichgestellt sein, d.h. sie müßten Vollmitglieder der Fakultät werden. Eine Rangstufung unter den Habilitierten widerspricht der kollegialen Zusammenarbeit im Sinne einer freien „Gelehrtenrepublik“, an Stelle der erstarrten „Ordinarienoligarchie“. Die korporationsrechtlichen Vorrechte der Professoren gegenüber den Privatdozenten wurden im 19. Jahrhundert, als das Zunftprinzip des autoritativen Fachvertreters suspekt wurde, vor allem mit ihrem privaten Status im Unterschied zu den beamteten Lehrstuhlinhabern gerechtfertigt. Außerdem handelte es sich damals zumeist noch um echte, jüngere Nachwuchskräfte. (143) Durch die Einordnung der ehemals nur aus Privatdozenten bestehenden Mittelschicht in die Hochschulkorporation als ständige beamtete Forscher und Lehrer, und angesichts des hohen Durchschnittsalters der Nichtordinarien werden die korporationsrechtlichen Vorrechte den Lehrstuhlinhaber vollends zweifelhaft.
Auch die überkommene Bezeichnung „Privatdozent“ müßte wegfallen, da sie nicht mehr den realen Gegebenheiten entspricht. Alle habilitierten beamteten Nichtordinarien sollten den Professorentitel (als „apl. Professor“) erhalten.
Wenn die monokratische Leitung der Institute nach und nach beseitigt werden kann, brauchen die beamteten Nichtordinarien (z.B. Oberassistenten) nach ihrer Habilitation und nach Ernennung zum beamteten Diätdozenten oder apl. Professor auch nicht mehr, wie z. Zt. üblich praktisch aus der vollen Mitarbeit in einem Institut auszuscheiden, sondern sie sollten das Recht und die Pflicht haben, gleichberechtigt mit den Lehrstuhlinhabern an den Aufgaben und an der Leitung des Instituts mitzuwirken. Sie bilden zusammen mit den Lehrstuhlinhabern kollegiale Arbeitsgruppen im Rahmen des Instituts.
Der Empfehlung, diese Stellen im sog. Mittelbau beamtenrechtlich als Dauerstellen einzurichten, liegen folgende Überlegungen zugrunde:
- Die Hochschule wird auf die Dauer in der Auswahl des fähigen wissenschaftlichen Nachwuchses nur dann gegenüber der Wirtschaft und dem Staatsdienst konkurrenzfähig sein, wenn sie die soziale Sicherstellung ihrer Dozenten und deren Familien nicht erst mit der Berufung, sondern schon vorher ermöglicht.
- Nichtordinarien, die heute z.T. auf Nebentätigkeiten außerhalb der Hochschule angewiesen sind, weil ihnen ihre Besoldung noch relativ zu gering erscheint, oder weil sie befürchten, den Anschluß an eine Laufbahn oder Entstellung außerhalb der Hochschule zu verpassen, falls sie nicht berufen werden, sollen sich dadurch ganz auf ihre Aufgaben in der Hochschule konzentrieren können.
- Die Stellung als Diätendozent, d.h. als Beamter auf Widerruf, bedeutet wohl eine relative Verbesserung der wirtschaftlichen Lage für eine gewisse Zeit, jedoch ohne dem Dozenten und seiner Familie eine ausreichend gesicherte Zukunft zu garantieren.
Die Tendenz zur wirtschaftlichen Sicherstellung der mittleren Schicht des Lehrkörpers durch ihre Ernennung zu Beamten auf Lebenszeit muß sich auch in den deutschen Hochschulen früher oder später durchsetzen. wenn sich nicht die Nachwuchssituation noch weiter verschlechtern soll.
Um vor der Ernennung von bewährten Nachwuchskräften zu Beamten auf Lebenszeit eine sorgfältige Prüfung und Auslese zu ermöglichen, wäre allerdings eine Probezeit von ein oder zwei Jahren nach der Habilitation und der Erteilung der venia legendi denkbar, in der die Habilitierten als Dozenten noch den Status von Beamten auf Widerruf hätten. Nach dieser Frist müßten sie entweder zu Beamten auf Lebenszeit und apl. Professoren ernannt werden oder sie müßten ihre Beamtenstellung verlieren und die venia legendi würden nach Ablauf der Probezeit erlöschen „wenn die Fakultät in diesem Zeitpunkt mit Zweidrittelmehrheit und mit Zustimmung von Rektor und Senat feststellt, daß der Privatdozent in wissenschaftlicher oder pädagogischer Hinsicht die in ihn gesetzten Erwartungen offensichtlich enttäuscht hat. “ (144)
Dadurch sollten auch die Befürchtungen um eine Senkung des Niveaus durch die angebliche Ausschaltung des Risikos entkräftet sein. Ein Risiko in der beruflichen Entwicklung ist auf der unteren Stufe, vor und kurz nach der Habilitation durchaus vertretbar und notwendig, denn die Ernennung zum Beamten auf Widerruf (als Assistent oder Tutor) darf auf keinen Fall zu einem Garantieschein für die Habilitation oder gar für eine Beamtenstellung auf Lebenszeit werden. Ein Leistungswettbewerb innerhalb einer Schicht von wissenschaftlichen Nachwuchskräften ist daher auch durchaus zu begrüßen. Selbst nach der Habilitation ist die Überprüfung von offensichtlichen Fehlbeurteilungen nach einer zweijährigen Probezeit noch sinnvoll. Aber je später eine Entscheidung über die berufliche Existenz und die Versorgung der Familie eines Dozenten erfolgt, desto problematischer wird für die Kollegen des Betroffenen eine solche Entscheidung.
Um eine erstarrte Abstufung zwischen Hochschullehrern erster und zweiter Klasse zu verhindern, muß besonders gesichert werden, daß die beamteten Nichtordinarien-Stellen in der Regel nur Durchgangsstellen vor der Berufung bleiben. Die Zahl dieser Stellen muß daher von der Anzahl der Lehrstühle sowie von den jeweiligen Möglichkeiten zu einem Wechsel in andere Berufe mitbestimmt sein. Nur in Ausnahmefällen, wenn die besondere Struktur eines Fachinstituts dies erfordert, könnten Stellen für Leiter von Forschungsabteilungen geschaffen werden, als Entstellen für hochspezialisierte Nichtordinarien gedacht sind, die keine Berufungschancen haben.
3. Erhebliche Erweiterung der stellen für Ordinarien und Extraordinarien durch Errichtung von Parallellehrstühlen des gleichen Fachs.
Da die Nichtordinarien in dieser Konzeption beamtenrechtlich und korporationsrechtlich mit den Lehrstuhlinhabern gleichgestellt sein sollen, damit „der Grundcharakter der Hochschule als einer Gemeinschaft gleichberechtigter Gelehrter überall wieder voll zur Geltung kommt“ (Empfehlungen des Wissenschaftsrates), bedeutet die Berufung auf einen Lehrstuhl als Ordinarius oder Extraordinarius nur die Verleihung einer besonderen akademischen Würde, an der nicht zunftartige Privilegien haften, sondern mit der lediglich eine höhere Besoldung, sowie eine besondere Unterstützung durch Verwaltungskräfte verbunden ist. So sollten mit jedem Lehrstuhl eine Verwaltungsassistentenstelle sowie eine Anzahl von technischen Hilfskräften und Schreibkräften, je nach den Anforderungen in den verschiedenen Fächern, verbunden sein.
Damit sollen den so ausgezeichneten Gelehrten im Unterschied zu ihren jüngeren Kollegen noch bessere materielle Voraussetzungen für ihre wissenschaftliche Arbeit geboten werden. Innerhalb des Kollegiums der Habilitierten sollten die Ordinarien nur bestimmte repräsentative Funktionen haben, wie z.B. den Vorsitz bei Sitzungen des Kollegiums eines Instituts oder eines Faches, das Recht, die Dekane und Rektoren zu stellen (die im Rahmen einer Demokratisierung der Hochschulselbstverwaltung nur die Vertreter des Lehrkörpers der Hochschule wären (145).
Die Einrichtung mehrere Parallel-Lehrstühle in einem Fach und im Rahmen eines Instituts soll erstens die freie Konkurrenz und kritische Auseinandersetzung zwischen erfahrenen Gelehrten innerhalb eines Faches stärken, indem dadurch Differenzierungen in der wissenschaftlichen Richtung und Lehrmethodik den Studenten und den Nachwuchskräften bewußt gemacht werden; zweitens könnte sich damit der Gedanke einer begrenzten Schwerpunktbildung in den Funktionen der Lehrstuhlinhaber durchsetzen, indem die Professoren je nach ihren verschiedenen Erfahrungen und Fähigkeiten bestimmte Aufgabenbereiche eines Lehrstuhlinhabers in den Vordergrund stellen, andere dagegen stärker ihren Kollegen überlassen. Solche Schwerpunkte wären unter anderem:
a) Die Konzentration auf die Organisation umfangreicher Forschungsvorhaben, die Koordinierung von Forschungsteams, verknüpft mit besonders intensiver Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses;
b) Die Konzentration auf die übersichtliche und systematische Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse des Faches in großen Vorlesungen und Seminaren;
c) Die besondere Sorge um die wissenschaftliche Bildung der Studenten in Anknüpfung an theoretische, methodologische Probleme des Fachs;
d) Die besondere Betonung der Verknüpfung von Fachwissenschaft und Berufspraxis, in bestimmten Studienrichtungen.
IV.5.1 Ergänzende Lehrkräfte
Neben der Gruppe der nichthabilitierten wissenschaftlichen Mitarbeiter und Nachwuchskräfte (Assistenten, wissenschaftliche Tutoren) und den beiden Gruppen des eigentlichen Lehrkörpers - Ordinarien und Nichtordinarien - stehen die nebenamtlichen wissenschaftlichen Lehrkräfte (Honorarprofessoren, nebenamtliche Lehrbeauftragte) und schließlich die ergänzenden sonstigen Lehrkräfte, die entweder nebenamtlich tätig sind oder begrenzte Funktionen bei der Vermittlung allgemeinbildender, nicht spezifisch wissenschaftlicher Kenntnisse oder technische Fachkenntnisse innehaben.
Um für solche Funktionen genügend wissenschaftlich ausgebildete oder vorgebildete Fachkräfte zu gewinnen, ist die verstärkte Einrichtung ausreichend besoldeter Beamtenstellen auf Lebenszeit erforderlich, insbesondere für Studienräte im Hochschuldienst mit allgemeinbildenden Unterrichtsaufgaben (hauptsächlich Sprachunterricht, aber auch intensivere Übungen in den Grundlagen der Mathematik und Naturwissenschaften, die in der Oberstufe der Höheren Schule nicht in dieser Intensität und Systematik betrieben werden können. Diese partielle Verschulung des Studiums ist in Kauf' [FEHLER] zu nehmen, wenn parallel dazu schon im ersten Studienabschnitt eine gründliche exemplarische Einführung in die wissenschaftliche Arbeitsweise und Problematik des Faches erfolgt.
Da die wissenschaftlichen Assistenten und Tutoren korporationsrechtlich Mitglieder der Hochschule sein sollen, wäre auch ein, allerdings begrenztes Mitgliedschaftsverhältnis der Studienräte und Akademischen Räte erwünscht, damit ihnen eine Vertretung ihrer Interessen in einigen Organen der Hochschule ermöglicht wird, ohne daß sie einen weiteren tragenden Selbstverwaltungsverband innerhalb der Hochschule bilden würden.
IV.6 Verbesserung der Auslese- und Berufungsverfahren
Soll der Grundcharakter der Hochschule als einer Korporation gleichberechtigter Gelehrter, wissenschaftlicher Nachwuchskräfte als Mitarbeiter und Studenten wieder „freigelegt“ werden durch Ausschaltung aller sachfremden, autoritären Abhängigkeitsverhältnisse, so kommen den verschiedenen Verfahren zur Auslese und Auswahl der Nachwuchskräfte und der Professoren erhöhte Bedeutung zu, angefangen von der Promotion, Habilitation, Besetzung von Assistenten- und Tutorenstellen, bis zur Berufung von Professoren. Diese wissenschaftlichen Auslese- und Auswahl der Nachwuchskräfte und der Professoren erhöhte Bedeutung zu, angefangen von der Promotion, Habilitation, Besetzung von Assistenten- und Tutorenstellen bis zur Berufung von Professoren. Diese wissenschaftlichen Auslese- und Berufungsverfahren bilden den einzigen sachgemäßen Maßstab für eine sinnvolle Verteilung der unterschiedlichen Aufgaben der Hochschule in Forschung und Lehre und für eine dem entsprechende leistungsgerechte differenzierte Besoldung und anderweitige materielle Unterstützung der Hochschullehrer und deren Mitarbeiter.
Die Prüfungsverfahren für die Ergänzung des Lehrkörpers bilden das zentrale „Nervensystem“ einer Universität. Ihre Beschaffenheit ist entscheidend für das geistige und moralische Klima und die Arbeitsverhältnisse in der Universität.
Es ist nur konsequent, wenn in einer Universität, die von der „Diktatur der Ordinarien“ über eine Schicht subalterner wissenschaftlicher Mitarbeiter geprägt ist, in der Lehrstühle z.T. einträgliche „Pfründen“ darstellen und der „Partikularismus“ der von einander isolierten Lehrstuhlinstitute vorherrscht, auch die wissenschaftlichen Ausleseverfahren eine Verzerrung erfahren. Ihre Praxis ist ganz auf die Autorität und den Einfluß des einzelnen Ordinarius zugeschnitten, der über die „Subsistenzmittel“ und Arbeitseinrichtungen verfügt, auf die wissenschaftliche Nachwuchskräfte angewiesen sind. Sein Einfluß sichert dem Anwärter überhaupt erst die materiellen Voraussetzungen der Vorbereitung auf eine wissenschaftliche Laufbahn. (Etwa durch Vergabe von Stipendien, Hilfskraft- und Assistentenstellen auf Antrag des Lehrstuhlinhabers; Erlaubnis zur Benutzung von Einrichtungen und Arbeitsmitteln des Institutes).
Die starke Abhängigkeit der wissenschaftlichen Nachwuchskräfte von den einzelnen Lehrstuhlinhabern äußert sich am deutlichsten in den Mängeln des gegenwärtigen Habilitationsverfahrens, sowie bei der Besetzung von Assistentenstellen: Der Weg zu Habilitationen führt fast ausschließlich über die Assistentur. Die Auswahl der Assistenten richtet sich nach Zufälligkeiten und persönlichen Vorurteilen und Vorlieben des Ordinarius, da eine Bewerbung mehrerer Anwärter nicht üblich ist. Fast ausschließlich auf Grund des Votums ihres Lehrers und Förderers erfolgt dann auch die Habilitation der Assistenten durch die Fakultät, deren Mitglieder gemäß den ungeschriebenen Gesetzen „akademischer Kollegialität“ fast immer dem Votum des Ordinarius folgen, der einen Habilitanden „präsentiert“. Umgekehrt kann aber nach dem selben Prinzip durch den hartnäckigen Widerstand eines einzigen einflußreichen Ordinarius eine Habilitation faktisch verhindert werden. Verliert ein Anwärter auf die Habilitation das Wohlwollen „seines“ Ordinarius oder sollte dieser sterben, so nützt ihm auch das Wohlwollen der Mehrheit der anderen Lehrstuhlinhaber nichts. Durch das Habilitationsverfahren wird auch keineswegs die wirkliche Lehrbefähigung des Bewerbers sondern nur seine wissenschaftliche Spezialleistung geprüft. Er hat vor der Habilitation kaum Gelegenheit, Vorlesungen zu halten. Seine „hochschulpädagogische“ Befähigung zur Ausbildung und Bildung der Studenten wird ebensowenig geprüft. Die Studenten, die darüber auf Grund ihrer Erfahrungen in den Übungen des Assistenten ein Urteil abgeben könnten, werden nicht gefragt.
Das Berufungsverfahren wiederum hat gegenwärtig zunächst die Funktion, Einkommen und Einfluß der bereits berufenen Professoren zu steigern. Denn es gehört zum guten Ton, daß auf einen freien Lehrstuhl zunächst einmal Koryphäen anderer Universitäten berufen werden, von denen erwartet wird, daß sie ablehnen. Dennoch verhilft ihnen die Tatsache der Berufung dazu, bei ihrer Universität und dem Kultusministerium Konzessionen für ihr Bleiben einzuhandeln. Dadurch, und durch die Scheu vor der Berufung unbekannter „Außenseiter“, verzögert sich die Besetzung zahlreicher vakanter Lehrstühle.
Um eine stärkere Objektivierung der Auslese- und Prüfungsverfahren zur Besetzung von Assistentenstellen, zur Erteilung der Lehrbefähigung und zur Berufung von Professoren zu erreichen, werden die folgenden Ergänzungen und Änderungen in der Verfahrensweise empfohlen.
IV.7 Nachwuchsauslese:
Doktoranden- und Forschungsstipendien, freie Stellen für wissenschaftliche Assistenten und wissenschaftliche Hilfskräfte müssen öffentlich ausgeschrieben werden. Die Bewerbungen auch aus anderen Hochschulen müssen von Personalkommissionen in den einzelnen Fächern oder Fakultäten unter beratender Mitwirkung von Assistenten- und Studentenvertretern des Faches geprüft und begutachtet werden.
Bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz ist eine Zentralstelle einzurichten, in deren Karteien möglichst alle für eine wissenschaftliche Laufbahn geeigneten Persönlichkeiten innerhalb und außerhalb der Hochschulen geführt werden. Diese Listen sollen auf Grund von Vorschlägen der Professoren und persönlichen Bewerbungen, die von Kommissionen zu begutachten sind, zusammengestellt werden. (146)
IV.7.1 Das Habilitationsverfahren:
Habilitation und Verleihung der venia legendi, d.h. Feststellung der Lehrbefähigung und Erteilung der Lehrbefugnis sollten nicht in einem Vorgang vereinigt, sondern getrennt durchgeführt werden. Eine solche Neuregelung ist aus verschiedenen Beweggründen notwendig:
- Da das Grundrecht der freien Berufswahl (Art. 12 Abs. 1) jedem Bewerber den Rechtsanspruch auf ein Habilitationsverfahren als Berufszulassungsprüfung eröffnet, die Ausübung der Lehrbefugnis in den Hochschulen jedoch nur nach Maßgabe der vom Staat zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel, Einrichtungen oder Planstellen möglich ist, dürfen beide Verfahren nicht miteinander verknüpft werden. (Aus diesem Grunde ist in dem neuen Berliner Hochschullehrergesetz erstmals eine derartige Neuregelung vorgesehen).
- Wenn die Zulassung zur Habilitation nicht mehr je nach der Möglichkeit und dem Bedürfnis für die Zulassung eines neuen Privatdozenten in einer bestimmten Fakultät erfolgt, so besteht die Möglichkeit, daß wissenschaftliche Nachwuchskräfte auch unabhängig von der jeweiligen Haushaltslage einer Universität oder dem Wohlwollen eines bestimmten Universitätskollegiums ihre wissenschaftliche Qualifikation zum Hochschullehrerberuf nachweisen können, um dann aufgrund von Bewerbungen bei öffentlichen Ausschreibungen von Vakanzen die Lehrbefugnis an einer auswärtigen Fakultät zu erhalten, an der ein Bedürfnis dafür besteht und die materiellen Voraussetzungen gegeben sind.
Die Habilitation sollte in den großen, in zahlreiche Fächer gegliederten Fakultäten durch das Kollegium der Habilitierten eines Faches unter beratender Mitwirkung einzelner Assistentenvertreter und studentischer Fachschaftsvertreter erfolgen.
Das heutige Verfahren zeigt, daß man längst dazu übergegangen ist, die Habilitationen jeweils einem kleineren Ausschuß der Fakultät zu übertragen, da die meisten Fakultätsmitglieder nicht mehr in der Lage sind, ein fachlich fundiertes Urteil über die wissenschaftliche Leistung eines Bewerbers in einem anderen Fach abzugeben. Die erstrebte kollegiale Gleichberechtigung innerhalb der Gelehrtenkorporation aller Habilitierten erfordert auch eine gleichberechtigte Mitwirkung bei der Prüfung und Zulassung neuer Bewerber. Aus beiden Erwägungen heraus sollte daher die Verantwortung für die Habilitation einerseits auf das jeweilige Fach innerhalb der Fakultät verengt, andererseits jedoch nach unten, auf die habilitierten Nichtordinarien erweitert werden.
Aus der Notwendigkeit eines engen Zusammenwirkens von Dozenten, Assistenten und Studenten innerhalb des wissenschaftlichen Arbeits- und Ausbildungsprozesses ist auch die Mitwirkung von Assistenten- und Studentenvertretern des Faches an der Prüfung der Lehrbefähigung berechtigt. Wenn ihnen auch über die wissenschaftliche Leistung eines Bewerbers kein entscheidendes Urteil zukommt, so sind sie doch umso mehr zur Beurteilung seiner hochschulpädagogischen Fähigkeiten berufen. Sie können durch ihre beratende Mitwirkung und Teilnahme an den Sitzungen daraufhinwirken, daß gerade dieser Aspekt der Lehrbefähigung von Dozenten stärker berücksichtigt und daß der Habilitationsvorgang im allgemeinen den Charakter eines Handels hinter verschlossenen Türen verliert.
Ferner sollte geprüft werden, ob von den Fakultätentagen zentrale fachwissenschaftliche Habilitationskommissionen (mit wechselnder Mitgliedschaft) gewählt werden könnten, die zur Begutachtung der wissenschaftlichen Leistungen von Habilitanden, zumindest bei Sonderfällen, als „Berufungsinstanz“, heranzuziehen wären, denn ein Habilitand muß die Chance erhalten, sich gegen das negative Votum einer bestimmten Fakultät zur Wehr zu setzen. (147)
IV.7.2 Das Berufungsverfahren:
Im Rahmen der vorgeschlagenen grundsätzlichen Neugliederung des Lehrkörpers, der zufolge alle habilitierten Mitglieder des Lehrkörpers zugleich (auf Lebenszeit) beamtete außerplanmäßige Professoren oder aber Lehrstuhlinhaber sein sollen, (abgesehen von einer zweijährigen Probezeit als Dozent und Beamter auf Widerruf) wäre das Berufungsverfahren auf die Besetzung aller Professuren, nicht nur der Lehrstühle, zu erweitern.
Die folgenden Verbesserungsvorschläge zum Berufungsverfahren sind jedoch auch auf die gegenwärtige Struktur des Lehrkörpers bezogen:
- Auch bei Berufungen sollte die Initiative und die Prüfung der wissenschaftlichen Qualifikation von Anwärtern nicht mehr bei den übergroßen Fakultäten, sondern bei den engeren kollegialen Gremien des Lehrkörpers eines Faches liegen.
- Die Entscheidung über eine Berufung muß jedoch, ebenso wie im Falle der Besetzung anderer Stellen, durch die allgemeinen Selbstverwaltungsorgane der Hochschule und ihrer Fakultäten, d.h. unter gleichberechtigter Mitwirkung von Vertretern der Assistentenschaft und der Studentenschaft, gefällt werden. (Einzelheiten vgl. daher Kap. VI Die demokratische Hochschulverfassung)
- Die Berufung von Hochschullehrern auf vakante Professuren und Lehrstühle sollte sowohl auf Grund von Bewerbungen nach einer öffentlichen Ausschreibung wie auf Anregung des Kollegiums erfolgen.
- Um die erforderliche radikale Vergrößerung der Zahl der Lehrstühle zu erreichen, ist die Chance nicht auszuschließen, daß besonders qualifizierte Wissenschaftler sofort nach der Habilitation auf einen Lehrstuhl berufen werden, und daß in größerem Umfang geeignete Persönlichkeiten aus der Praxis auch ohne Habilitation berufen werden. Ein stärker objektiviertes und abgesichertes Verfahren bei Erstberufungen bildet die Voraussetzung dazu.
V. Die soziale Lage der Studentenschaft
Ein entscheidendes Element der Gesamtverfassung der Hochschule, der Arbeitsverhältnisse der in ihr arbeitenden Menschen, ist auch die soziale Stellung der Studentenschaft, die bedeutsame Rückwirkungen aus die Gestaltung und die Ziele ihres Studiums haben muß.
V.1 Zum sozialen Standort des Studenten
Seitdem die Hochschule nicht mehr ein „Raum spielerischer Muße“ und „zweckfreier“ Forschung ist, sondern zunehmend als ein „Betrieb“ im Zusammenhang des gesamtgesellschaftlichen Lebens und Arbeitsprozesses anwendbare Forschungsergebnisse und einsetzbare, fachwissenschaftlich qualifizierte Arbeitskraft produziert, ist auch der Student faktisch ein junger intellektueller Arbeiter, der im Arbeitsprozess der Wissenschaft ausgebildet wird. Die Arbeit des Studenten besteht darin, an der Herstellung seiner eigenen wissenschaftlich qualifizierten Arbeitskraft für den Beruf, sowie - in vermittelter Weise - an der Ausbildung anderer Studenten und an der Vorbereitung und Erarbeitung von Forschungsergebnissen mitzuarbeiten. Er ist funktional gesehen in einer ähnlichen Position wie ein Lehrling oder ein junger Arbeiter in der Fabrikausbildung.
Es entspricht der faktischen Stellung des Studenten im Arbeitsprozeß der Hochschule, sowie der allgemeinen Stellung; seiner Altersgenossen, die bereits im Berufsleben stehen, ihn als einen jungen erwachsenen Menschen anzusehen, mit der Neigung, sich möglichst bald von der engen Bindung an eins Elternhaus freizumachen. Über zwei Drittel der Studenten sind auch rechtlich volljährig, die Zahl der verheirateten Studenten steigt langsam an.
Die subjektive, natürliche Neigung des Studenten, unabhängig vom Elternhaus sein und ein eigenes Leben zu führen, entspricht aber auch einer objektiven Notwendigkeit. Die sinnvolle Erfüllung seiner Funktion im wissenschaftlichen Arbeitsprozeß verlangt geistige Selbständigkeit und Initiative. Der faktischen oder zumindest notwendigen und angestrebten geistigen Unabhängigkeit des Studenten widerspricht aber zutiefst seine gegenwärtige materielle Abhängigkeit und soziale Abseitsstellung. Die Studenten werden nach der herrschenden Auffassung unter die „unproduktive“ Bevölkerungsschicht der Kinder, Schüler oder Rentner eingeordnet, die von ihrer Familie, den „Unterhaltsverpflichteten“, bzw. bei deren Versagen von den Steuerzahlern, den „eigentlichen“, weil produktiv tätigen Staatsbürgern, wohltätig versorgt werden.
Durch seine materiell völlig ungesicherte Stellung wird der Student in ein System von miteinander verflochtenen sozialen Abhängigkeitsverhältnissen eingeordnet oder hineingezogen, wodurch er bei der sinnvollen und leistungsfähigen Erfüllung seiner Arbeitsausgaben behindert wird. Dem Studenten verbleibt nur noch die Chance, aus einer Form der Abhängigkeit in die andere zu wechseln: er hat „die freie Wahl des Abhängigkeitsverhältnisses“.
Die Grundvoraussetzung bildet die materielle Abhängigkeit des erwachsenen (z.T. sogar verheirateten) Studenten von seinen Eltern, die dadurch weitgehend Wahl, Gestaltung und Dauer seines Studiums bestimmen können, zumeist aber ohne ihm eine ausreichende materielle Sicherung des Studiums zu garantieren. Diese Situation verhindert entweder die für ein freies wissenschaftliches Studium von der Hochschule erwartete geistige Selbständigkeit und Kritikfähigkeit, oder sie führt zu unerfreulichen psychologischen Spannungen und zur Zerstörung des Familienzusammenhaltes.
Der Wunsch des Studenten, sich von der ausschließlichen finanziellen Abhängigkeit vom Elternhaus zu lösen und die mangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit der Eltern, für eine ausreichende Finanzierung des Studiums zu sorgen,, veranlassen ihn, sich in andere Abhängigkeitsverhältnisse zu begeben.
V.2 Die Formen der sozialen Abhängigkeit des Studenten.
- Die staatliche Studentenförderung nach dem Honnefer Modell;
- Verschiedene Formen indirekter Förderung;
- Die größtenteils studienfremde Werkarbeit und
- die gebundenen Stipendien der Industrie, (aber auch von Ministerien und der Bundeswehr)
Fast alle diese Formen der Studienfinanzierung dienen jedoch zugleich der ideologischen Beeinflussung der Studentenschaft im Sinne herrschender gesellschaftlicher Kräfte.
V.2.1 Die staatliche Studienförderung (Honnefer Modell)
Unter dem Druck einer durch die Studentenschaft und ihre Gesamtvertretung alarmierten Öffentlichkeit sah sich die Mehrheit des deutschen Bundestages im Wahljahr 1957 gezwungen, den ersten nennenswerten Betrag für die allgemeine Studienförderung in den Bundeshaushalt einzusetzen.
Die Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks hatten gezeigt, daß ein großer Teil der westdeutschen Studenten das Studium aus Werksarbeit finanzieren mußte, die sie vielfach nicht nur in den Ferien, sondern auch im Semester ableisteten, was zu unbefriedigenden Studienleistungen und gesundheitlichen Schäden führte. Und dies, obwohl die soziale Zusammensetzung der Studentenschaft (nach der sozialen Stellung der Eltern) dem Bild der Gesamtbevölkerung in keiner Weise entsprach, obwohl nur 5 % Kinder aus Arbeiterfamilien an den deutschen Hochschulen studierten.
Für die in Honnef ausgehandelte Konzeption war allerdings entscheidend, daß sie sich mit den Grundsätzen der katholischen Soziallehre, besonders mit dem Subsidaritätsprinzip im Verständnis der CDU-Ideologen, vereinbaren ließ, wenn irgendeine Aussicht auf Verwirklichung im Staate Konrad Adenauers bestehen sollte. So trug das Honnefer Modell alle Merkmale eines Kompromisses.
Es forderte als Voraussetzung die Bedürftigkeit des Bewerbers und postulierte: bedürftig ist derjenige, der weder allein noch mit Hilfe seiner Familie die Kosten seines Studiums aufzubringen vermag. Damit wurde zur „Stärkung des Familienzusammenhangs“ der Student als mündiger, erwachsener Mensch in einem Lebensabschnitt, in dem sein berufstätiger Altersgenosse wirtschaftlich längst auf eigenen Füßen steht, in erster Linie auf die Hilfe seines Vaters verwiesen, der damit den Lebens- und Studienweg des Volljährigen diktatorisch bestimmen kann. Selbst bei positiver Wertung der weiteren engen Bindung des Studenten an das Elternhaus ist nicht ersichtlich, wie diese Lenkung des Berufsweges des mündigen Studenten den Zusammenhalt der Familie stärken soll. Die Eignungsprüfung durch die Hochschule geht von der zwar richtigen, aber doch alle Mängel unseres Erziehungswesens offenbarenden Feststellung aus, daß längst nicht alle Studierenden zum Studium geeignet sind.
Aber nur dem „Bedürftigen“ wird zugemutet, sich besonderen Eignungsfeststellungen auszusetzen - während für den Nichtbedürftigen an der Fiktion des Abiturs als zulänglicher Bescheinigung der Hochschulreife festgehalten wird.
Schließlich wurde dem Ganzen „für die Zeit bis zur vollen Verwirklichung“ ein „angemessener“ Prozentteil Darlehen beigegeben, um auch den zögernden Selbsthilfeideologen den Kompromiß schmackhaft zu machen.
Durch die Eignungsfeststellung für das Honnefer Modell werden die geförderten Studenten den Manipulationsversuchen mehrerer Instanzen ausgeliefert: der staatlichen Ministerialbürokratie, die in den Richtlinien durch die verschwommenen Formeln „geistige Reife“ und „Verständnis für die Umwelt“ als Bedingungen für die Förderung die Voraussetzung liefert, den Hochschullehrern, die als „Förderungsdozenten“ die Praxis der Eignungsfeststellung bestimmen und schließlich der aus den Studentenwerken entwickelten Förderungsbürokratie. Diese Instanzen stimmen mehr oder weniger in dem Bestreben überein, die „Studienförderung“ (in Abgrenzung der „Studentenförderung“, wie sie der VDS in den Vordergrund stellte) zum Mittel einer geistig-erzieherischen Beeinflussung der Studentenschaft zu machen.
Da die Versuche, einen besonderen „Erziehungsauftrag“ der Hochschule gegenüber den Studenten in freieren und abgeschwächten Formen durchzusetzen, gescheitert waren und ohne Resonanz blieben, (vgl. Kapitel I, Forschung, Lehre und Studium: Erziehungs- und Bildungsanspruch der Hochschule) wurden krampfhafte institutionelle Ersatzlösungen entwickelt, um etwa durch den Bau von Studentenwohnheimen mit „Bildungsauftrag“, aber auch durch die Eignungsfeststellung und Form der Studienförderung den postulierten Erziehungsauftrag wenigstens den bedürftigen und sozial ungesicherten Studenten unter Ausnutzung ihrer materiellen Abhängigkeit aufzudrängen.
Von den maßgeblichen Vertretern des Bundesinnenministeriums, das für die Studentenförderung verantwortlich zeichnete, wurde daher schon bei der Konzipierung des Honnefer Modells der Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit als Sinn einer Studentenförderung völlig verdrängt durch den Gedanken einer Begabtenauslese mit dem Erziehungsanspruch, eine „geistige Elite“ aus der auf die Universitäten strömenden „Masse“ auszusondern: über das „Förderungsgespräch“ zwischen Professor und Student sollten beide zu einem persönlichen Lehrer-Schüler-Verhältnis zurückfinden, die passive unkritische Haltung der „Konsumenten“ sollte überwunden, Verantwortungsbewußtsein als Kennzeichen der Elite geweckt werden. (148) Bundesinnenminister Schröder erklärte im April 1957, das Honnefer Modell sei ein „Versuch, der allgemeinen Vermassung gerade dort Einhalt zu gebieten, wo sie sich für das Leben unserer Nation besonders schlimm auswirken würde“. (149)
Diesen Vorstellungen staatlicher Repräsentanten, die aufgrund ihres sozialkonservativen Elitedenkens auch den künftigen „Führungskräften“ in Staat und Wirtschaft ein besonderes Elite-Bewußtsein anerziehen wollten, die auf grund ihrer sozial schwächeren Position dafür eigentlich nicht prädestiniert sind, entspricht auf der anderen Seite der ideologisch verklärte „Eigenbeitrag“, den nur die bedürftigen Studenten vor dem Studium und in den Semesterferien durch Werkarbeit aus pädagogischen Gründen aufbringen sollten, um größere „menschliche Reife“ zu gewinnen und um ihnen einzuprägen, das „Privileg“ des Studierens müsse man sich redlich verdienen, eine erzieherische Wirkung, die besonders von den Selbsthilfe-Ideologen in den Studentenwerken und Förderungsausschüssen betont wurde. Aus ähnlichen Beweggründen wurden auch die eigentlich nur als Übergangslösung konzipierten zusätzlichen Darlehen anstelle ausreichender Voll-Förderung gerechtfertigt.
Schließlich kam eine so ideologisch befrachtete Eignungsfeststellung auch dem schlechten Gewissen der Hochschullehrer entgegen, die den klassischen oder einen außerwissenschaftlichen“ Erziehungsanspruch der Hochschule so wenig realisieren konnten, wie sie überhaupt dazu in der Lage waren, ihren Studenten ein „Studium“ im Sinne ihrer eigenen ideologischen Voraussetzungen zu ermöglichen. So konnte man sich immerhin der Illusion hingeben, wenigstens unter den Bedürftigen die „Vermassung“ zu bekämpfen.
V.2.2 Die Fürsorge- und Erziehungshochschule?
Im Zusammenhang mit den institutionellen Ersatzlösungen zur Durchsetzung eines fiktiv gewordenen Bildungs- und Erziehungsanspruchs sind auch jene Versuche zu werten, den Studenten durch eine Fülle von indirekten Förderungseinrichtungen seiner Hochschule „existentiell“ zu verpflichten: Förderungsmaßnahmen, die vom verbilligten Mittagstisch oder Freitisch, dem Bau von Studentenwohnheimen bis zurr verbilligten Friseur im Studentenhaus reichen. Durch solcher Vergünstigungen, die der Student z.T. in den Vorzimmern der Studentenwerksbürokratie erkämpfen muß, weil sein Stipendium nicht ausreicht, wird er in einer lebensfremden Unselbständigkeit festgehalten, die der im Studium geforderten geistigen Initiative und Selbständigkeit entgegensteht.
Im Modell der Campus- oder „Heimuniversität“, wie es gegenwärtig für die Neugründung von Universitäten vertreten wird, (vgl. Bremer Universitätsplan von H. W. Rothe) kommt den Institutionen der indirekten Förderung schließlich eine bedeutsame soziale Funktion zu: kombiniert mit einem institutionalisierten Erziehungsanspruch in Wohnheimen mit akademischen Tutoren und Heimleitern und bei Aufrechterhaltung der gegenwärtigen autoritär entstellten Hochschulverfassung, dem Ausschluß der Studentenschaft von jeglicher verantwortlicher Mitwirkung an der Gestaltung der Aufgaben der Hochschule, ergibt sich das konsequente Bild einer paternalistisch-autoritären „Fürsorge- und Erziehungshochschule“. Die Studenten wären der Universität als einer Fürsorge- und Versorgungsinstanz ausgeliefert wie jeder anderen Spezialbürokratie. Das Leben eines Studenten spielte sich bald nur noch zwischen Wohnheim, Mensa, Clubhaus, Hobbyräumen, Ladenzentrum, Kulturzentrum, Sportanlage, Reisestelle, Studentenarzt, Vorzimmer des Studentenwerks etc. innerhalb des Campus ab.
Eine solche Funktion der Hochschule als Instanz zur allgemein-menschlichen, geistigen und körperlichen Versorgung und Betreuung einer Studentenschaft, die dieser Hochschule nur als eine Schicht von Benutzern und Hörern gegenübersteht, entspricht nicht dem Modell einer im Grundgesetz angelegten demokratischen Gesellschaft, sondern dem eines tendenziell totalitären Sozialstaates, der sich vom Element der sozialen Demokratie, dem Prinzip des demokratischen Sozialstaats, entfremdet hat zu einer Versorgungsapparatur mit formal-demokratisch organisierter Spitze.
Die aus ideologischen Beweggründen bewußt unzureichend ausgestaltete direkte Förderung durch Stipendien hält die Studenten jedoch nicht nur in einer Vielfalt von Abhängigkeitsverhältnissen innerhalb der Universität, sondern veranlaßt sie auch dazu, sich in hochschulfremde materielle Abhängigkeitsverhältnisse zu begeben, entweder um überhaupt ihr Existenzminimum zu sichern oder um weitergehende Bedürfnisse zu befriedigen, die im Zeichen des „Wohlstandes für alle“ nicht als Luxus angesehen werden können.
V.2.3 Hochschulfremde Formen der Studentenförderung
sind neben der teils studienfremden Werksarbeit, auf deren Ausgestaltung von Unternehmerseite bereits hingewiesen wurde (FN1:), die gebundenen Stipendien der Unternehmer, aber auch der Bundeswehr und verschiedener Ministerien und Behörden.
Durch den Abschluß eines Arbeitsvertrages, faktisch schon vor Aufnahme des Studiums, der zumeist relativ langfristige Anstellungsverhältnisse begründet, wird in krasser Form das Prinzip der freien Berufswahl und freien Wahl der Ausbildungsstätte verletzt, weil der Staat nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stellt, die eine derartige Abhängigkeit und Einschränkung der Berufsfreiheit bei vielen Studenten ausschalten würden, deren Eltern sich z.B. weigern, ein Studium zu finanzieren oder ausreichen zu finanzieren. Welchen gesellschaftlich-ideologischen Zielen diese Form der Studentenförderung dient, soll anhand der Hochschulpolitik der Unternehmer in dieser Frage erläutert werden: Die Unternehmer betreiben eigene Studentenförderung aus bestimmten Stipendienfonds. Die Förderung geschieht unter nachgerade entwürdigenden Bedingungen. Sie wird meist unter dem Aspekt betrieblicher Rentabilität betrieben, stellt also genau jene bedarfsbestimmte Förderung dar, die der 6. Deutsche Studententag verurteilt hat. Die Stipendiaten müssen in der Regel nach Studienabschluß in den Betrieb des Förderers gehen, sogar in den Semesterferien dort arbeiten, oder eine rückwirkende Umwandlung des Stipendiums in ein Darlehen - in ein verzinsliches Darlehen - hinnehmen. Näheres sagt die Schrift „Förderung begabter Jugendlicher durch Wirtschaft und Betrieb“ der Arbeitgeberverbände, Köln, Sept. 1958 (Grundsätze, 6): „Jede Begabtenförderung soll Risikobereitschaft, Initiative und Verantwortungsfreude des begabten Jugendlichen erhalten und stärken. Sie darf nicht zum Anspruchsdenken führen. Der zu Fördernde muß entsprechend seinen Möglichkeiten bereit sein, physischen und psychische Mehrbelastungen sowie zeitliche und materielle Opfer auf sich zu nehmen.“ Das ist deutlich. Wer wollte da nicht von Abhängigkeiten reden? Schlagworte wie „Rentnergesinnung“, und „Anspruchsdenken“ sind von Seiten der Unternehmer in die Debatte um ausreichende Studentenförderung geworfen worden; zuletzt begegnete uns dieses Vokabular in der Aufsatzserie der Sekretäre der Westdeutschen Rektorenkonferenz, die der Stifterverband veröffentlicht hat. Gleichzeitig erinnern wir uns, daß es diese Seite ist, die vor „Abhängigkeiten“ warnt und die Freiheit bedroht sieht, wenn staatliche Breitenförderung zur Diskussion steht.
V.2.4 Der Sinn des Studiums im sozialen Bewußtsein der Studenten
Die ideologische Verklärung des „Eigenbeitrags“ der Bedürftigen und des Darlehens deutet schon auf den ideologischen Stellenwert der gegenwärtigen Form der Studienfinanzierung hin.
Auch in der heutigen Form der Klassengesellschaft sind zwei Interessenlagen unter der Studentenschaft festzustellen, die die soziale Funktion des Studiums aus den beiden Perspektiven einer antagonistisch strukturierten Gesellschaft sehen, aus der einer kleinen, herrschenden Schicht und der der Masse der abhängigen Schichten.
Die große Mehrzahl der Studenten aus den abhängigen klein- und mittelbürgerlichen Schichten sieht die Ausbildung für Funktionen in der Gesellschaft, die eine hohe Qualifizierung voraussetzen, zugleich unter dem Interesse des Zugewinns an Sozialprestige und sozialer Privilegierung. Es entsteht die Fiktion eines sozialen Aufstiegs, der nach den vorgeschriebenen Gesetzen dieser Gesellschaft „erkauft“ werden muß. Dafür ist man bereit zu zahlen und die Fortdauer der persönlichen und materiellen Abhängigkeit bis zum vollendeten Aufstieg in Kauf zu nehmen, weil sie sich später „auszahlt“. Daher hat in diesem Bewußtsein die Eigenleistung entweder als Selbstfinanzierung durch Werkarbeit, d.h. indem der Student gegen Entgelt arbeitet, um ohne Entgelt seiner eigentlichen Arbeit nachgehen zu können, oder als Leistung der Eltern zur Instandsetzung ihres Kindes für den Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt, für den Aufstieg in höhere, akademische Positionen den Charakter einer direkten oder indirekten Vorauszahlung für die Ware „sozialer Aufstieg“.
Stipendien sind daher in diesem Verständnis des Studiums nur Fürsorgeleistungen, Beihilfen an solche Familien, die ihrem Kind den sozialen Aufstieg oder auch nur das Verbleiben auf dem sozialen Niveau der Eltern nicht erkaufen können. Verhalten sich die Eltern jedoch nicht „standesgemäß“, d.h. lehnen sie es ab, ihren Kindern eine akademische Ausbildung zu „kaufen“, so ist der Staat nicht berechtigt, an ihre Stelle zu treten.
An ein solches Bewußtsein appelliert „die Wirtschaft“, indem sie in einem nur scheinbaren Widerspruch dabei hilft, den Zugang zur Universität zu verbauen, andererseits aber das Studium feierlich aufwertet zu dem eigentlichen „Weg nach oben“, angeblich an die Spitze der Gesellschaft. Obwohl das Studium faktisch keineswegs „Aufstieg“ zu den höchsten Gehältern, zur Spitze der Einkommenspyramide bedeutet, so soll es doch im Bewußtsein der Studenten sich als Weg zur sozialen Führungselite verklären.
Die extreme persönlich-materielle Abhängigkeit des Studenten von seinen Eltern, Mäzenen, den Dozenten, die über seine Eignung zur Förderung entscheiden, der Zwang, sich zum Bittsteller in Permanenz in den Dienststellen der Förderungs- und Sozialbürokratie zu entwickeln, muß zwangsläufig bei vielen Studenten ein soziales Minderwertigkeitsgefühl erzeugen, daß jedoch nach der ganzen Anlage des gegenwärtigen gesellschaftlichen Bewußtseins der Studenten nicht in Protest, geschweige denn Engagement an der vernünftigen Gestaltung sozialer Verhältnisse umschlägt, sondern sich in die ungeistige Arroganz kleinbürgerlicher Waffenstudenten entlädt oder sich mit der Vorstellung der geistigen Elite beruhigt oder an die „inneren Werte“ klammert.
Auf der anderen Seite steht eine verschwindende Minderheit von Studenten, die aus der Oberschicht der faktischen Inhaber der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Macht stammen. Für sie ist Studium auf Grund der „Feudalisierung“ der obersten Besitz- und Eigentumsfunktionen des Kapitals in keiner Weise Voraussetzung für die erwartete Übernahme der „angestammten Herrschaftsfunktionen. Es hat für sie den Charakter einer vornehmen Art des „gehobenen Konsums“ der „conspicuous consumption“, höchstens ist es noch - allerdings immer seltener. das formelle entré billet für eine standesgemäße Position in der Hierarchie der Machtelite, zu der ihnen realiter der Einfluß ihrer Familie ohnehin Zugang verschafft.
Für das Selbstgefühl dieser Oberschicht ist es aber wiederum von nicht zu unterschätzender Bedeutung, für das Studium ihrer Kinder selbst, und zwar einen möglichst hohen Preis, zu zahlen.
V.3 Studienhonorar und Emanzipation des Studenten
Im Gegensatz zu den Bestrebungen, die Studenten bewußt in Abhängigkeit von wohlwollenden Geldgebern und Fürsorgeinstanzen zu halten, sind alle Maßnahmen zu fördern, die den tatsächlichen gesellschaftlichen Funktionen und dem Charakter des Studiums gerecht werden und die soziale Stellung des Studenten der Bedeutung seiner Tätigkeit anpassen, das heißt aber: eine Emanzipation des Studenten zum freien intellektuellen Arbeiter und die volle Herstellung der akademischen Freiheit des Studiums anstreben.
Das Studium ist ein Ausschnitt aus dem gesamten Arbeitsprozeß der Hochschule, dessen Ergebnisse - wissenschaftliche Erkenntnisse und wissenschaftlich ausgebildete intellektuelle Arbeitskraft - Grundvoraussetzungen für die Aufrechterhaltung und dynamische Ausweitung des gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozesses sind.
Die Arbeitsergebnisse der Hochschule, an deren Erarbeitung die Studenten direkt und auf mehr vermittelte Weise beteiligt sind, stellen somit ein „geistiges Kapital“ dar, das sich in einem ständigen Prozeß in ökonomische Werte umsetzt.
Daher fordert der SDS die Anerkennung der Tätigkeit des Studenten als gesellschaftlich notwendige und wertvolle Arbeitsleistung durch eine kostendeckende „Arbeitsentschädigung“ für alle Studenten (ein sog. Studienhonorar). Die Höhe des Betrages sollte so bemessen sein, daß damit die Lebenshaltungskosten, die Kosten für Lernmittel und kulturelle Bedürfnisse gedeckt werden. Durch besondere Pauschalen und Zulagen für die unterschiedlichen Mietkosten, besondere Lernmittel etc. muß die Summe den unterschiedlichen Durchschnittskosten des Studiums in den einzelnen Hochschulorten und Studienfächern angepaßt werden.
Indirekte Förderungsmaßnahmen (verbilligtes Essen, Wohnen, Theaterkarten etc.) und Leistungen auf Grund besonderer Anträge sollen dagegen möglichst eingeschränkt werden.
Die Entlohnung der im Studium geleisteten Arbeit ist aus den folgenden Gründen gerechtfertigt (151):
- Zur Freisetzung des Studenten aus allen sachfremden Abhängigkeitsverhältnissen innerhalb und außerhalb der Hochschule und damit im Interesse der akademischen Freizeit überhaupt; durch ein ausreichendes Entgelt, das ohne weitere Bedingungen und Auflagen jedem zum Studium Zugelassenen gezahlt wird, soll der Student auch in seiner allgemeinen Lebensführung jene Selbständigkeit gewinnen können, die ihm in der wissenschaftlichen Arbeit selbst abverlangt wird.
- Aus dem sozialen Grundrecht auf materielle Sicherung des im Grundgesetz garantierten freien Studiums und der freien Wahl der Ausbildungsstätte und des Berufs. Zur Zeit können die nicht bedürftigen Eltern, als die sog. „Unterhaltsverpflichteten“ noch nach der Volljährigkeit den Ausbildungs- und Berufsweg ihres erwachsenen Sohnes oder ihrer erwachsenen Tochter bestimmen, indem sie von der Einhaltung ihrer Vorstellungen die Gewährung des monatlichen Zuschusses abhängig machen, oder überhaupt die Finanzierung eines Studiums verweigern.
- Aus dem sozialen Grundrecht auf gerechte Entlohnung einer Arbeitsleistung, die für die moderne Industriegesellschaft unentbehrlich ist. Durch die Sicherung des zur Durchführung eines Studiums notwendigen Existenzminimums nach dem „Subsidiaritätsprinzip“ (der katholischen Soziallehre) wird der Norm der sozialen Gerechtigkeit nicht entsprochen.
- Aufgrund der Verpflichtung des demokratischen Sozialstaates als sozialer Gerechtigkeitsstaat zur Demokratisierung des Bildungswesens durch Sicherung gleicher Startchancen und Entfaltungsmöglichkeiten für alle Begabten.
- Angesichts der Funktion des Sozialstaates in der modernen Industriegesellschaft, der zur Aufrechterhaltung und Expansion des gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozesses in ursprünglich gesellschaftliche Aufgabenbereiche eintreten muß, auf dem Wege der Vergesellschaftung mindestens derjenigen öffentlichen Dienste, die von privater Seite nicht mehr auf dem objektiv notwendigen Niveau gehalten werden könnten. (152)
Die Zahlung der Arbeitsentschädigung auch an Studenten aus Elternhäusern mit hohem Einkommen ist nicht nur aufgrund des formalen Gleichheitsgrundsatzes gerechtfertigt (gleiche Leistungen an alle, die gleichwertige Arbeit leisten), sondern, um auch diesen Studenten die Ausbildungsfreiheit und freie Wahl und Gestaltung des Studienweges zu gewährleisten, die auch in ihrem Falle durch die Weigerung von Eltern, das (oder ein bestimmtes) Studium zu finanzieren, eingeschränkt werden kann.
V.3.1 Studienhonorar und Staat
Es spricht nicht für ein besonderes Vertrauen die angeblich gesunde Demokratie in der Bundesrepublik, wenn in der bisherigen Auseinandersetzung um die Studentenförderung das Argument Im Mittelpunkt stand, durch eine staatliche Förderung werde der Student automatisch zum abhängigen Staatsdiener „verbeamtet“.
Einige Vertreter der Bundesregierung haben immer wieder vor dieser verderblichen Konsequenz gewarnt, wenn es galt, notwendige Ausgaben für die Studentenförderung zu beschneiden. Man verwies sehr gern auf das Beispiel der DDR, wo eine ausgedehnte Studentenförderung angeblich mit der Abhängigkeit des Studenten vom Staat bezahlt werden muß. In Wirklichkeit ist diese zwangsläufige Verbindung nicht gegeben. Die nach wie vor bestehende Entmündigung der Studenten in der DDR ist nicht auf die Studentenförderung an sich zurückzuführen, und wird auch mit ihrer Hilfe kaum vergrößert. Die wirksamsten Instrumente der Reglementierung sind andere als die Förderung: z.B. die Zulassungspolitik und die Organisationsform des Studiums. Umgekehrt zeigt ja das englische Beispiel, daß ein hoher Prozentsatz Geförderter den Studenten nicht automatisch zum „Staatssklaven“ macht.
Es muß daher zu Bedenken Anlaß geben, wenn ausgerechnet von der Bundesregierung, die ja im Zweifel den Staat repräsentiert, der reglementieren und manipulieren könnte, vor der Abhängigkeit des Studenten gewarnt wird. Ein wirklich demokratisch kontrollierter Staat müßte die Gewähr dafür bieten, daß dem geförderten Studenten seine Unabhängigkeit erhalten bleibt. Aber selbst wo in die demokratische Kontrolle eingestandenermaßen - kein großes Vertrauen gesetzt wird, wie in der Bundesrepublik, ist ein allgemeines Studienhonorar ein größerer Schutz gegen staatliche Manipulationen als eine selektive Studentenförderung - nach Begabung und Gesinnung der Bedürftigen.
Allen ernst gemeinten Befürchtungen, daß die mit dem Studienhonorar zu erreichende Lösung des Studenten aus familiären und hochschulfremden privaten Abhängigkeitsverhältnissen nur in eine um so totalere Bindung an den Staat umschlagen müsse, ist daher entgegenzuhalten: Solange die im Grundgesetz garantierte formal-rechtstaatliche Freiheit von Forschung, Lehre und Studium überhaupt erhalten bleibt, gerät der Student durch ein Studienhonorar nicht in Abhängigkeit von der staatlichen Bürokratie, ebensowenig wie der unabsetzbare Hochschullehrer durch seine Besoldung; im Gegenteil: da die problematischen, durch Richtlinien der Verwaltung zu manipulierenden besonderen Bedürftigkeits- und Begabungsprüfungen entfallen, ist mit der Zulassung zum Studium durch die akademische Selbstverwaltung für alle Studenten automatisch die Voraussetzung der Zahlung des Studienhonorars gegeben. Mit der Zahlung einer allgemeinen Arbeitsentschädigung an alle Studenten können daher keine anderen Bedingungen verknüpft werden, als sie gegenwärtig von jedem Studenten verlangt werden: der Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums.
Könnte der Student aus der Tatsache seines Studiums den Anspruch auf eine Art von Entlohnung ableiten, dann wäre es dem Staat unmöglich, seine freiwillig gewährte Unterstützung von einer Reihe von zusätzlichen Bedingungen abhängig zu machen.
Auch in Westdeutschland kann nur durch ein Studienhonorar gewährleistet werden, daß nicht eines Tages eine intolerante Regierung das „Verständnis für die Umwelt“ als Voraussetzung für die Förderung in sehr eigentümlicher Weise definiert und etwa oppositionelle Studenten grundsätzlich als „charakterlich unreif“ von der selektiven Förderung ausschließt. Die Förderung durch ein Studienhonorar liegt also im Interesse aller Studenten, die weder eine Abhängigkeit vom Elternhaus nach der Volljährigkeit, noch eine Abhängigkeit vom Staat, von Förderungsbürokraten und Gesinnungsschnüfflern für wünschenswert halten.
Das Studienhonorar ist gerade das wirkungsvollste Instrument für die faktisch vollständige Ausschaltung staatlichen und privaten Einflusses auf die Studentenförderung. Selbst von einem einseitig bei dieser Begründung verharrenden liberalen Standpunkt erscheint also das Studienhonorar gerechtfertigt als eine selbstverständliche Pflicht des Staates, wie im Falle anderer öffentlicher Dienste, deren Leistungen (z.B. Energieversorgung) ebenfalls unterschiedslos und ohne besondere Abhängigkeiten zu begründen, allen Staatsbürgern zugute kommen.
V.3.2 Studienhonorar und Ausbildungsbeihilfe
Das Studienhonorar muß aber auch im Zusammenhang einer allgemeinen Sozial- und Bildungsreform gesehen werden, die der Demokratisierung der Bildungswege dient. Im Rahmen einer allgemeinen gesetzlichen Regelung der Jugendförderung und Ausbildungsförderung ist das Verhältnis zwischen Ausbildungsbeihilfe und Ausbildungsentschädigung (Honorar, Entlohnung) zu klären.
Dabei wird von der unterschiedlichen Funktion der jeweiligen Ausbildungsform sowie von dem Alter des Auszubildenden auszugehen sein: Es ist zu unterscheiden zwischen a) verschiedenen Graden der Produktivität einer Ausbildung im Rahmen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses im weitesten Sinne und b) den verschiedenen Altersstufen, in denen schrittweise die Volljährigkeit erreicht wird. In beiden Fällen sind die Übergänge fließend.
Die Schule dient noch mehr der allgemeinen Bildung und Erziehung, weniger der direkten Berufsausbildung, wie die Fachschulen, noch der direkten Berufsvorbildung wie die Hochschulen.
Die Volljährigkeit beginnt zwar in der Bundesrepublik rechtlich erst mit 21 Jahren, aber die Vollendung des 18. Lebensjahres ist faktisch ein viel realerer Einschnitt, dem neben dem Ende der Schulpflicht auch noch einige andere juristische Statusänderungen entsprechen.
Da einerseits echte Arbeitsleistungen im Zusammenhang des gesellschaftlichen Produktionsprozesses nur im Hoch- und Fachschulstudium, nicht in der allgemeinbildenden Schule erreicht werden, und da andererseits, realistisch gesehen sich die eigentliche Grenze der Volljährigkeit vom vollendeten 21. zum 18. Lebensjahr verschoben hat, so kann zwischen Ausbildungsbeihilfen für sozial bedürftige Schüler (bis zum 18. Lebensjahr als Erziehungsbeihilfe an die Eltern, danach als direkte Beihilfe an den Schüler) und Arbeitsentschädigung (Honorar) für Studierende der Fach- und Hochschulen unterschieden werden.
Die Unterhaltspflicht der Eltern sollte - auch wenn sich eine rechtliche Vorverlegung der Volljährigkeit nicht erreichen läßt - faktisch mit dem Ablauf des schulpflichtigen Alters enden, das bedeutet aber auch die Begrenzung der Unterstützung von sozial schwächer gestellten Eltern durch Ausbildungsbeihilfen für ihre Kinder auf das schulpflichtige Alter. Danach ist ihre Ausbildung entweder - im Falle einer weitergehenden Schulbildung durch direkte Ausbildungsbeihilfen an die Schüler selbst oder aber durch Zahlung einer Arbeitsentschädigung (Studienhonorar) - beim Studium an Hoch- und Fachschulen - zu fördern.
Eine Unterscheidung zwischen Hoch- und Fachschulstudium im Rahmen der Studentenförderung ist nicht zu rechtfertigen. Auch die Ausbildung der Fachschulstudenten ist eine Grundvoraussetzung der dynamischen Weiterentwicklung des Wirtschaftslebens. Ihre intensive, wenn auch weniger selbständige Arbeit an der Qualifizierung ihrer Arbeitskraft für spezielle Funktionen im Berufsleben setzt sich noch direkter in ökonomische Werte um als ein wissenschaftliches Studium, das zum Teil nur im Gesamtzusammenhang des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses in der Hochschule und über verschiedene Stufen der Vermittlung „produktiv“ im ökonomischen Sinne erscheint.
Eine Beschränkung des Studienhonorars auf die Studenten wissenschaftlicher Hochschulen setzte voraus, daß es allein aus dem - berechtigten - liberalen Prinzip der Bewahrung, wenn nicht überhaupt der vollen Verwirklichung akademischer Freiheit gefördert werde. Der Student würde danach nicht als junger Mensch mit dem Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und freie Berufswahl gefördert werden, sondern als künftiger (oder „vorübergehend“ tätiger) Wissenschaftler. Das Studium erhielte wiederum den Charakter eines sozialen „Privilegs zur Muße“ in bewußter Distanz zu den unterprivilegierten Fachschulabsolventen. Nichts kann aber der Sache der Studentenförderung mehr schaden als eine verbreitete Mißgunst gegen Privilegien der Studenten.
VI. Die demokratische Hochschulverfassung
Vor dem Hintergrund der in kritischer Auseinandersetzung mit Theorie und Realität der gegenwärtigen Hochschulverfassung bereits ausführlich entwickelten Prinzipien einer Demokratisierung der Hochschule (153) und nach der Behandlung der sozialen Lage und der Arbeitsverhältnisse des Lehrkörpers und der Studentenschaft bleibt noch die Aufgabe, konkretere Vorstellungen über die praktische Organisation einer demokratischen Hochschulselbstverwaltung zu erarbeiten, um die Tragfähigkeit jenes Anspruchs auf Demokratisierung der Hochschule für die Praxis der Verwaltung der Aufgaben der Hochschule und der Regelung der sozialen Angelegenheiten ihrer akademischen Bürger zu überprüfen. Wenn dabei der Versuch unternommen wird, diese Konkretisierung z.T. bis in organisatorische und institutionelle Details zu vollziehen, so können solche Lösungen nur als eine, beispielhafte, Möglichkeit unter einer Vielzahl anderer Formen der Demokratisierung der Hochschule aufgefaßt werden.
VI.1 Allgemeine Organisationsprinzipien einer demokratischen Hochschulverfassung
Aus der funktionalen und altersmäßigen Gliederung der Mitgliedschaft der Hochschule ergibt sich konsequent die Bildung von drei genossenschaftlichen Teilverbänden innerhalb der Gesamthochschule:
Studentenschaft mit ihren bestehenden Organen;
Assistentenschaft, der alle nichthabilitierten, hauptamtlich angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter und Lehrkräfte angehören;
Professorenschaft, das Kollegium aller habilitierten (oder ohne Habilitation berufenen) hauptamtlichen Hochschullehrer.
Da bei der Größe der heutigen Universitäten weder innerhalb der Teilverbände noch in der allgemeinen Selbstverwaltung „unmittelbare Demokratie“ zu verwirklichen ist, müssen die gewählten Vertreter der Teilverbände in dafür geeigneten Organen der Universität (und ihrer Fakultäten und Institute) ihre unterschiedlichen Interessen zu einem Ausgleich bringen und sich über die Regelung der gemeinsamen Aufgaben und Angelegenheiten einigen. (In vielen Hochschulen der USA und in lateinamerikanischen Ländern sind bereits seit langem praktische Formen einer solchen Kooperation von Hochschullehrern und Studentenvertretern in der akademischen Selbstverwaltung verwirklicht.)
Dabei ist zwischen drei unterschiedlich strukturierten Arbeits- bzw. Verwaltungsbereichen innerhalb der Hochschule zu unterscheiden:
den festgelegten Rechten und Pflichten der einzelnen Hochschullehrer, Assistenten und Studenten, die sich aus ihren unterschiedlichen Funktionen im wissenschaftlichen Arbeitsprozeß der Hochschule ableiten (z.B. das Recht der Professoren, nach eigenem Ermessen, aber im Interesse einer sinnvollen Ausbildung der Studenten, Vorlesungen und Seminare zu veranstalten; das Recht der Studenten, diese oder jene Vorlesung zu besuchen oder nicht zu besuchen);
dem Kernbereich des gemeinsamen Vollzugs von Forschung, Lehre und Studium unter Wahrung der akademischen Freiheit des Einzelnen, indem sich alle an einer bestimmten, selbst gewählten Aufgabe Beteiligten in einem Kompromiß einigen, andernfalls sie überhaupt nicht zusammenarbeiten können (z.B. Organisation eines bestimmten Forschungs- oder Studienprogramms durch Vertreter aller daran Beteiligten);
dem weiteren Bereich der eigentlichen Hochschulselbstverwaltung, indem auf Grund von demokratischen Mehrheitsentscheidungen Beschlüsse gefaßt werden, an die alle gebunden sind (z.B. Bewilligung von Planstellen oder Arbeitsmitteln u.a. Fragen der Wirtschaftsverwaltung, aber auch der Interessenvertretung).
Als die grundlegenden Selbstverwaltungseinheiten sind angesichts der heutigen Größe der Universitäten nicht mehr die Fakultäten, sondern vor allem die Institute anzusehen; sie sind nicht Betriebsmittel eines Institutsdirektors, sondern der Ort der Zusammenarbeit von Hochschullehrern, Assistenten und Studenten, die daher bei der Leitung und Regelung der Angelegenheiten des Instituts zusammenwirken sollten.
Zur wirkungsvollen Wahrnehmung der umfangreichen Aufgaben einer modernen Hochschulselbstverwaltung mit eigener Wirtschaftsverwaltung benötigt die Hochschule einen größeren eigenen bürokratischen Apparat, der aber von einer starken, demokratisch-legitimierten und kontrollierten Verwaltungsexekutive geleitet werden muß, in der Professoren, aber auch Assistenten und ältere Studenten für eine gewisse Zeit hauptamtlich tätig sind.
VI.1.1 Aufgaben der Hochschulselbstverwaltung
Aus der doppelten Funktion der Hochschulselbstverwaltung in einer sozialen Demokratie Verwaltung eines Sachgebietes und Vertretung von Personen - ergeben sich für die Selbstverwaltung folgende Ausgaben:
Organisation der Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Studium;
Verwaltung der vom Staat der Hochschule zur freien Verfügung gestellten Betriebsmittel;
Regelung der sozialen Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Hochschule;
Vertretung der sozialen und politischen Interessen der akademischen Bürger in der Gesellschaft und gegenüber dem Staatsapparat.
Dabei handelt es sich nicht um eine Erweiterung des traditionellen Aufgabenbereichs der Hochschule, sondern die Lösung ihrer Aufgaben, der gemeinsamen Arbeit von Hochschullehrern, Assistenten und Studenten in Forschung, Lehre und Studium erfolgt in einer Demokratie, die sich beginnt, als eine soziale Demokratie zu konstituieren, notwendigerweise in anderen Formen und Arbeitsverhältnissen als im Obrigkeitsstaat oder in einer rein formalen politischen Demokratie.
Auf politische Stellungnahmen und Aktionen kann die Hochschule, und im besonderen Maße die Studentenvertretung, im Interesse des ihr immanenten Engagements an die volle Herstellung der Autonomie des Menschen durch Verwirklichung einer freien, vernünftig organisierten Gesellschaft nicht verzichten, sollen nicht wiederum Kräfte wie die traditionellen Korporationen in einer Weise in der öffentlichkeit für „die Universität“ Stellung beziehen und sich ihre Vertretung anmaßen, die das aufklärerische Ziel der in der Universität betriebenen Wissenschaft bereits einmal verfälscht und in sein inhumanes, gegenaufklärerisches Zerrbild verkehrt haben.
VI.1.2 Praktische Zwischenlösungen
Da der Einführung einer genuin demokratischen Hochschulselbstverwaltung in den deutschen Universitäten besonders starke traditionell verfestigten Widerstände entgegengebracht werden, müssen von den Studentenvertretungen praktikable Kompromiß- und Zwischenlösungen entwickelt und vorgeschlagen werden, deren Funktionieren die Professoren von der Nützlichkeit solcher Einrichtungen überzeugen soll.
Im Sinne einer Anregung der Hinterzartener Hochschulkonferenz der WRK und des Hochschulverbands von 1952 wird daher empfohlen, zunächst rein beratende Gremien zu schaffen, „in denen auf breitester Basis grundsätzliche Hochschulfragen besprochen werden“. Daran sollten gewählte Vertreter der Ordinarien und Nichtordinarien, der Assistentenschaft und der Studentenschaft teilnehmen.
Ähnlich zusammengesetzte beratende Ausschüsse sollten möglichst auch den Fakultätsvertretungen der Ordinarien und den Institutsdirektoren beigeordnet werden, um hier die erstrebte praktische Zusammenarbeit und gegenseitige Information und Beratung an ganz konkreten Problemen zu erproben.
Erst in einer späteren Phase erscheint es möglich, daß diese beratenden Organe allein durch ihre praktisch erfolgreiche Arbeit in der Hochschule ein solches Gewicht erhalten, das es rechtfertigt, ihnen auch eine Beschlußfassung und Entscheidungsgewalt in wichtigen Fragen der allgemeinen Hochschulselbstverwaltung zu übertragen, während nach und nach die Aufgaben der traditionellen Organe der Professorenschaft - Senat und engere Fakultäten auf die Organisation von Forschung und Lehre im engeren Sinne sowie auf rein „professorale Angelegenheiten“ beschränkt werden könnten.
Um den Kontakt zwischen allen Bereichen der Hochschulselbstverwaltung zu verbessern, ist es daneben allerdings erforderlich, daß Studentenvertreter, wenn auch nur mit beratender Stimme, möglichst an allen Sitzungen der Senate und Fakultäten teilnehmen, ebenso wie die Teilnahme von Senatsbeauftragten an Sitzungen der Studentenparlamente nützlich erscheint.
VI.2 Aufgaben der Studentenvertretung
Die Arbeit der Studentenvertretungen muß in stärkerem Maße als bisher das politische und soziale Bewußtsein der Studenten, wie es uns aus empirischen Untersuchungen (Student und Politik, Untersuchungen bei Schelsky, Skeptische Generation) entgegentritt, bei der Setzung von Schwerpunkten und Zielen ihrer Arbeit in Rechnung stellen.
Die mangelnde Beteiligung der Studenten an den Wahlen für die Studentenvertretungen und ihr Desinteresse an deren Arbeit, ist zwar Ausdruck der auch sonst in dieser Gesellschaft vorwiegenden Konsumentenhaltung des Staatsbürgers gegenüber den staatlichen Organen und gesellschaftlichen Institutionen, aber es besteht doch gerade an der Universität noch am ehesten die Chance, das Verharren in einem bloßen Konsumenten-Dasein wenigstens bewußt zu machen und mindestens im engsten Rahmen der Arbeit des Studenten in der Hochschule aufzuheben. Immerhin ist die Bereitschaft zu politischer Aktivität bei Studenten wesentlich höher als bei ihren Altersgenossen außerhalb der Hochschule.
Wenn dennoch weitgehend Desinteresse an der Arbeit der Studentenvertretung vorherrscht, so müssen zusätzliche Gründe dafür auch in der mangelnden Fähigkeit und in dem fehlenden Willen vieler Studentenvertreter gesehen werden, die nächstliegenden realen Interessen der Studenten zu erkennen und wirksam zu vertreten. Sind doch diese Studentenvertreter z.T. ebenfalls durch die Schule des traditionellen Bildungshumanismus gegangen. Gerade bei Studentenvertretern wirkt sich jedoch das dadurch vermittelte Gesellschaftsbild besonders verhängnisvoll aus, als sie entweder aus einem besonderen Führungsanspruch sich über die Masse der Studenten erheben, andererseits aber nicht bereit sind, die „materialistischen Interessen“ der Studenten wirksam zu vertreten.
Im Gegensatz dazu müssen die Bemühungen von Studentenvertretern, die eine demokratisch, Beteiligung der Studentenschaft erstreben (und nicht ihre Führung durch eine „Elite der Elite“) gerade bei den folgenden Gruppen von Studenten einsetzen:
- der Minderheit derjenigen Studenten, die immerhin - aus moralischem Antrieb zumeist - Demokratie „von unten“ verwirklichen und praktizieren wollen,
- sowie bei jenen, die im Unterschied zu den vom Bildungshumanismus geprägten Studenten einen „realistischen“ Sinn für ihre nächstliegenden Interessen, beruflicher und sozialer Art entwickeln verbunden mit der Bereitschaft, Fachschaft, AStA und VDS als Interessenvertretungen zu akzeptieren und zu benutzen.
Daher muß die Aktivität der Studentenvertretungen stärker als bisher bei den unmittelbaren Interessen der Studenten und bei ihrer Stellung im Instituts- und Seminarbetrieb, in der Klinik und im Labor einsetzen. Das erfordert eine intensive Beschäftigung mit der Betriebsstruktur der Hochschule und der Stellung des Studenten darin. Nur wenn Studentenvertreter auf diesem Gebiet hervorragendes leisten, können sie in einer größeren Minderheit der Studentenschaft Resonanz für weiterreichenden Ziele der Demokratisierung der Hochschule und der wissenschaftlichen Vertiefung des Studiums finden. Dadurch kann den Studenten die Vermittlung zwischen ihrer Alltagssituation bei der Arbeit im Seminar oder im Labor und der autoritären Betriebs- und Verfassungsverhältnissen der Hochschule bewußt gemacht werden.
In der Praxis bedeutet das eine Verstärkung der Fachschaftsvertretungen in den Augen der Studenten zu einem notwendigen Instrument ihrer Interessen im Institut werden.
VI.3 Die studentische Fachschaftsarbeit
Die Stellung der Fachschaft, die Organisationsform der Studentenschaft zur Erleichterung und Gliederung des Studiums und als Organisation zur Wahrnehmung ihrer Interessen im Fachbereich, ist bislang namentlich darauf konzentriert, der immer stärkeren Entpersönlichung des Studienbetriebes durch Kontakte und gemeinschaftsbildende Veranstaltungen begegnen. Wie schon an anderer Stelle so ist auch hier der Begriff der Gemeinschaft zu kritisieren, durch den versucht wird, den Studenten in einer Atmosphäre des „Lernt Euch Kennen“ seine realen Interessen auf Verbesserung der Studienbedingungen und aktive Mitgestaltung des Studiums vergessen zu lassen.
Niemand kann heute in der Universität eine Lebensgemeinschaft sehen, wenn er nicht die hochspezialisierte Betriebsstruktur der Universität romantisch als „Familienunternehmen“ verschleiern will. An die Stelle der „Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden“ ist die Gruppe der am wissenschaftlichen Arbeitsprozeß Beteiligten getreten.
Bewußt wurde und wird noch heute von offizieller Seite immer darauf hingewiesen, daß die Studenten sich zunächst einmal in der Fachschaftsarbeit, worunter nicht mehr als persönliche Kontaktaufnahme verstanden wird, zu bewähren hätten, bevor sie der Lösung hochschulpolitischer Fragen näher treten und Interessen gegenüber der Institutsleitung geltend machen dürften. Bei einer solchen Argumentation wird verkannt, daß eine erfolgreiche Fachschaftsarbeit nur dann gewährleistet ist, wenn eine Änderung des Studienbetriebes in Angriff genommen wird. Auf die Änderung des augenblicklichen Studienbetriebes muß von der Fachschaft in der von uns gekennzeichneten Studienselbsthilfe gedrungen werden. (154) Die Studienselbsthilfe ist eine am eigenen Studieninteresse des Studenten orientierte Hauptaufgabe der Fachschaft.
Die Definition der Fachschaft durch den VDS: „Die Fachschaft ist als Untergliederung der Studentenschaft der Zusammenschluß der Studenten gleicher Studienrichtung, besonders in Hinblick auf den angestrebten Beruf“ (155) - z.B. Fachverband Philosophie als Entsprechung zum Philologenverband - ist aus folgenden Gründen einseitig:
Nicht der wissenschaftliche Arbeitsprozeß und die Interessenvertretung und Mitwirkung in den Instituten und anderen Arbeitsstätten der Hochschule ist für die Fachschaft im Sinne des VDS entscheidend, sondern die Vertretung von Standesinteressen im Hinblick auf die spätere Berufsstellung. Damit wird aber das Interesse der Studentenschaft vollends vom Kernbereich der Hochschule abgelenkt und auf die Regelung „studentischer Angelegenheiten“ verwiesen. Wie bei dieser Konzeption der Fachschaftsarbeit die auch vom VDS beklagte „Diktatur der Ordinarien“ in der alltäglichen Praxis des Studiums in den Instituten in Frage gestellt werden soll, bleibt unerfindlich. Dies kann nur erreicht werden, wenn die durchaus notwendigen Aufgaben der Fachschaften bei der Vertretung der beruflichen und allgemeinen Studenteninteressen ergänzt werden durch konkrete Aufgaben in der Praxis des wissenschaftlichen Studiums, durch einen Beitrag der Fachschaften zur Gestaltung des wissenschaftlichen Lehr- und Studienbetriebes. Um auch diese Aufgaben erfüllen zu können, ist eine grundlegende Veränderung der Struktur der meisten Fachschaftsvertretungen notwendig.
Neben den zentralen Fachverbänden (z.B. Medizin, Philosophie) als Zusammenschlüsse der Studentenschaften ganzer Fakultäten oder allgemeiner Studienrichtungen zur wirkungsvollen Vertretung studentischer Interessen müssen engere Fachschaftsvertretungen im Rahmen einer Fakultät oder Studienrichtung gebildet werden, die neben der Wahrnehmung der studentischen Interessen in den Instituten, Seminaren, Kliniken der Universitäten auch an der Erfüllung der wissenschaftlichen Aufgaben der Universität, bei der Gestaltung des Studiums, mitwirken sollen.
Die Fachschaften müssen auf breiter Basis demokratisch strukturiert und auf kleinen Gruppen aufbauen, um möglichst viele Studenten zur Mitarbeit an den Veranstaltungen und den Aufgaben der Fachschaft zu gewinnen.
Abgesehen von den sehr kleinen Fachschaften sollten nicht mehr wie bisher lediglich ein oder zwei Fachschaftsprecher von der Studentenvertretung bestimmt oder von einer (kaum besuchten) Fachschafts-Vollversammlung gewählt werden, sondern es sollten Fachschafts- oder Institutsausschüsse aus Vertretern gebildet werden, die in jedem Semester in den einzelnen Seminaren, Proseminaren, Übungen eines Instituts oder einer Fachrichtung gewählt werden. Die Wahl von Seminarvertretern ist dort zweckmäßig, wo Seminare und Übungen die Grundeinheiten des Studiums bilden. In den naturwissenschaftlichen und technischen Fachrichtungen ist zum Teil eine entsprechende Gliederung in Arbeitssäle, Labors, Praktika, Kurse etc. möglich. Da der Seminarvertreter auch den Dozenten, der das Seminar veranstaltet, bei organisatorischen Aufgaben unterstützen soll, muß er zu Beginn des Semesters (und vorläufig schon nach einer Vorbesprechung am Ende des vorhergehenden Semesters) gewählt werden. Voraussetzungen dafür sind
a) daß die Dozenten ausführliche Vorbesprechungen am Ende des vorhergehenden und frühzeitig zu Beginn des laufenden Semesters veranstalten,
b) daß auf Initiative der Fachschaftsvertretungen nach der wissenschaftlichen Vorbesprechung die Teilnehmer des Seminars Gelegenheit haben, sich auf einem Klubabend oder Gesprächsabend persönlich kennenzulernen, an dem auch der Dozent, sowie Assistenten oder Tutoren und Fachschaftsvertreter teilnehmen.
Von dem Fachschafts- oder Institutsausschuß wird ein Sprecher gewählt, dessen Aufgabe es ist, in Arbeitsteilung mit Ausschußmitgliedern, die mit bestimmten Aufgabenbereichen betraut werden, die Interessen der Studenten seiner Fachschaft gegenüber der Institutsleitung, den Dozenten und Assistenten sowie gegenüber den anderen Organen der Studentenvertretung wahrzunehmen und ferner für eine sinnvolle Mitwirkung der Fachschaftsvertretung an der Gestaltung des Studiums durch eigene Veranstaltungen und organisatorische Unterstützung der Lehrveranstaltungen des Dozenten zu sorgen.
Die Fachschaftsvertretungen sollten, sofern sie in der Lage sind, einen sinnvollen Beitrag zur Gestaltung des Studiums und zur Unterstützung der Lehrtätigkeit der Dozenten zuleisten, eine verantwortliche Beteiligung an der Instituts- oder Abteilungsverwaltung fordern, die zur gemeinsamen Selbstverwaltung der Dozenten, Assistenten und Studenten im Rahmen eines Faches umgewandelt werden soll. Solange die gemeinsame Selbstverwaltung im den Instituten nicht möglich ist, sollte zumindest angestrebt werden, im einer regelmäßig tagenden beratenden Institutsversammlung der Dozenten, Assisten, Tutoren und studentischen Fachschaftsvertreter gemeinsam interessierende Angelegenheiten zu besprechen. In jedem Semester soll eine Vollversammlung der Fachschaft stattfinden, um über die geleistete und zukünftige Arbeit zu beraten.
Die Arbeit der Fachschaftsvertretungen sollte sich auf die folgenden Gebiete erstrecken:
Fragen der Studiengestaltung durch Studienselbsthilfe und durch Unterstützung des Lehrkörpers: Fachliche Studienberatung durch ältere Studenten und Tutoren, Anregung der Bildung von Arbeitskreisen, Diskussionskreisen, Seminargruppen, Konversations- und Sprachgruppen, Vervielfältigung von Vorlesungsmanuskripten, Bibliographien für Seminare und Vorlesungen sowie zur allgemeinen Studieneinführung, von wichtigen Seminararbeiten, Referaten und Arbeitsergebnissen wissenschaftlicher Arbeitskreise;
Fragen der allgemeinen Studienreform, der Ausgestaltung von Prüfungsordnungen, Studienplänen, Zwischenprüfungen;
Mitwirkung an der Planung der Lehrpläne und Studienprogramme des Faches: Durch Bildung einer Kommission aus ältereren Studenten und studentischen Tutoren, die konkrete Vorschläge für Lehrveranstaltungen und Studienprogramme entwickeln soll, nachdem sie in Umfragen unter den Studenten des Faches die Resonanz der bisherigen Veranstaltungen und die speziellen Studieninteressen festgestellt hat;
Fragen, die die spätere berufliche Stellung der Studenten betreffen: Stellungnahme zu Formen der Berufsvorbereitung im Studium (Praktika, spezielle Kurse), Kontakte zu Vertretern der Berufspraxis durch Veranstaltung von Berufsberatungen, Gesprächsabenden zwischen Dozenten, Studenten und Vertretern der Praxis;
Mitwirkung an der Eigungsfeststellung bei der Studentenförderung nach dem Honnefer Modell und bei den allgemeinen Zwischenprüfungen: Durch Benennung und Einarbeitung von studentischen Beisitzern in den Fachprüfungskommissionen sowie durch Beratung der Studenten, die sich auf eine derartige Prüfung vorbereiten;
Verbesserung der persönlichen Kontakte unter den Studenten und zu den Dozenten und Assistenten z.B. durch Veranstaltungen von Klubabenden für alle Teilnehmer eines Seminars zu Beginn und am Ende des Semesters.
IV.4 Modell einer demokratischen Hochschulverfassung
Obwohl der Versuch einer umfassenden Demokratisierung der Hochschulselbstverwaltung gegenwärtig aussichtslos erscheint, soll im Folgenden dennoch an einem Modell beispielhaft demonstriert werden, daß eine reale Demokratisierung der Hochschulverfassung durchaus praktikabel zu organisieren wäre, auch unter Aufnahme und z.T. Wiederbelebung traditioneller Selbstverwaltungsformen der deutschen Universitäten.
Das Modell, in dem weniger die satzungsrechtlichen Einzelheiten als vielmehr die Struktur und Funktion der einzelnen Organe erläutert werden sollen, lehnt sich z.T. an die Verfassungen einiger Universitäten in den USA an.
Die Hochschulselbstverwaltung gliedert sich in dem vorgeschlagenen Verfassungsmodell in Organe der allgemeinen Selbstverwaltung und in Selbstverwaltung- und Vertretungsorgane von drei Teilverbänden - Professorenschaft (oder Lehrkörper), Assistentenschaft, Studentenschaft - und zwar jeweils wiederum auf drei Selbstverwaltungsebenen: Fachinstitute - Fakultäten - Gesamt-Hochschule.
VI.4.1 Die Institute
Die grundlegenden Selbstverwaltungseinheiten der Hochschule bilden die Institute (bzw. Seminare, Kliniken), da fast alle Hochschullehrer und wissenschaftlichen Mitarbeiter (Assistenten Tutoren) im Rahmen eines Instituts tätig sind oder auf die Benutzung der Arbeitsmittel der Institute angewiesen sind. Wo Institute nur rein technische Einrichtungen sind und nicht mit der Einteilung im Fachrichtungen identisch sein können, werden innerhalb einer Fakultät Abteilungen gebildet werden, entsprechend den größeren Fachdisziplinen der Fakultät, die z.T. identisch sind mit den Studienrichtungen in der Ausbildung der Studenten.
Die Selbstverwaltung der Institute (bzw. Kliniken, Seminare, Abteilungen) besteht aus den folgenden Organen:
- Alle habilitierten (und die ohne Habilitation berufenen) hauptamtlichen akademischen Lehrer sind zur Ausübung ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit im Rahmen eines Instituts verpflichtet und bilden das Kollegium ihres Fachinstituts. (In großen Instituten kann es 30 und mehr Hochschullehrer umfassen, in kleinen Spezialfächern mögen es aber auch nur drei bis vier sein.)
Aus dem Kreis der Ordinarien wird vom Kollegium ein Vorsitzender, aus dem Kreis der Nichtordinarien ein Stellvertreter für die Dauer eines Jahres gewählt. Das Kollegium kann einen verdienten Ordinarius oder Emeritus zu seinem Präsidenten auf Lebenszeit berufen.
Neben der Vertretung der Interessen seiner Mitglieder und der Vorbereitung von Entscheidungen der Institutsleitung und Fakultätsselbstverwaltung hat das Kollegium folgende besondere Aufgaben:
Koordinierung der Forschungsarbeiten seiner Mitglieder, ausführliche Beratung des Lehrplans, Vorbereitung und Begutachtung von Berufungen, Habilitationen und Promotionen (in Verbindung mit Fach-Kollegien, deren Fach der Doktorand als Nebenfach studiert). In den größeren Instituten bildet das Kollegium für diese Aufgaben besondere Kommissionen, darunter auch einen Personalausschuß, der Bewerbungen um freie Stellen im Stellenplan des Instituts prüft und Vorschläge für ihre Besetzung an die Institutsleitung macht, An den Sitzungen der Kommissionen für Berufungen, Habilitationen, Promotionen, Personalfragen in den entsprechend der Zusammensetzung des Lehrkörpers des Faches auch Nichtordinarien stimmberechtigte Mitglieder sind, nehmen Vertreter der Assistenten- und Tutorenschaft und studentische Sprecher teil (die von der Fachschaftsvertretung speziell für diese Aufgabe gewählt werden).
Daneben tritt das Kollegium bei Bedarf zu wissenschaftlichen Arbeitssitzungen zusammen, zu denen auch wissenschaftliche Assistenten, Tutoren, Doktoranden (je nach der Themenstellung) eingeladen werden. (156) - Alle im Institut hauptamtlich beschäftigten (nicht habilitierten) wissenschaftlichen Assistenten, Tutoren, Hilfsassistenten (nicht studentische) Hilfskräfte bilden die Assistentenschaft des Instituts, die sich einen Sprecher mit einem Arbeitskreis von Stellvertretern wählt. Sie sollen die Interessen der nichthabilitierten wissenschaftlichen Mitarbeiter und Nachwuchskräfte gegenüber dem Kollegium und der Institutsleitung vertreten, z.B. in Fragen der Arbeitsbedingungen, Benutzung von Einrichtungen und Arbeitsmitteln des Instituts. In den großen Instituten sollen sollen sie den Kontakt der Assistenten und jüngeren Lehrkräfte untereinander verbessern helfen, z.B. durch wissenschaftliche Arbeitskreise, Tagungen, Exkursionen. Alle Mitglieder der Assisten- teenyhaft, die an den Lehraufgaben des Instituts mitwirken, treten zu Beratungen über den Lehrplan zusammen.
- Die Studenten, die im Haupt- oder Nebenfach an dem Institut studieren, d.h. an seinen Seminaren oder anderen Übungen teilnehmen, wählen zu Beginn des Semesters (wenn möglich schon auf einer Vorbesprechung am Ende des vorhergehenden Semesters) in allen Seminaren (Übungen, Kursen u.a. Grundeinheiten des Studiums) Vertreter, die für das laufende Semester den Studentischen Institutsausschuß (oder Fachschaftsausschuß) bilden, bzw. wählen (in den großen Fachinstituten mit zahlreichen Seminaren wird von der Seminarvertreterversammlung ein engerer, geschäftsführender Institutsausschuß gewählt). Dem Ausschuß gehören außerdem einige Älteste an, die vom Institutsausschuß des vorhergehenden Semesters gewählt bzw. wiedergewählt wurden, ferner die Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Studentischen Tutoren und Hilfskräfte, sowie mit beratender Stimme ein Assistent (oder „Wissenschaftlicher Tutor“ ([Fußnote fehlt]) des Instituts an, der einen möglichst engen Kontakt zur Assistentenschaft herstellen soll. Der Ausschuß wählt den Sprecher der Studentenschaft des Instituts (Fachschaftssprecher) und mehrere Stellvertreter.
(In den Medizinischen, Juristischen und Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultäten, die nicht in engere, jeweils auf ein einziges Institut bezogene Fachschaften gegliedert sind, gleichwohl aber aus zahlreichen Instituten (bzw. Kliniken) für die einzelnen Fachgebiete bestehen, ist eine andere Gliederung und ein anderer Aufbau der Fachgebiete bestehen, ist eine andere Gliederung und ein anderer Aufbau der Fachschaftsvertretungen notwendig: Ausgehend von der schon bestehenden oder angestrebten Gliederung des Studiums in drei Abschnitte - Vor-, Haupt- und „Graduierten“ -Studium - sollten für jeden der Abschnitte des Studiums Arbeitsgemeinschaften oder Ausschüsse von Vertretern der Semesters oder Studienjahres gebildet werden, die die Studentenvertretung der Fakultät durch Wahrnehmung einiger besonders „studiennaher“ Aufgaben entlasten und über die Interessen und Probleme der Studenten in den verschiedenen Phasen des Studiums informieren könnten. Außerdem muß aber die Studentenvertretung der Fakultät in Verbindung mit den Ausschüssen der Studienabschnitte Sprecher oder Beauftragte wählen, die die Interessen der Studentenschaft in den einzelnen Fachinstituten (bzw. Kliniken) der Fakultät wahrnehmen und bei deren Selbstverwaltung mitwirken sollen.)
Aufgaben des studentischen Fachschafts- oder Institutsausschusses sind u.a. Organisation eines Studienselbsthilfeprogramms, Vertretung studentischer Interessen im Institut, Mitwirkung an der Gestaltung des Studien- und Lehrplans, Verwaltung von Klubräumen u.a. Einrichtungen der Fachschaft. (Vgl. im einzelnen oben: „Die studentische Fachschaftsarbeit“). Zur Bearbeitung einiger Fragen müssen Kommissionen aus geeigneten Seminarvertretern und älteren (kooptierten) Studenten gebildet werden, an deren Sitzungen möglichst ein Assistent beratend teilnehmen sollte: Lehrplan-Kommission, Förderungsausschuß (der studentischen Beisitzer bei Prüfungen für die Studentenförderung), Studienselbsthilfe-Kommission. - Alle Mitglieder des Kollegiums und der Assistentenschaft (gegebenenfalls auch die hauptamtlich ergänzenden Lehrkräfte wie z.B. Lektoren und Studienräte im Hochschuldienst), die studentischen Tutoren und Hilfskräfte und alle studentischen Seminarvertreter bilden die Institutsversammlung als Organ der allgemeinen Selbstverwaltung des Instituts. Sie tritt mindestens einmal im Semester zusammen, um den in Ausschußberatungen im Detail zusammengestellten und koordinierten Studien- und Lehrplan (einschließlich des Studienselbsthilfeprogramms der studentischen Fachschaft) für das folgende Semester endgültig zu beraten und für alle Beteiligten zu erläutern und um grundsätzliche Fragen der Verwaltung und Zusammenarbeit im Institut zu besprechen. Alle Ordnungsstatuten und die akademischen Fach-Prüfungsordnungen müssen von der Institutsversammlung beraten und gebilligt werden. Das Kollegium, die Assi - stentenschaft und die Studentenvertretung des Instituts müssen sich auf die Berufung eines geschäftsführenden Institutsdirektors aus dem Kreise der außerplanmäßigen und planmäßigen Professoren des Instituts einigen (der nicht zugleich Vorsitzender des Kollegiums sein sollte), der möglichst mehrere Jahre amtieren soll. Er führt die laufenden Geschäfte der Institutsverwaltung, trägt die Verantwortung für die Instandhaltung und Verwendung der Arbeitsmittel und Einrichtungen des Instituts, vertritt das Institut im Rahmen der Fakultätsselbstverwaltung. Die Direktoren der großen Fachinstitute können während ihrer Amtszeit ihre eigene Forschungs- und Lehrtätigkeit nur in beschränktem Umfang fortführen.
Der Institutsdirektor, der Vorsitzende des Kollegiums und sein Stellvertreter, je zwei Sprecher der Assistenten und der Studenten des Instituts bilden die Institutsleitung (Verwaltungsausschuß, Direktorium) das regelmäßig tagende Arbeitsorgan der Instituts-Selbstverwaltung, an dessen Beschlüsse der geschäftsführende Direktor gebunden ist. (In den kleinen, sog. Lehrstuhl- Instituten, die in den kleineren, Fachrichtungen mit sehr wenigen Studenten bestehen, ist der Ordinarius allerdings automatisch Instituts direktor, aber eine Zusammenarbeit mit den Studenten und Assistenten des Instituts ist gewährleistet, wenn auch hier die wichtigsten Entscheidungen gemeinsam, vor einer Institutsleitung aus Ordinarius, Assistent und studentischem Sprecher, beraten und getroffen werden). zu den Aufgaben der Institutsleitung gehören: Zusammenstellung des Studien- und Lehrplans aufgrund der Pläne der Mitglieder und der Studentenvertretung, Entscheidung über die Vorschläge des Instituts an die Fakultät und Gesamthochschule für Berufungen, Erteilungen der Lehrbefugnis an Habilitierte, für die Besetzung freier Stellen für Assistenten, Hilfskräfte u.a. Mitarbeiter des Instituts, aufgrund der Begutachtung und wissenschaftlichen Prüfung der Bewerber oder Anwärter durch das Kollegium, Ausarbeitung des Haushaltsplans, Verteilung der Mittel aus dem Institutsetat (im Rahmen des Haushalts der Hochschule) an die einzelnen Forschungs- und Studienprogramme des Instituts (soweit diese nicht durch die Etatposten für die einzelnen Lehrstühle und wissenschaftlichen Institutsabteilungen oder Forschungsstellen gedeckt sind).
Die Institutsleitung setzt für einzelne Aufgabenbereiche Ausschüsse oder Kommissionen aus Mitgliedern des Kollegiums, Assistenten, Tutoren und Studenten ein: Bibliotheksausschuß, Tutorenausschuß (zur Beratung und Förderung der Arbeit studentischer Tutoren), ebenfalls einen Zulassungsausschuß.
VI.4.2 Die Fakultäten
Auf Fakultätsebene bestehen die folgenden Selbstverwaltungs- und Vertretungsorgane:
- Alle habilitierten (bzw. berufenen) hauptamtlichen akademischen Lehrer der Fakultät bilden die Vollversammlung des Fakultätskollegiums. Sie tritt nur zur Wahl des Dekans oder bei festlichen Anlässen zusammen.
Das Arbeitsorgan des Lehrkörpers der Fakultät ist das engere Fakultätskollegium unter dem Vorsitz des Dekans, der die laufenden Geschäfte des Kollegiums führt. In den größeren Fakultäten mit zahlreichen Fachrichtungen und Fachinstituten gehören dem engeren Fakultätskollegium nur die Vorsitzenden der einzelnen Fach- oder Institutskollegien sowie ihre Stellvertreter (als Nichtordinarienvertreter) an. Nur in den weniger gegliederten oder kleineren Fakultäten ist es noch möglich, das Fakultätskollegium in der bisherigen Weise aus allen Lehrstuhlinhabern und Nichtordinarienvertretern zu bilden.
An den Sitzungen des engeren Fakultätskollegiums nehmen Vertreter der Assistentenschaft und Studentenschaft der Fakultät als Gäste ohne Stimmrecht teil.
Neben der Vertretung der Interessen der Dozenten der Fakultät innerhalb der allgemeinen Selbstverwaltung der Hochschule und nach außen, hat das Fakultätskollegium besondere Kommissionen eingesetzt werden:
Ausarbeitung von Prüfungsordnungen (und der Habilitationsordnung), Beratung und offizielle Begutachtung von Berufungsvorschlägen (und Vorschlägen zur Erteilung der Lehrbefugnis für Habilitierte) der Institute, der allgemeinen Fakultätsselbstverwaltung, gegebenenfalls Entscheidung über eigene Berufungsvorschläge des Fakultätskollegiums, Durchführung von Habilitationen (Feststellung der Lehrbefähigung (157), Aufsicht über die Durchführung von Promotionen in den einzelnen Fächern und über die Durchführung aller akademischen Prüfungen und Zwischenprüfungen in der Fakultät;Koordination der Foschungs- und Lehrtätigkeit der Fach-Kollegien soweit dafür ein Bedürfnis besteht;
ferner Stellungnahmen und Gutachten zum Haushaltsplan, zur Errichtung neuer Institute und Einrichtungen.
Das Fakultätskollegium ist zugleich Vertretungsorgan der Dozenten und (in Gestalt von besonderen Kommissionen) verantwortliches Organ zur Durchführung allgemeiner, sachlicher Aufgaben der Hochschule.
- Die Vollversammlung (oder ein engeres Wahlgremium) der Assistenten (wissenschaftlichen Tutoren, Hilfskräfte etc.) der Fakultät wählt für ein Jahr die Assistentenvertretung der Fakultät (einen Arbeitskreis mehrerer Assistentenvertreter). Diese soll die Interessen der wissenschaftlichen Mitarbeiter im Rahmen der Fakultätsselbstverwaltung und darüber hinaus gegenüber der gesamten Hochschule vertreten, Kontakte zu andered Fakultäten und Hochschulen fördern, sowie wissenschaftliche Veranstaltungen, Tagungen, Arbeitskreise veranstalten oder anregen, die dem Erfahrungsaustausch, der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und Fortbildung der Assistenten und anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern dienen. Sie soll die Studentenvertretung der Fakultät bei der Koordinierung und Planung der Studienselbsthilfearbeit beraten und zu diesem Zweck gemeinsam mit der Studentenvertretung Tagungen und Seminare veranstalten.
- Die Studentenschaft der Fakultät wählt im Rahmender Wahlen für die allgemeine Studentenvertretung die Mitglieder der Studentenvertretung der Fakultät (studentischer Fakultätsausschuß), die sich einen Sprecher und mehrere Stellvertreter wählt. An den j Sitzungen der Studentenvertretung können Vertreter des rakultätskollegiums und Assistentenvertreter beratend teilnehmen. Zu den Aufgaben der Fakultäts-Studentenvertretung gehören die Koordination und Förderung der Arbeit der Institutsvertretungen oder Fachschaftsvertretungen, die Durchführung größerer studentischer Veranstaltungen, die Vertretung der studentischen Interessen, besonders durch die Erarbeitung fundierter Stellungnahmen zu allen wichtigen Fragen, die in der allgemeinen Fakultätsselbstverwaltung entschieden werden, ferner Vertretung der Studentenschaft in den Fachverbänden des VDS.
- Das Organ der allgemeinen Fakultätsselbstverwaltung ist die Fakultätsvertretung (oder „Fakultätsrat“). Sie besteht aus dem Dekan, einem Nichtordinarienvertreter, je zwei Sprechern der Studentenschaft und der Assistentenschaft, sowie einem Beirat aus allen geschäftsführenden Institutsdirektoren (mit beratender Stimme). Die Mitglieder können an Aufträge und Beschlüsse des Vertretungsorgans, von dem sie gewählt wurden, gebunden werden, sollen aber im allgemeinen nach eigenem Ermessen die Belange ihres Teilverbandes vertreten und mit den sachlichen Erfordernissen der wissenschaftlichen Aufgaben der Hochschule in Einklang bringen. (Obwohl im allgemeinen nicht formell abgestimmt wird, sollte ein Abstimmungsmodus eingeführt werden, der die Selbstbestimmung der einzelnen Gruppen, die sich aus dem Prinzip der akademischen Freiheit ergibt, nicht verletzt, aber auch persönliche Entscheidungsfreiheit zuläßt: etwa indem ein Beschluß nur Geltung erlangt, wenn mindestens einer der beiden Vertreter jedes Teilverbandes der Fakultät zustimmt, oder indem Einstimmigkeit nur bei Fragen erforderlich ist, in denen die Vertreter durch Beschlüsse und Aufträge ihres Verbandes gebunden sind. Wird ihnen die Entscheidung freigestellt, so können sie von den Vertretern der anderen beiden Verbände überstimmt werden).
Die stimmberechtigten Mitglieder der Fakultätsvertretung berufen den hauptamtlichen Präsidenten der Fakultätsvertretung („Fakultätsdirektor“). Zu seiner Wahl ist Einstimmigkeit erforderlich. Zum Präsidenten kann gewählt werden, wer planmäßiger oder apl. Professor oder Honorarprofessor ist (auch aus einer auswärtigen Fakultät), d.h. es kann auch eine geeignete Persönlichkeit berufen werden, die in der Fakultät nicht als hauptamtlicher akademischer Lehrer tätig ist, sondern in der Verwaltung, im Justizdienst, in der Wirtschaft und Technik in verantwortlichen Stellungen Erfahrungen gesammelt hat, aber aufgrund vorhergehender wissenschaftlicher Tätigkeit in der Hochschule oder in Forschungsanstalten und als Honorarprofessor Einblick in die Aufgaben und die Selbstverwaltung der Hochschule erhalten hat. Der Präsident oder Direktor der Fakultätsverwaltung führt die Geschäfte der allgemeinen Fakultätsselbstverwaltung, leitet die Fakultätskanzlei und die anderen Dienststellen der allgemeinen Fakultätsverwaltung. In seiner Amtsführung ist er an die Beschlüsse des Fakultätsrates gebunden. Der Präsident soll etwa vier bis fünf Jahre amtieren und kann wiedergewählt werden. Während der Dauer seiner Amtszeit ist er zu einer Lehrtätigkeit nicht verpflichtet.
Aufgaben des Fakultätsrates sind:
Beratung und Verabschiedung der vom Fakultätskollegium ausgearbeiteten Habilitations- und Promotionsordnungen zu aller anderen akademischen Prüfungsordnungen (die allerdings der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde, d.h. des Kultusministeriums, bedürfen)endgültige Zusammenstellung der von den Instituten vorgelegten Lehrpläne, bei Berufungen, Entscheidung über die Vorschlagsliste der Fakultät (im Falle einer Erstberufung nur nach Einholung eines positiven Gutachtens des Fachkollegiums und des Fakultätskollegiums, d.h.: gegen das Urteil des Kollegiums kann keine Erstberufung stattfinden, da es sich hierbei besonders um die Feststellung der wissenschaftlichen Qualifikation handelt; die Berufung von Lehrstuhlinhabern aus anderen Hochschulen ist jedoch auch gegen den Willen des Kollegiums und seiner Vertreter im Fakultätsrat möglich, da die Mitglieder des Kollegiums in dieser Frage „parteilich“ sind.) ferner Erteilung der Lehrbefugnis an Habilitierte (ebenfalls nur nach Begutachtung und Zustimmung des Fakultätskollegiums), auf Antrag der Institutsdirektoren Entscheidung über Besetzung von Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter und ergänzende Lehrkräfte (auch gegen das Votum der Assistentenvertreter);
Vorbereitung und Planung der Schaffung neuer Institute, Lehrstühle, Planstellen, Einrichtungen, Vergabe von besonderen Stipendien an wissenschaftliche Nachwuchskräfte, Regelung der Eignungsfeststellung für die Studentenförderung, Zulassung von Studenten (auch gegen den Willen der Studentenvertretung).
Koordinierung und organisatorische Durchführung von besonderen Studienprogrammen, an denen Studenten, Assistenten und Dozenten aus mehreren Fächern und Instituten der Fakultät beteiligt sind. (Vgl. Kapitel II, Die Hochschule und ihre Arbeitsformen).
Für einige dieser Aufgaben setzt die Fakultätsvertretung Kommissionen ein, in denen Dozenten, Assistenten- und Studentenvertreter vertreten sein müssen: Zulassungskommission, Kommission für Studenten- und Nachwuchsförderung, Berufs- und Personalkommission, Haushaltskommission, Baukommission, Kommission für die Koordinierung allgemeiner Studienprogramme auf Fakultätsebene.
VI.4.3 Die Gesamt-Hochschule
Entsprechend sind die Organe der Gesamt-Hochschule und die Vertretungen der drei Teilverbände Lehrkörper, Studentenschaft und Assistentenschaft für die ganze Hochschule aufgebaut:
- Alle habilitierten (bzw. berufenen) hauptamtlichen akademischen Lehrer der Hochschule bilden den Großen Senat („Konzil“, „Corpus Academicum“), der nur einmal im Jahr zur Wahl des Rektors zusammentritt.
Der Rektor wird aus dem Kreis der planmäßigen Professoren für ein Jahr gewählt und kann wiedergewählt werden. Da er von den allgemeinen Verwaltungsaufgaben entlastet ist, kann er an den eigentlichen und zentralen Aufgaben der Hochschule und des Lehrkörpers stärkeren Anteil nehmen. Er verkörpert die Einheit des gesamten Kollegiums der Universität und vertritt das Kollegium nach innen (gegenüber der allgemeinen Hochschulverwaltung, der Assistentenschaft und Studentenschaft) und nach außen. Er ist verpflichtet, darüber zu wachen, daß das Kollegium seine Aufgaben in Forschung und Lehre und im Prüfungswesen erfüllt. Er hat damit eine Ordnungs- und Aufsichtsfunktion im Rahmen der Selbstkontrolle des Lehrkörpers bei der Wahrnehmung seiner wissenschaftlichen Aufgaben.
Die Dekane und je ein Delegierter der Ordinarien und der Nichtordinarien jeder Fakultät bilden den (engeren) Akademischen Senat, die Gesamtvertretung des Lehrkörpers und das Organ zur Koordinierung ihrer Aufgaben.
Je zwei Vertreter der Assistentenschaft und der Studentenschaft werden als Gäste ohne Stimmrecht zu den Senatssitzungen hinzugezogen.
Zu den Aufgaben des Senats gehören:
Bestätigung der Habilitationen, Beratungen und - nach eigenem Ermessen (oder auf Ersuchen eines Fakultätskollegiums) - Begutachtung von Berufsvorschlägen der Fakultätsvertretungen (das gleiche im Falle der Erteilung der Lehrbefugnis), Beratung allgemeiner Prüfungsfragen;
Koordinierung des Lehrplans in den Grenzgebieten und interfakultativer Forschungs- und Studienprogramme;
Beratung und Stellungnahme zum Haushaltsplan der Hochschule;
soziale Fragen und Disziplinarangelegenheiten des Lehrkörpers. - Die Assistentenvertretungen der Fakultäten wählen eine allgemeine Assistentenvertretung der Universität als Interessenvertretung gegenüber der allgemeinen Hochschulverwaltung und nach außen, im Assistentenverband. Für eigene Veranstaltungen und Studienprogramme, die der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und Fortbildung der Mitglieder der Assistentenschaft dienen, muß ihr ein besonderer Etatposten im Haushalt der Universität zustehen.
- Die Studentenschaft der Hochschule wählt in Wahlkreisen, die den Fakultäten entsprechen, ein Studentenparlament (Studentenrat, Konvent), das verschiedene Ausschüsse sowie als Exekutive den Allgemeinen Studenten-Ausschuß wählt. An den Sitzungen des Studentenparlaments sollen ein Beauftragter des Senats und ein Vertreter der Assistentenschaft mit beratender Stimme teilnehmen.
Zu den eigenen Angelegenheiten der Studentenschaft gehören u.s.:
Durchführung eines weitgespannten kulturellen, sportlichen, wissenschaftlichen und politischen Veranstaltungsprogramms;
Vertretung der Interessen der Studentenschaft gegenüber den anderen Selbstverwaltungsorganen der Hochschule, im Verband Deutscher Studentenschaften und nach außen, gegenüber der Öffentlichkeit, im Rahmen der allgemeinen demokratischen Meinungs- und Willensbildung;
ferner Koordinierung der Arbeit der Fakultäts- und Fachschafts-Studentenvertretungen, die auch in begrenztem Umfang an der Durchführung der wissenschaftlichen Lehraufgaben der Hochschule mitwirken. - Das höchste Organ der allgemeinen Selbstverwaltung der Hochschule ist der Hochschulrat (bzw. Rat der Universität). Er besteht aus je einem Professor, Assistenten und Studenten für jede Fakultät, die vom Senat, der Allgemeinen Assistentenvertretung und dem Studentenrat für zwei Jahre gewählt werden (d.h. etwa bei einer Universität mit sechs Fakultäten aus 18 Mitgliedern). Die Präsidenten bzw. Direktoren der Fakultätsvertretungen, der Rektor, der Vorsitzende des Studentenrats, der Vorsitzende der Allgemeinen Assistentenvertretung sind Mitglieder mit beratender Stimme (d.h. bei sechs Fakultäten 9 weitere Mitglieder).
Die stimmberechtigten Mitglieder des Hochschulrates werden als Vertreter der drei Selbstverwaltungsverbände der Hochschule (Lehrkörper, Studentenschaft, Assistentenschaft) gewählt und sind verpflichtet, nach eigenem Ermessen die Interessen des Teilverbandes zu vertreten, können aber nicht an Beschlüsse oder Aufträge seiner Organe gebunden werden. Sie sollen die berechtigten Interessen der Teilverbände mit den sachlichen Erfordernissen den wissenschaftlichen Aufgaben der Hochschule in Einklang bringen (so wie es in der gegenwärtigen Hochschulverfassung die allein verantwortlichen Ordinarien in Bezug auf ihre persönlichen Interessen tun müssen).
Der Hochschulrat wählt den Präsidenten des Hochschulrates (158) (oder „Universitätskanzler“), der mindestens vier Jahre (hauptamtlich) amtieren und möglichst mehrmals wiedergewählt werden soll. Ähnlich wie bei den Präsidenten oder Direktoren der Fakultätsverwaltungen kann entweder ein Professor oder eine Persönlichkeit aus dem Staatsdienst oder aus anderen Berufsgebieten berufen werden.
Als Exekutivorgan wählt der Hochschulrat einen „Verwaltungsausschuß“, dem zwei Professoren oder Dozenten, zwei Assistenten und zwei Studenten (mit abgeschlossenem Examen) 5 angehören, die im Unterschied zum Präsidenten nur nebenamtlich, für eine Amtszeit von vier Jahren, tätig sind und dafür eine finanzielle Entschädigung erhalten. Um die Kontinuität zu sichern, werden alle zwei Jahre jeweils drei Mitglieder (je ein Professor, Student, Assistent neugewählt. Dem Verwaltungsausschuß unterstehen mehrere Referenten (Verwaltungsbeamte der Universität), die die Ämter der Universität u.a. Ressorts leiten.
Der Präsident des Hochschulrates führt zugleich den Vorsitz im Verwaltungsausschuß. Dem Präsidenten unterstehen die Kanzlei der Hochschzle un die anderen allgemeinen Verwaltungs- behörden (Außenamt, Baubehörden, Quästur, Presse- und Informationsbüro, Immatrikulationsbüro etc.) Verwaltungsausschuß und Präsident des Hochschulrates sind an die Beschlüsse des Hochschulrates gebunden.
Die wichtigsten Aufgaben der allgemeinen Selbstverwaltungsorgane der Gesamt-Hochschule liegen auf den folgenden Gebieten:
Vertretung der Hochschule gegenüber dem Staat und in der Öffentlichkeit, Wirtschaftsverwaltung, personellen Fragen (Besetzung von Planstellen, Berufungen).
– a) Vertretung der gemeinsamen Interessen aller Hochschulangehörigen gegenüber dem Staat und in der Gesellschaft, auch in solchen politischen Fragen, die die Mitglieder der Hochschule für wesentlich halten, obwohl sie nicht direkt mit den Aufgaben der Hochschule verknüpft sind.
– b) Beratung und Verabschiedung aller Satzungen und Ordnungen, die die Hochschule kraft ihrer Satzungsautonomie (Vgl. Kapitel, Hochschule und Staat) unter der Rechtsaufsicht erläßt.
– c) Berufungen und Personalfragen: Der Hochschulrat entscheidet über Berufungen aufgrund der von der Fakultätsvertretung eingereichten Vorschlagsliste und des dazu erstatteten Gutachtens des Fakultätskollegiums. Für jeden Berufungsvorgang entsendet der Senat zwei fachlich geeignete Vertreter zu den Sitzungen des Hochschulrates (159). Lehnt der Hochschulrat alle Vorschläge der Fakultätsvertretung ab, so muß sie eine neue Vorschlagsliste aufstellen.
Auch über die Erteilung der Lehrbefugnis an einer Fakultät der Hochschule an einen Habilitierten entscheidet der Hochschulrat auf Vorschlag der Fakultätsvertretung und aufgrund eines Gutachtens des Fakultätskollegiums.
Der Hochschulrat entscheidet auf Vorschlag der Institute und Fakultätsverwaltungen auch über die Besetzung aller anderen Planstellen und über die Schaffung neuer Planstellen.
– d) Die gesamte Wirtschaftsverwaltung der Hochschule wird schwerpunktmäßig durch den Verwaltungsausschuß und die Kanzlei aufgrund von Beschlüssen des Hochschulrates getragen:
Verwaltungsausschuß und Kanzlei arbeiten aufgrund des Bedarfs in den Fakultäten den Entwurf des Haushaltsplans aus und leiten ihn den Fakultätsvertretungen, dem Senat, der Assistentenvertretung und der Studentenvertretung zur Beratung und Stellungnahme zu. Der Hochschulrat verabschiedet auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses den endgültigen Entwurf, der vom Präsidenten des Hochschulrates bei der Landesregierung eingereicht wird, die jedoch nur an der Gesamtsumme (nicht an einzelnen Etatposten) Veränderungen vornehmen soll. Nach Verabschiedung des Haushaltsplans im Rahmen des Staatshaushalts durch das Parlament werden die bewilligten Mittel der Hochschule global zur Verfügung gestellt. Der Hochschulrat entscheidet dann über die endgültige Aufteilung der Mittel. Ebenso entscheidet der Hochschulrat über die Verwaltung des Vermögens der Hochschule, die Annahme von Schenkungen. Er führt die Aufsicht über die Wirtschaftsverwaltung der Institute und Fakultäten.
Der Hochschulrat bildet mehrere Ausschüsse, in denen Vertreter aller Teilverbände der Hochschule Mitglieder sein sollen:
Haushaltsausschuß, Rechtsausschuß, Förderungsausschuß, Außenausschuß, Hochschulpolitischer Ausschuß, Personalausschuß u.a.
VII. Hochschule und Staat
Welche Stellung der Hochschule im Rahmen der vom Leitsatz der sozialen Demokratie bestimmten Verfassungsordnung der Bundesrepublik zukomnt und welche Konsequenzen sich daraus für die Ausgestaltung ihrer inneren Struktur ergeben, ist bereits untersucht worden. (Vgl. Kapitel IV, Akademische Freiheit und soziale Demokratie, sowie Kapitel VII, Die demokratische Hochschulverfassung).
Offen blieb zunächst die Problematik der näheren Regelung des Verhältnisses Hochschule - Staat in diesem Gesamtzusammenhang. Dabei handelt es sich sowohl um ein verfassungsrechtliches wie ein praktisch-politisches Problem: Erstens: Die Frage nach dem Umfang der verfassungsrechtlichen Autonomie der Hochschule, nach der genauen Abgrenzung des Bereichs der Hochschulselbstverwaltung vom Staat.
Zweitens: Die Frage nach der Hochschul- und Wissenschaftspolitik des Staates, nach der Praxis der staatlichen Förderung von Wissenschaft und Hochschule.
Es gilt zunächst, das verfassungsrechtliche Gehäuse der Hochschulautonomie im einzelnen darzustellen und Ansatzpunkte zu seiner Umgestaltung im Rahmen der gegenwärtigen Verfassungsordnung aufzuzeigen.
Bei dieser rechtlichen Auseinandersetzung um die Hochschulautonomie sollte jedoch stets im Bewußtsein bleiben, daß es dabei letztlich um reale Machtfragen geht, um die Verfügungsgewalt über die wissenschaftlichen Arbeitsmittel, ohne die „Freiheit der Forschung und Lehre“ zu einer Farce wird. Angesichts der zunehmenden autoritären Tendenzen im Staatsapparat der Bundesrepublik gewinnt die Auseinandersetzung um die Erhaltung und den Ausbau der rechtsstaatlichen Schutzvorrichtungen eine erhöhte Bedeutung.
VII.1 Die Hochschulautonomie in der Entwicklung des Hochschulrechts
Die allgemeine Rechtsentwicklung im deutschen Hochschulwesen ist so verlaufen, daß im Regelfall die einzelnen Hochschulen in sich sowohl Elemente einer körperschaftlichen als auch einer anstaltsmäßigen Verfassung vereinen. Auf der einen Seite gibt es in der Regel einen körperschaftlich organisierten, d h. mitgliedschaftlich aufgebauten, als eigene Angelegenheit durch die Mitglieder verwalteten Bereich, der unter der Rechts-, nicht der Ermessensaufsicht oder Fachaufsicht des Staates steht, dem ein anderer, hierarchisch aufgebauter, dem Staat unterstehender Bereich in derselben Universität gegenübersteht (z.B. Institute).
Je nach der geschichtlichen Entwicklung überwiegt das eine oder das andere Element, so in Süddeutschland die Selbstverwaltung, in den ehemals preussischen Gebieten die Staatsverwaltung.
Besonders die Wirtschaftsverwaltung wird als Bereich der Staatsverwaltung aufgefaßt. Sie wird entweder direkt durch staatliche Organe - durch die Hochschulabteilung im Ministerium oder durch einen staatlichen Kurator in der Hochschule - wie in den ehemals preußischen Ländern oder durch Organe der Hochschule - aber als staatliche Auftragsverwaltung durchgeführt, wie in fast allen technischen Hochschulen, Fachhochschulen und an den bayrischen Universitäten.
Rechtsgrundlagen des Hochschulwesens sind heute Art. 5, Abs. 3 GG:
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zu der Verfassung“,
ferner die Landesverfassungen, sowie vereinzelte Hochschulgesetze der Länder. Im wesentlichen haben aber die Landesverfassungen für das Hochschulrecht keine überragende Bedeutung, so daß bei der rechtlichen Diskussion allein die Auslegung des genannten Grundgesetzartikels maßgebend ist.
Fast ohne Ausnahmen ist die herrschende Meinung in der deutschen Staatslehre, daß diese Bestimmung nicht nur ein Grundrecht von Personen aufstellt, sondern die Institution der wissenschaftlichen Hochschule als einen von der staatlichen Verwaltung unabhängigen Bereich garantiert.
Allerdings herrscht keine Einmütigkeit über das Ausmaß der Ausgestaltung dieser institutionellen Garantie.
Dieselben Staatsrechtslehrer, die Art. 5 Abs. 3 GG als institutionelle Garantie auslegen, rechtfertigen z.T. die traditionell aus dem Obrigkeits- und Polizeistaat überkommene Mischform in der Hochschulverwaltung, besonders die staatliche Wirtschaftsverwaltung im Hochschulwesen.
Gerber (Hochschule und Staat, 1953) bezieht sich auf „die geistigen und praktischen Auseinandersetzungen aus Anlaß der Gründung der Berliner Universität“, auf die klassischen Grundschriften der deutschen Universität (Fichte, Schleiermacher, Steffens), wenn er in Übereinstimmung mit Werner Näf (Wesen und Aufgabe der Universität, 1950) von der Grundvoraussetzung ausgeht, daß die Autonomie der Hochschulen „keine durchgreifende, sondern nur eine partikulare sein kann. “ „Die Autonomie der Hochschule zentriert in der Forschung und Lehre, die staatliche Hochschulververwaltung in deren Ermöglichung und sachlichen Förderung“. Es gelte daher, die „Grenze, die zwischen der Selbstbestimmung der Hochschule und der staatlichen Ordnung ihrer Angelegenheiten zu ziehen ist“, zu erörtern. (a.a.O., S.13)
Zu einer ähnlichen Meinung, die anstaltliche und korporative Elemente in der Universität nebeneinander bejaht, wenn auch z.T. der überwiegend korporative Chorakter der Universität aufgenommen wird, gelangen: die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin (Juristenzeitung 1955, S. 277), das Urteil des Badischen Verwaltungsgerichtshofs (Juristenzeitung 1956, S. 21); Giese (Rechtsgutachten von 1952); W. Weber (Rechtsstellung des Hochschullehrers, 1952; Köttgen (Das Grundrecht der deutschen Universität, 1959) („Die Funktionsgarantie des Grundgesetzes bezieht sich nicht auf die Delegation staatlicher Kompetenzen mit dem Ziele weisungsfreier akademischer Selbstverwaltung. “ a.a.O, S. VI); W. Thieme (Deutsches Hochschulrecht, 1956); Alexander Kluge (Die Universitätsselbstverwaltung, 1958).
Dem steht eine abweichende Meinung gegenüber, die die institutionelle Garantie der Hochschule durch das Grundgesetz nur in der eindeutigen Rechtsform der Körperschaft öffentlichen Rechts mit dem Recht zur Selbstbestimmung und Selbstverwaltung aller eigenen Angelegenheiten im Rahmen einer bloßen Rechtsaufsicht des Staates erfüllt sieht. Diese Auffassung vertreten R. Reinhardt, Universität und Staat, 1951; Ernst E. Hirsch, Vom Geist und Recht der Universität, 1955; L. Raiser (in DUZ 1953, Nr. 15, S. 7 ff.), der auch die Selbstvrwaltung und Lehre im Grundgesetz ableitet, und K. Pleyer, Die Vermögens- und Personalverwaltung der deutschen Universitäten, 1955.
Diese Auslegung des Art. 5 GG ist von besonderer Bedeutung für die Hochschulen derjenigen Länder, die eine ausdrückliche Garantie der Universitätsselbstverwaltung nicht in ihre Verfassungen aufgenommen haben.
Eine solche Rechtsstellung besitzen z.B. die Freie Universität Berlin und die Universität des Saarlandes.
Es ist nicht eine verfassungsrechtliche Feststellung, wenn man zugeben muß, daß in diesen Universitäten, wie auch in den Stiftungsuniversitäten Frankfurt/Main und Köln, die eigenständige Wirtschaftsverwaltung zur Fiktion wird, wenn in den entsprechenden Organen nicht die Vertreter der Universität, sondern die des Staates (bzw. in Köln, Frankfurt der Stifter) ausschlaggebend sind.
VII.1.1 Konsequente Ausformung der Körperschaftsverfassung
Allein diese zweite Auslegung wird der Tragweite des Prinzips der sozialen Demokratie gerecht, das den Rahmen der bisherigen formal-rechtsstaatlichen Theorie des Hochschulrechts sprengt. Wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daß die Auslegung des die Hochschulautonomie garantierenden Grundgesetzartikels im Zusammenhang mit der gesamten verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur Verwirklichung des demokratischen und sozialen Rechtsstaates, vorzunehmen ist, so ergibt sich:
Nach Art. 5 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 GG (Verfassungsleitsatz der demokratischen und sozialen Rechtsstaatlichkeit) ist die Verpflichtung des Gesetzgebers zur möglichst homogenen und konsequenten Durchführung der Körperschaftsverfassung der Hochschule gegeben.
- Alle Verwaltungstätigkeit im Hochschulraum ist so eng mit dem „Vollzug“ der Wissenschaft durch Forschung und Lehre und durch Studium und Ausbildung verflochten, daß um der Eigenständigkeit der Wissenschaft willen auch die eigenständige Bestimmung und Verwaltung aller Bereiche der Hochschule vom Staat gewährleistet und geschützt werden muß. Das kann nicht durch die Rechtsform der unselbständigen oder selbständigen Anstalt öffentlichen Rechts, auch nicht durch eine Mischform von körperschaftlichen und anstaltlichen Rechts, auch nicht durch eine Mischform von körperschaftlichen und anstaltlichen Elementen, sondern nur durch die Rechtsform der Körperschaft des Öffentlichen Rechts mit voller Selbstverwaltung durchgeführt werden.
- Als zusätzliche rechtliche Begründung der Körperschaftsverfassung der Hochschulen ist auf Art. 28 Abs. 1 GG zu verweisen:
„(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.“
Da durch die Kulturhoheit der Länder ihnen auch die Aufgabe des Schutzes und der Begründung der Freiheit der wissenschaftlichen Hochschulen zufällt, sind sie verpflichtet durch ihre Verfassungen oder durch Hochschulgesetze eine solche Rechtsform der Hochschulen zu schaffen und zu schützen, die den Grundsätzen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates gerecht wird. Einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat ist nur eine solche Rechtsform der Hochschulen angemessen, die es allen Personen, die an den Aufgaben der Hochschulen durch Forschung, Lehre, Ausbildung und Studium Anteil haben, gestattet, alle Angelegenheiten dieser Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Das ist aber nur in mitgliedschaftlich organisierten Körperschaften möglich. Die Initiative und Verantwortung auch für die organisatorische Zusammenfassung und das Zusammenwirken zu dem Zweck, Wissenschaft durch Forschung, Lehre, Ausbildung und Studium zu betreiben, kommt in einer sozialen, demokratischen Verfassungsordnung in erster Linie den unmittelbar Beteiligten selbst zu, und nicht dem kaum daran beteiligten Staatsapparat.
Daher verlangt die Verfassung „das Ideal der obrigkeitsfreien Universität (160) und die Abschaffung der „polizeistaatlichen Grundsätze“ (161), die teilweise im Hochschulwesen noch herrschen.
VII.1.2 Autonomie und Rechtsaufsicht
Von grundlegender Bedeutung für das Verhältnis der Hochschulen zum Staat ist es, welche Rolle dem Staat bei der Gründung einer Hochschule, der Konstituierung oder Änderung ihrer Verfassung und Satzung, sowie bei einer Veränderung ihres Bestandes zukommen soll.
Die Initiative zur Gründung von Hochschulen sollte nicht auf den Staat beschränkt sein, sondern ebenso durch die Gemeinden, die bestehenden Hochschulen, Studentenvertretungen und auch von privater Seite möglich sein. Das entspricht dem Recht der freien Körperschaftsbildung, das zuletzt bei der Gründung der Freien Universität Berlin sich verwirklichte.
„Der Wille der Mitglieder, sich als Körperschaft zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes zu organisieren, ist nicht zur zeitlich das prius, sondern auch rechtlich das potius gegenüber dem staatlichen Akt der Anerkennung. “ (162)
Es muß aber durch allgemeine gesetzliche Regelung sichergestellt werden, daß die Konstituierung von Hochschulen nur in der Rechtsform der Körperschaft öffentlichen Rechts möglich ist. Denn die durch das Grundgesetz geforderte institutionelle Sicherung der Freiheit von Forschung und Lehre verbietet nicht nur die Gründung und Stellung von Hochschulen als staatliche Anstalten (z.B. als staatliche Verwaltungshochschule, Heereshochschule) sondern ebenso den Status von privatrechtlichen Hochschulen (z.B. als Verein oder als Stiftung bürgerlichen Rechts), der zur Auslieferung der freien Forschung und Lehre an anonyme unkontrollierbare Kräfte führen kann. Bei der Auslegung von Art. 5 Abs. 3 GG als institutionelle Garantie ergibt sich, daß dem Staat die institutionelle Sicherung der Garantie zufällt. Diese Aufgabe kann er aber bei Hochschulen privaten Rechts nur sehr unzureichend erfüllen. In einem solchen Falle wären der staatlichen Rechtsaufsicht über das Hochschulwesen zu enge Grenzen gesetzt.
Die Anerkennung einer bestehenden oder zu gründenden Institution als (wissenschaftliche) Hochschule muß auf dem Wege der Gesetzgebung, d.h. durch die Länderparlamente (bei Kulturhoheit der Länder) erfolgen. Es muß jedoch zweckmäßigerweise durch eine allgemeine gesetzliche Regelung (in den Länderverfassungen oder in den Hochschulgesetzen) festgelegt werden, in welcher Form die bestehenden Hochschulen als befugte Vertreter der Wissenschaft, der Forschung und Lehre bei dieser Anerkennung mitwirken. Der Gesetzgeber ist bei der Erteilung der Anerkennung in soweit an das Votum der Hochschulen gebunden, als dabei der wissenschaftliche Charakter der neuen Hochschule festzustellen ist. „Der Staat vermag zwar wohl die Verfassung, aber nicht mit dem gleichen Recht auch die von dieser verwandten Begriffe Wissenschaft oder gar Kirche zu interpretieren. “ (163) Umstritten ist nur, ob die Hochschulen ein Recht auf völlige Selbstinterpretation in Anspruch nehmen können. Auf jeden Fall ist es aber geboten, „ daß die Auslegung des juristischen Komplementärbegriffs Wissenschaft nur in Form einer Kooperation staatlichen Gesetzgebung und Verwaltung mit den geordneten Institutionen der Wissenschaft sinnvoll erfolgen kann. “ (164)
Bei Veränderungen des Bestandes von Hochschulen durch Angliederungen oder Abspaltung von Institutionen, sowie beim Zusammenschluß von Hochschulen sollte ebenfalls keine Begrenzung der Initiative zu solchen Maßnahmen bestehen. Sie müssen aber ebenfalls auf dem Wege der Gesetzgebung durchgeführt werden. Für solche Fälle ist jedoch immer die institutionelle Garantie grundlegend erschüttert werden. Der Kern der durch das Grundgesetz geforderten Autonomie der Hochschulen ist die somit zuerkannte Rechtssetzungsgewalt. Daraus ergibt sich, daß allein die Hochschule ihre Satzung und andere Statuten (Universitätsordnung, Disziplinarordnung) auszuarbeiten und zu beschließen hat. Die staatliche Mitwirkung bleibt dann auf die parlamentarische oder ministerielle Bestätigung beschränkt. (165)
Die Gründung von Hochschulen, die Bestätigung von Satzungen und Satzungsänderungen, Veränderungen des Bestandes von Hochschulen sind nicht staatliche Verwaltungsakte, sondern gehören zum Bereich der staatlichen Rechtsaufsicht (da die Verfassung die Hochschulen als einen von staatlicher Verwaltung freien Raum garantiert) bzw. zum Bereich der Gesetzgebung (der Länder).
Durch die Garantie der Hochschulautonomie ist die Aufsicht des Staates über die Selbstverwaltung der Hochschulen auf eine reine Rechtsaufsicht beschränkt. Eine Ermessens- und Fachaufsicht des Staates widerspricht dem besonderen Charakter akademischer Selbstverwaltung (im Unterschied zur Selbstverwaltung der Gemeinden). Das bisher übliche Verfahren der Rechtsaufsicht bedarf einer Überprüfung, um dem tatsächlichen Verhältnis von Hochschule und Staatsexekutive, das durch größtmögliche Distanz und Unabhängigkeit bestimmt sein muß, gerecht zu werden.
Die Initiative für die Verfolgung von Rechtsverstößen der akademischen Selbstverwaltungsorgane kommt einem entsprechenden Organ der Hochschule und dem Staatsministerium, das mit der Rechtsaufsicht über das Hochschulwesen beauftragt ist, zu. Die Entscheidung darüber, ob zum Beispiel ein Beschluß eines Organs der Hochschule gegen das Recht verstößt, sollte dagegen von einem unabhängigen Verwaltungsgericht, nicht von den Beamten des Ministeriums oder von dessen Rechtsabteilung, gefällt werden. Das erscheint besonders in dem Falle als selbstverständlich, wenn etwa die Abgrenzung der Rechte der Selbstverwaltung gegenüber den Rechten des Ministeriums (z.B. in Grenzgebieten zwischen Hochschulwesen und allgemeinem Bildungswesen) betroffen ist.
VII.2 Eigenständige Wirtschafts- und Betriebsverwaltung der Hochschule
Zur Wirtschafts- und Betriebsverwaltung der Hochschulen gehören das Verfahren zur Mittelbewilligung (Finanzierung durch den Staat), besonders die Haushaltsaufstellung, ferner die Mittelverwaltung, Vermögensverwaltung und die Verwaltung der Einrichtungen und Institute der Hochschule (Betriebsverwaltung).
VII.2.1 Allgemeine Grundsätze
Die jetzige Situation in der Wirtschaftsverwaltung der Hochschulen ist dadurch gekennzeichnet, daß die meisten Hochschulen nur ungenügend in das Verfahren der Haushaltsaufstellung eingeschaltet sind, daß - außer bei den meisten süddeutschen Hochschulen und in Berlin - eine staatliche Wirtschaftsverwaltung besteht, und das in allen Hochschulen die Institute und Einrichtungen unmittelbar der staatlichen Verwaltung unterstehen.
Entsprechend der geforderten konsequenten Durchführung der Körperschaftsverfassung muß auch der gesamte Bereich der Wirtschafts- und Betriebsverwaltung im Hochschulraum in die akademische Selbstverwaltung eingegliedert werden.
Eine Trennung zwischen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, wie in verschiedenen Hochschulgesetzen und Gesetzentwürfen vorgesehen, ist eine Fiktion, die der Wirklichkeit der heutigen Hochschule nicht gerecht wird. Eine solche Trennung zerstört den Begriff der Selbstverwaltung.
Voraussetzungen für eine sinnvolle und tragfähige eigene Wirtschaftsverwaltung der Hochschulen sind jedoch:
- eine intensive praktische Zusammenarbeit mit dem Staat, der fast die gesamten Mittel für die Förderung und Unterhaltung der Hochschulen zur Verfügung stellt, aber auf der Ebene unabhängiger Partnerschaft, durch intensive Verhandlungen und gegenseitige Beratung. Schwerwiegende Entscheidungen über die Verwendung staatlicher Mittel, über größere Projekte zur Errichtung von Bauten und anderen Einrichtungen solltet, nicht ohne vorhergehende Konsultation der staatlichen Organe gefällt werden. Zu diesem Zweck sollten z.B. beratende Gremien für die Bauplanung und überhaupt für den Ausbau der Hochschulen, aus Fachleuten der staatlichen Verwaltung und der Hochschulselbstverwaltung gebildet werden.
- Ausbau der Organe und Behörden der akademischen Selbstverwaltung, so daß sie diese zusätzlichen Aufgaben wahrnehmen können. Dazu ist die Freistellung von Professoren, Dozenten und Assistenten erforderlich, damit sie die verantwortliche Leitung entsprechender Organe für längere Zeit übernehmen können. Die laufende Verwaltungsarbeit muß jedoch durch besondere Angestellte erfolgen.
- Intensive Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen, zur zentralen Planung der Förderung und des Ausbaus der Hochschulen.
VII.2.2 Haushaltsaufstellung und Mittelbewilligung
Die Bewilligung der Mittel, die der Staat der Hochschule zur Verfügung stellt, erfolgt im Rahmen der Verabschiedung des Staatshaushaltes durch das Parlament des betreffenden Landes.
Für diese Zuschüsse aus dem Landeshaushalt ist möglichst die Zuweisung einer Globalsumme im Staatshaushalt (Globaletat der Hochschule) für jede Hochschule anzustreben. Die Aufstellung des Etats in seinen Einzelposten und damit die Aufgliederung der bewilligten Mittel für die einzelnen Verwendungszwecke bleibt dann völlig der Hochschule überlassen.
Die Regierung übt entsprechend der allgemeinen Rechtsaufsicht über das Hochschulwesen nur eine Etataufsicht aus.
Die Organe der Hochschule treffen die verantwortliche Feststellung des Globaletats. Dieser Etat darf vom Kultusminister nicht nach seinem Ermessen geändert werden. Er hat ihn mit seiner Stellungnahme an den Finanzminister weiterzureichen, der ihn dann im Staatshaushalt dem Parlament vorlegt.
Vertretern der Hochschule muß das Recht zur Anhörung im Haushaltsausschuß des Parlaments gesichert werden, um eine systematische Kürzung des Zuschusses möglichst zu verhindern.
Nur so kann die Behinderung oder einseitige Beeinflussung der Arbeit bestimmter Fakultäten, Institute, Lehrstühle oder von anderen Einrichtungen und Projekten der Hochschule durch gezielte Kürzungen oder Streichungen durch das von der jeweiligen politischen Konstellation bestimmte Parlament verhindert werden. Auch eine langfristige Verplanung der Zuschüsse wird durch den Globaletat erleichtert.
Der jetzige Zustand ist äußerst unbefriedigend: „Einmal sind die Haushaltsgrundsätze des Staates, die aus den Erfahrungen und Bedürfnissen der allgemeinen Staatsverwaltung entstanden sind, für die Verwaltung von Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten ebenso ungeeignet wie für diejenige wirtschaftlicher Unternehmungen. Sie vermögen mit ihrer Starrheit nicht den wechselnden Bedürfnissen des Universitätsbetriebs zu folgen und führen im Ergebnis nicht zu der gewollten Sparsamkeit in der Mittelverwendung, sondern zum Mangel und Überfluß jeweils am falschen Ort. (166)
Sollte eine globale Zuweisung von Haushaltsmitteln nicht zu erreichen sein und der Etat der Hochschulen weiterhin mit allen seinen Einzelposten in den Staatshaushalt hineingenommen werden, so ist aber auf jeden Fall das gleiche Verfahren bei der Aufstellung des Etats zu verlangen wie bei der Einbringung des Globaletats, ferner ist unbedingt eine größere Dispositionsfreiheit der Mittelverwaltung im Verhältnis der einzelnen Titel zu fordern, d..h. es müssen größere Fond darin enthalten sein, die es der Hochschule oder den Instituten gestatten, wenigstens einen Teil der Mittel elastischer, je nach den auftretenden Bedürfnissen zu verwenden. (167)
VII.2.3 Vermögens- und Mittelverwaltung
Aus der Aufstellung des Haushalts durch die Organe der akademischen Selbstverwaltung ergibt sich, daß auch die Verwaltung der vom Staat zur Verfügung gestellten Mittel durch entsprechende Organe der Hochschule, in dem durch den Haushalt gesetzten Rahmen, unter einer reinen Rechtsaufsicht des Staates zu erfolgen hat. Von der Mittelverwaltung ist die Vermögensverwaltung (dem Sinne nach) zu trennen. Gegenwärtig kennen nur die Berliner Universitäten und einige süddeutsche Universitäten eine eigene Vermögensselbstverwaltung. An den übrigen Universitäten wird diese Aufgabe zugleich von der staatlichen Wirtschaftsverwaltung in Anlehnung an das preußische Kuratorialsystem oder durch Universitätsorgane als Organe staatlicher Auftragsverwaltung unter der Fach- und Ermessensaufsicht des Staates wahrgenommen.
Mit einer konsequenten Durchführung der Körperschaftsverfassung ist auch diese Form der Vermögensverwaltung nicht zu vereinbaren. Sie muß ersetzt werden durch volle Selbstverwaltung des Vermögens der Hochschule unter Rechtsaufsicht des Staates.
Auch der Einfluß von Stiftern und von Gemeinden (wie im Falle der Stiftungsuniversitäten Frankfurt und Köln) sollte sich auf die Mittelbewilligung beschränken und die Verwaltung der Mittel oder des gestifteten Vermögens voll und ganz der Hochschulselbstverwaltung überlassen.
Die Verwaltung der Mittel und des Vermögens durch Organe der Hochschulen, in denen nicht die Vertreter der Hochschule, sondern die des Staates, der Gemeinde oder der Stifter in der Mehrzahl sind, entspricht nicht dem Sinn der akademischen Selbstverwaltung, sondern nur den formellen juristischen Prinzipien der Körperschaftsverfassung (wie z. B an der Freien Universität).
VII.2.4 Betriebsverwaltung
Die konsequente Durchführung der Hochschulselbstverwaltung verlangt die volle Eingliederung der Institute, Kliniken, Bibliotheken und anderer Einrichtungen und Betriebe der Hochschule in den Bereich der akademischen Selbstverwaltung. Die gegenwärtige Stellung der Institute ist eine Folge der widersprüchlichen Rechtsentwicklung der Hochschulen. Sie bilden einen Fremdkörper innerhalb der körperschaftlich organisierten Hochschule, da sie fast an allen Hochschulen unmittelbar der staatlichen Verwaltung unterstellte Anstalten sind, da ihre Direktoren und Abteilungsleiter, überwiegend auch fast das gesamte Personal, von der staatlichen Administration ernannt werden. Damit sind die eigentlichen Stätten der Forschung und Lehre der akademischen Selbstverwaltung fast ganz entzogen.
Zur vollen Eingliederung der Institute und Einrichtungen in die Selbstverwaltung ist folgendes notwendig:
- Die Errichtung und Umgliederung von Einrichtungen der Hochschule (Institute, Kliniken, Bibliotheken u.a.) erfolgt auf Vorschlag der Fakultäten durch das höchste Organ der Hochschulselbstverwaltung (Senat oder Hochschulrat), da die Gründung, Erweiterung und Veränderung der Einrichtungen die Interessen der gesamten Universitäten berührt.
- Die Hochschule ist für die Finanzierung der Institute und Einrichtungen und ihrer Forschungsvorhaben verantwortlich.
- Die Direktoren, Abteilungsleiter und das Personal werden auf Vorschlag der Fakultät f auf Beschluß des höchsten Organs der Hochschule vom Rektor ernannte.
VII.3 Die Rechtsstellung der Hochschullehrer
Aus der geschichtlichen Entwicklung der Überlagerung von körperschaftlichen und anstaltlichen Elementen im deutschen Hochschulwesen hat sich auch die besondere rechtliche Stellung der beamteten Hochschullehrer ergeben. Diese stehen auf der einen Seite als unmittelbare Landesbeamte zu ihren Dienstherren, dem Bundesland, in einem beamtenrechtlichen besonderen Gewaltverhältnis. Auf der anderen Seite sind sie jedoch Mitglied der Körperschaft Universität und sollen im Bereich von Forschung und Lehre nach Art. 5 Abs. 3 GG weisungsfrei sein. Zwar ist dem verfassungsrechtlichen Status des Lehrers an den wissenschaftliche Hochschulen weitgehend in der Beamtenrechts-Gesetzgebung Rechnung getragen worden, so, daß sein beamtenrechtlicher Status mit dem ebenfalls in der Sache weisungsfreien Richter zu vergleichen ist. So gelten beispielsweise die Vorschriften des Allgemeinen Beamtenrecht über die Versetzung, die Versetzung in den Ruhestand, die Laufbahnen, die Arbeitszeit, die Besoldung usw. nicht für Hochschullehrer (vgl. den 3. Titel des Beamtenrechts-Rahmenge-, setzes, §§ 105 ff über „Hochschullehrer, Wissenschaftliche Assistenten und Lektoren“). Durch diese rechtliche Sonderstellung sind jedoch die sich aus der Zwitterstellung des beamteten Hochschullehrers ergebenden Möglichkeiten der Einwirkung des Staatsapparates auf den Bereich von Forschung und Lehre nicht vollkommen beseitigt, da der Staat die unmittelbaren Staatsbeamten ernennt. Das widerspricht dem der wissenschaftlichen Hochschule nach dem Grundgesetz gewährten Autonomie. (So auch Köttgen, „Das Grundrecht der deutschen Universität, 1959, S. 62): „Die Verfassung, die sich unmißverständlich gegen es Leitbild der Staatsanstalt wendet, kennt keine gespaltene Einrichtung und will daher auch nicht den beamteten Hochschullehrer … “. Jedenfalls steht außer Zweifel, daß ein rechtstechnisch I brauchbares Hochschullehrerrecht auch unter Verzicht auf eine materiale Verbeamtung des Lehrkörpers denkbar ist. “ Nach richtiger Auslegung beinhaltet diese die sog. Kooptationsfreiheit, d.h. die Freiheit der Hochschulen, ihren Lehrkörper selbst zu ergänzen. Wenn auch bereits allgemein anerkannt ist, daß der Staat heute keinen Hochschullehrer mehr der Hochschule oktroyieren kann, so ist dennoch der Administration beim Prinzip des von der 1 Hochschule eingereichten sog. Dreier-Vorschlags, der heute in der Regel das Berufungsverfahren beherrscht, ein gewisser Einfluß geblieben. Da die Entwicklung zum beamteten Hochschullehrer nicht völlig rückgängig gemacht werden kann, bleibt für die Herstellung der vollen Kooptationsfreiheit der Hochschulen, d.h. der Ausschaltung des Einflusses der staatlichen Verwaltung bei der Frage der Berufung, nur die Möglichkeit für den Hochschullehrer den Status des mittelbaren Landesbeamten zu fordern. Nach § 121 BRRG kann den Körperschaften des Öffentlichen Rechts das Recht verliehen werden, Beamte zu haben. Die Verleihung dieses Rechts an die Universität würde bedeuten, daß sie und nicht der Staat Dienstherr der beamteten Hochschullehrer in das Beamtenverhältnis berufen könnte. Diese wären dann mittelbare Beamte des Landes. Von einer solchen Möglichkeit ist bisher nur in Berlin durch die Verleihung der Dienstherrn-Fähigkeit an die Freie Universität Gebrauch gemacht worden. Es ist jedoch davon auszugehen, daß allein diese Form der von der Verfassung verlangten Hochschul-Selbstverwaltung entspricht. (168)
Unabhängig von der Frage, wer als Dienstherr des Hochschullehrers fungiert, ist das Problem des Disziplinarrechts der Hochschullehrer zu betrachten. Im Vergleich zum Richter fehlt es hier an einem besonderen Disziplinarverfahren für Hochschullehrer. Dieses ist somit nach den allgemeinen Bestimmungen des Disziplinarverfahrens-Rechts ausgestaltet. Die Sonderstellung der Hochschullehrer kommt im materiellen Disziplinarrecht, d.h. in der rechtlichen Beurteilung des Disziplinarfalles, nicht in der formellen Ausgestaltung des Verfahrens zum Ausdruck. Zu fordern ist daher für das Disziplinarverfahren ein besonderer nur aus Hochschullehrern zusammengesetzter Disziplinarsenat.
Auch im Bereich der Rechtsstellung des Hochschullehrers gilt es, der Tendenz, die Einheit des Universitätsbetriebes aufzulösen, entgegen zu treten. Auch hier muß verhindert werden; daß die ebenfalls den wissenschaftlichen Hochschulen zukommende Funktionen von Unterricht und Berufsausbildung so vom Bereich der Forschung und Lehre getrennt werden, daß der Freiheitsschutz des Art. 5 Abs. 3 GG nicht gewährt wird, wenn die Hochschule auf dem Gebiet von Unterricht und Ausbildung tätig wird. Daraus folgt, daß der Kreis der Hochschullehrer, für die das Grundrecht des Art. 5 Abs. 3 GG gilt, weit gezogen werden muß. Als solche sind somit, unabhängig von ihrer beamtenrechtlichen Stellung alle die an wissenschaftlichen Hochschulen tätigen ordentlichen, außerordentlichen, außerplanmäßigen und Honorarprofessoren, die Privatdozenten, Lehrbeauftragte, Lektoren und wissenschaftlichen Assistenten zu bezeichnen.
VII.4 Ausbildung- und Prüfungsautonomie der Hochschule
Zur vollen Sicherung der Freiheit von Forschung und Lehre in der Hochschule, zu der komplementär auch die Freiheit des Studiums und der Ausbildung gehören, ist als Konsequenz die Prüfungs- und Ausbildungsautonomie der Hochschule, d.h. die volle Selbstbestimmung über den Charakter und das Ziel der wissenschaftlichen Ausbildung auch zum Zwecke der Berufsvorbildung und über Form und Durchführung der wissenschaftlichen Prüfungen, die durch Hochschullehrer in der Hochschule abgenommen werden, zu fordern.
Durch das gegenwärtige Prüfungssystem hat der Staat eine unmittelbare Einflußmöglichkeit auf Form und Ziel eines großen Teils der wissenschaftlichen Ausbildung (durch die Prüfungsordnungen, die z.T. einen Studienplan vorschreiben oder aufdrängen). Er beeinflußt damit mittelbar in hohem Maße auch den eigentlichen „Substanzkern“ (Köttgen) der Hochschule, den Charakter und Vollzug von Forschung und Lehre. Auch kann der Staat bei Auseinandersetzungen zwischen Hochschullehrern und der staatlichen Verwaltung durch die Berufung von Hochschullehrern in die Prüfungskommissionen bzw. durch Abberufung aus diesen Kommissionen Druck auf die Hochschullehrer ausüben. (Vgl. „Fall Riemeck“)
Die ausschließliche Bestimmung der staatlichen Behörden über einen großen Teil der wissenschaftlichen Ausbildungswege und Abschlußprüfungen tastet das Grundrecht der Freiheit von Forschung und Lehre in seinem Wesensgehalt an. Es widerspricht noch deutlicher als die staatliche Wirtschaftsverwaltung der institutionellen Garantie im Grundgesetz.
Die autonomen akademischen wissenschaftlichen Prüfungen sind von den durch pragmatische Zwecke bestimmten Berufszulassungsprüfungen deutlich zu trennen, um für die Universität lebenswichtige Scheidung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und Ausbildung in ihrem Dienste einerseits und der fachlich-beruflichen Ausbildung andererseits für die Studenten und in der Öffentlichkeit zu manifestieren.
Je nach der besonderen Lage in den einzelnen Fächern und Berufen, für die Staatsprüfungen vorgeschrieben sind, können bei der praktischen Verwirklichung der Prüfungsautonomie verschiedene Wege beschritten werden:
- Entweder zeitliche oder institutionelle Trennung zwischen akademischer wissenschaftlicher Abschlußprüfung und staatlicher Fachprüfung und Berufszulassungsprüfung. Über die wissenschaftliche Abschlußprüfung, etwa durch den Grad des Magister Artium (abgewandelt für andere Fakultäten) oder durch ein Diplom hätte ausschließlich die Hochschule zu bestimmen. Die akademischen Prüfungen, die auch für sich genommen einen Abschluß für andere Studenten bilden, wären als Voraussetzung für die Zulassung zur Fach- und Berufsprüfung zu absolvieren, über die nur die staatlichen Prüfungsbehörden zu bestimmen haben. Daraus würde sich die Einrichtung oder Erweiterung bestehender Lehrgänge für die Berufsausbildung nach dem wissenschaftlichen Abschluß und außerhalb der Hochschule ergeben (erweiterte Referendarausbildung z.B.). Es bestehen zwei verschiedene Prüfungskommissionen, ausschließlich von der Hochschule bzw. von der staatlichen Prüfungsbehörde berufen.
- Oder zeitliche und institutionelle Zusammenfassung der akademischen und staatlichen Prüfung. Dann ist jedoch die gleichberechtigte Mitbestimmung der Hochschulen über die Prüfungsordnungen und die Durchführung der Prüfungen zu fordern. Es ist eine Prüfungskommission zu bilden, die zur Hälfte von der Hochschule, zur Hälfte von der staatlichen Behörde zu ernennen ist.
VII.5 Planung der staatlichen Wissenschaftsförderung
Die vorgeschlagenen Reformen der innerbetrieblichen Struktur der Universität sind im wesentlichen Ausdrucks eines Versuches, die Leistungsfähigkeit der Universität entscheidend zu erhöhen. Die Abhängigkeit der wissenschaftlichen Leistung von der materiellen Ausstattung der Forschungseinrichtungen liegt auf der Hand. Die ungeheuren Kosten für die Ausstattung von Hochschulinstituten werden in den Naturwissenschaften am deutlichsten. Immer mehr technischen Aufwand erfordern jedoch auch die Geisteswissenschaften. Man denke nur an den technischen Apparat für ein großes sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut.
Wenn die mit steigenden Kosten und größerem wissenschaftlichem Fachpersonal verbundene Forschungsarbeit nicht gänzlich aus dem Raum der Universität verdrängt werden soll, ist als unerläßliche Vorbedingung für eine größere Effizienz eine umgreifende Planung der staatlichen Förderung des Bildungswesens und der Forschung zu fordern.
Planung führt in der hochindustrialisierten spätkapitalistischen Gesellschaft einerseits notwendig zu einer Perfektionierung und Verfestigung des einmal Bestehenden, andererseits wird durch die Leistungssteigerung des geplanten Bereiches und durch die mit ihrer notwendig verbundene Rationalisierung eine größere Durchschaubarkeit des Planbereiches erzielt. Durch die eintretende rationale Erhellung eines Planungsbereiches gelingt es, den Widerspruch zwischen der gesellschaftlich bedingten starren Struktur des gesellschaftlichen Sektors und den gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen und Tendenzen aufzudecken, d.h. es lassen sich Ansatzpunkte für ein dynamisches Darüberhinausgehen gewinnen.
Alle in diesem Sinne unternommenen Versuche einer rationellen Planung der Wissenschafts- und Nachwuchsförderung sind daher zu begrüßen.
Allen bisher unternommenen Planungsversuchen haftet jedoch der Mangel an, nur reaktiv zu sein, d.h. sie gehen vom Nachwuchsangebot aus, das aufgrund der erwarteten Steigerung der Geburtenjahrgänge und der erfahrungsgemäßen Aufschlüsselung nach Berufen statistisch errechnet wird.
So sind die Berechnungen des Wissenschaftsrates für die Maximalkapazität der westdeutschen Universitäten die sich allein nach dem zu erwartenden Steigen der Geburtenjahrgänge ausrichten, unzureichend Demgegenüber sollte dynamische Planung ausgehen vom zu ermittelnden Nachwuchsbedarf der Gesellschaft (Aufweisen von Schwerpunktveränderungen und expansiven Entwicklungen). Dies würde notwendig zu neuen Methoden der Bedarfs de c k u n g, d.h. der Erschließung der durch die Sozialordnung unserer Gesellschaft blockierten, für ihre dynamische Entwicklung aber unentbehrlichen Begabtenreserven führen.
Die Arbeit des Wissenschaftsrats, der sich seiner Aufgabe nach, einen Gesamtplan für die Förderung der Wissenschaft zu erarbeiten, als Plankommission versteht, wird dadurch stark eingeengt, daß er ganz verschiedenen Anforderungen genügen muß, die er nicht erfüllen kann. In der Tätigkeit des WR vermischt sich die konzeptionelle Arbeit auf dem Gebiet der Hochschulreform mit einer bis in kleinste Details gehenden Planung der Wissenschaftsförderung und mit der Aufgabe, politische Verhandlungen zwischen Bund und Ländern in der Funktion eines Verwaltungsorgans vorzubereiten.
Der Umfang der Verwaltungs- und Planungsaufgaben verlangen ein so großes Maß an kleinster Fach- und Sachkenntnis, daß ihre Bewältigung durch den Wissenschaftsrat allein kaum möglich ist. Wenn der WR leistungsfähiger arbeiten will, so ist es unumgänglich, seine Aufgabenbereiche verschiedenen Instanzen anzuvertrauen, die sich ständig gegenseitig informieren.
1) Ein zentrales Institut für Planung der Bildungs- und Wissenschaftsförderung sollte durch ständige wissenschaftliche Analyse des Bedarfs und der Entwicklungstendenzen im gesamten Bildungswesen die Ausarbeitung von detaillierten Plänen vorbereiten und fundieren.
Solche Institute bestehen z.T. schon in den angelsächsischen Ländern und bei der UNESCO. Voraussetzung solcher Arbeit ist der institutionell geregelte Zugang zu allen einschlägigen Unterlagen und Materialien bei den zuständigen Organen, also vor allem der Administration und der Wirtschaft. Das Institut sollte unabhängig von der Exekutive und den politischen und gesellschaftlichen Vertretungskörperschaften sein. Das kann nur erreicht werden, wenn die Funktion des Instituts nicht über Analyse und Berechnung aufgrund des gegenwärtigen Bedarfs und auf der Basis von eingereichten Planungskonzeptionen hinausgeht. Alle öffentlichen Forschungs- und Bildungsstätten sind zu verpflichten, ihren Bedarf und ihre Pläne beim Institut anzumelden und prüfen zu lassen. Auf der Grundlage der eigenen Berechnungen und des ihm zugegangenen Materials sollte das Institut langfristige Gesamtbedarfsberechnungen in den einzelnen wissenschafts- und Ausbildungsbereichen aufstellen, die als Basis für Planungen dienen.
2) Für den Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Ausbildung sollte der Wissenschaftsrat in empfehlenden Stellungnahmen neue Schwerpunkte für den Ausbau und für die Neugründung von Hochschulen und Forschungsstätten erarbeiten. Die Mitglieder des Wissenschaftsrates werden auf Vorschlag der Westdeutschen Rektorenkonferenz, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft vom Bundespräsidenten ernannt. (Vgl. heute: die wissenschaftliche Kommission des Wissenschaftsrates). Die Stellungnahmen und Vorschläge des Wissenschaftsrates zu den Schwerpunkten, Prioritäten und Zielen der Förderung müssen in Beziehung zu den wissenschaftlichen Arbeiten und Berechnungen des Planungsinstitutes stehen und von diesem begutachtet und im einzelnen berechnet werden. Auf diese Weise würden die Forderungen der Hochschulen und des Wissenschaftsrates überhaupt erst uneingeschränkt zum Ausdruck kommen, ohne von Anfang an durch finanzpolitische Erwägungen der beteiligten Regierungsvertreter verzerrt zu werden.
3) Zur Koordinierung der Kulturpolitik und zur Vorbereitung der notwendigen Legislativentscheidungen sollte neben der Kultusministerkonferenz ein ständiges Arbeitsorgan der Bundes- und Länderexekutive geschaffen werden, an dem Vertreter des Planungsinstitutes, des Wissenschaftsrates und eines entsprechenden „Bildungsrates“ beratend zu beteiligen wären.
Diese Koordinierungskommissionen der Regierungen sollte die vom Wissenschaftsrat erarbeiteten Konzeptionen und die daraufhin vom Planungsinstitut berechneten Gesamtbedarfspläne, prüfen und über ihre Realisierung beraten. Sie empfiehlt dem Bund und den Landesregierungen einen daraus entwickelten Entwurf eines Gesamthaushaltsplanes für das Wissenschafts- und Bildungswesen und die Verteilung der Kosten auf Bund und Länder aufgrund eines durch Staatsverträge festzulegenden Verteilerschlüssels.
Um dabei der Autonomie der wissenschaftlichen Hochschulen Rechnung zu tragen, müssen die Pläne und Vorschläge über die Verteilung und Verwendung der bewilligten Gesamtsumme von den betreffenden Hochschulorganen bzw. (bei überregionalen Projekten von der Westdeutschen Rektorenkonferenz) gebilligt werden.
Nachdem alle Regierungen zugestimmt haben, werden die im Verteilerschlüssel festgelegten Anteile des Gesamthaushalts den Parlamenten als Anhang zu den Staatshaushalten vorgelegt.
VIII. Anmerkungen
(1) Vgl. H. Heimpel, Schuld und Aufgabe der Universität, in: 3. Deutscher Studententag 1954, München, S. 13.
(2) Vgl. Karl Marx, Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie.
(3) Marx-Engels, Ausgewählte Schriften (Berlin 1953) S. 43ff.
(4) Prof. Hans-Joachim Lieber in der Podiumsdiskussion „Mut zur Politik“ des VI. Deutschen Studententags, Berlin 196o.
(5) Diese Situation der Professoren kommt sehr deutlich in der empirischen Studie von H. Anger, Probleme der deutschen Universität Tübingen 196o, zum Ausdruck; ebenso in den Begründungen die der „Hofgeismarer Kreis“ in seiner Denkschrift „Neugliederung des Lehrkörpers“ führt.
(6) Horkheimer, Philosophie als Kulturkritik. In: Der Monat, März 196o, S. 14
(7) H. Heimpel, Probleme und Problematik der Hochschulereform. Göttingen 1956, S. 3.
(8) Vgl. Dieter Henrich, Über den Begriff der Einheit von Forschung und Lehre und seine Kritik durch den Marxismus (Sonderdruck der DUZ).
(9) Vgl. W. Fuchs, Hodegetik des akademischen Studiums, in: DUZ 5/1961, S. 7 ff.
(10) H. Heimpel, a.a.O, S. 7
(11) H. Wenke, Die deutsche Hochschule vor den Ansprüchen unserer Zeit, 1955, S. 14.
(12) Vgl. Franz Eulenberg, die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, Leipzig 1904, in Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königlichen Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Band 24,11, S. 275 f.
(13) E. Anrich, Nicht 4, sondern 14 Universitäten!, DUZ 8/1961, S. 16.
(14) H. Schelsky, Einsamkeit und Freiheit. Zur sozialen Idee der deutschen Universität. Münster i. W. 196o, S. 29/30.
(15) Vgl. unten, 5.25/26.
(16) C. H. Becker, Die Pädagogische Akademie im Aufbau unseres nationalen Bildungswesens. 1926, S. 51 und 59.
(17) So J. Fischer, DUZ 6/7/ 1960.
(18) H. W. Rothe, Über die Gründung einer Universität zu Bremen. (1961), S. 95
(19) H. W. Rothe, Über die Gründung einer Universität zu Bremen. (1961), S. 95
(20) a.a.O., S.61
(21) Vgl. Soziologisches Gutachten der Professoren Bülow, Lieber und Stammer zum sog. Korporationsprozeß der Freien Universität Berlin. (im Manuskript vervielfältigt 1961)
(22) Vgl. auch in Kapitel V Abschnitts Die Fürsorge- und Erziehungshochschule?
(23) Vgl. F. Lilge, The Abuse of Learning. The Failure of the German University New York 1948; Oskar Negt, Die Zerstörung der deutschen Universität. In: neue Kritik Nr. 1 (März 196o); S. D. Stick, German Universities through English Eyes. London 1946.
(24) zitiert nach VDS-Informationsdienst
(25) Vgl. z.B. J. Pieper, Wag heißt „akademisch“? 1952
(26) Zitate aus: Heinrich Maack, Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts, Freiburg i. Br. 1956, S. 121/122.
(27) Prof. Franz Bücher (Freiburg i. Br.) in: DUZ 4/1960
(28) H. W. Rothe, a.a.O, S. 84
(29) H. Maack, a.a.O, S. 121.
(30) R. Lobner, Bemühung um ein Studium Universale.
(31) H. Maack a.a.O, S. 122.
(32) E. A. Aurich a.a.O, S. 54 und 56.
(33) Student und Politik (Habermas, v. Friedeburg, Oehler, Weltz) Neuwied 1961 S. 230.
(34) Vgl. z.B. F.G. Oetinger, Partnerschaft. Die Aufgabe der politischen Erziehung. 1953.
(35) Student und Politik, S. 198.
(36) a.a.O, S. 201.
(37) so H. W. Rothe im ‚Bremer Universitätsplan‘, S. 141.
(38) Auch hierfür ist die von der WRK 1960 preisgekrönte Schrift von R. Lobner sehr aufschlußreich.
(39) Dokumente zur Hochschulreform, S. 565. Vgl. ferner: H. Volk, Die Verantwortung der Theologie für das Studium Generale. In: Studium Generale in Nordrhein-Westfalen. 1957.
(40) Vgl. DUZ, 3/1961, S. 13. Ferner: E. Fueter, Fortbildung v. Allgemeinbildung. In: ‚Der akademische Nachwuchs‘ (Jahrbuch des Stifterverbandes …, 1957.
(41) Max Horkheimer, Philisophie als Kulturkritik, in: Der Monat, März 196o
(42) Vgl. Vorschläge aus der Wirtschaftspraxis … . in: DUZ 3/1961, S. 13.
(43) Vgl. Stellungnahme der Heidelberger Studentenschaft zur Hochschulreform (1949),in: Dokumente zur Hochschulreform S. 123 ff. ; ferner: Protokolle des 5. Deutschen Studententages Karlsruhe 1958, a.a.O, S. 189.
(44) Zusammengefaßt. 1: „Abschied vom Elfenbeinturm“. Eine vorbereitende Schrift für den Vl. Deutschen Studententag. Berlin 1960, S. 253-269.
(45) Protokolle des 6. Deutschen Studententages Berlin 1960, S. 182.
(46) Habermas, a.a.O, S. 24
(47) Vgl. das sog. „Göttinger Modell“ vom Juli 1961, das vom Kuratorium in Verbindung mit Professoren und Studenten-vertretern aufgestellt wurde.
(48) Habermas, a.a.O, S. 259.
(49) in: Gegenwärtige Probleme d. Univ. S. 32.
(50) Habermas, a.a.O, S. 259
(51) Schelsky, Einsamkeit und Freiheit. Münster i. W. 1960, S. 29.
(52) Ritter, Die Krisis.
(53) Vgl. Prof. Flügge, CIVIS-Sonderdruck, 1961, S. 7.
(54) Schelsky, a.a.O, S. 31/32
(55) Zitate bei Schelsky, a.a.O, S. 30.
(56) Vgl. Einleitung, Hochschule und Gesellschaft.
(57) Vgl. Vorschläge aus der Wirtschaftspraxis zur Reform des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. ., in: DUZ 3, 1961, S. 13. Vgl. auch unter Abschnitt Gliederung des Studiums, S. 52.
(58) Max Horkheimer, Gegenwärtige Probleme der Universität. S. 11.
(59) Student und Politik, s. a.a.O S. 253/4.
(60) Philosophie und Soziologie, in: Der Monat, Nov. 1959.
(61) Dokumente zur Hochschulreform, S.65.
(62) Henrich, a.a.O S. 20
(63) Horkheimer, a.a.O, S, 20
(64) Vgl. Kapitel II, Abschnitt ‚Institute jenseits der Fachgrenzen‘ (S. 67/68) sowie ‚Studienprogramme‘ (S. 69/70).
(65) Vgl. z.B. Fritz Arlt, Das Industriepraktikum, ein möglicher Beitrag zur Reform der Lehrerbildung. In: Chemiker- Zeitung 81/15 Heidelberg 1957; ders. : Begabtenförderung im Bereich von Wirtschaft und Betrieb. (Deutsches Industrie-Institut, Köln, vervielf. Manuskript.)
(66) K. Meyer, Das wissenschaftliche Leben in der UdSSR. Sonderdruck des Stifterverbandes.. Essen-Bredeney 1959;0. A. Anweiler, Die Reform des sowjetischen Bildungswesens. In: Osteuropa 1959,6
(67) VDS-Stellungsnahme zum Problemkreis „Akademische Zwischenprüfung“, Vorschläge des Arbeitskreises, Studiengestaltung und Wirtschaftspraxis im Bundesausschuß Betriebswirtschaft des Rationalisierungs-Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft (RKW), Gemischte Kommision der Kultusminister- und Rektorenkonferenz.
(68) F. W. Hardach, Reform des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums aus der Sicht der Wirtschaftspraxis und Wirtschaftsverwaltung, in: DUZ 3 1961
(69) VDS-Stellungsnahme, a.a.O, S. 5
(70) J. Fischer in DUZ, 6/1960
(71) W. Fuchs, Hodegetik des akademischen Studiums. DUZ, 5/1961, S. 10.]
(72) Empfehlungen des Wissenschaftsrates …, S. 55
(73) Abgedruckt in: DUZ 8/1981
(74) Vgl. Max Horkheimer, Fragen des Hochschulunterrichts, In: Gegenwärtige Probleme der Universität. Frankfurt am Main 1953
(75) Vgl. Karl August Wittfogel, Die Wissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft, 1912
(76) Vgl. Prof. P. Sockelmann, Bäume wollen in den Himmel 1 wachsen. DIE WELT vom 15. Juli 1961
(77) H. Schelsky, in Einsamkeit und Freiheit, S. 29
(78) Hans Anger, Probleme der deutschen Universität. Bericht über eine Erhebung unter Professoren und Dozenten Tübingen 1960, S. 392
(79) Max Horkheimer, Philosophie als Kulturkritik, in: Der Monat, März 1960
(80) Spiegel der Universität Wien. 14. Jhdt.
(81) Marx über die Funktion der Bürokratie zitiert nach: Marx-Engels, Ausgewählte Schriften (Berlin 1953), S. 43 ff.
(82) a.a.O
(83) abgedruckt in DUZ 8/1960
(84) Vgl. W. Thieme, Mitbestimmung an den Universitäten, DUZ 15/16 11. Jhg.
(85) Vg. Alexander Kluge, Die Universitäts-Selbstverwaltung. Frankfurt/Main 1958, S. 95/96 der auf die dekorative Funktion der altertümlichen akademischen Verfassung der neuen „Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg“ hinweist.
(86) Prof. Lieber in der Podiumsdiskussion „Mut zur Politik“ auf dem 6. Deutschen Studententag Berlin 1960
(87) Heinrich Maack, Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts. Freiburg i. Br., 1956, S. 121
(88) A. Köttgen, Deutsches Universitätsrecht. Tübingen 1933, S. 169
(89)Heinrich Maack, Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts. Freiburg i Br 1965 S. 121
(90)Ganz Gerber Genossenschaftliche Selbstverwaltung der Hochschule, DUZ, 11. 1954 (Hervorhebungen durch d. Verf.)
(91) Köttgen, in-Nipperdey-Bettermann-Scheuner, Die Grundrechte, 11 S. 327 (Hervorhebungen v. Verf.)
(92) Köttgen, Deutsches Universitätsrecht (1933) S. 90/91
(93) Gerber, a.a.O
(94) Köttgen, a.a. 0., S. 165-67
(95) Köttgen; Zitate aus: Deutsches Universitätsrecht (1933) S. 155 ff.
(96) Protokolle des 6. Deutschen Studententags Berlin 1960, S. 178
(97) Vgl. Kapital VII, Hochschule und Staat, Abschnitt Die Rechtsstellung der Hochschullehrer
(98) Abendroth, in: Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates (Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer 12,) S. 85
(99) Vgl. Forsthoff, v. Mangoldt, Menger u.a.
(100) Abendroth, Zum Begriff des Demokratischen und sozialen Rechtsstaates im GG der BRD. im „Aus Geschichte und Politik“ S. 279 ff. (4) Abendroth, in: Begriff und Wesen (a.a.O
(101) Abendroth, in: Begriff und Wesen (a.a.O)
(102) Franz Neumann, The Democratic and the Authoritarian State, 1957, S. 19, (übersetzt)
(103) Student und Politik, Neuwied 1961, S. 16
(104) Gerhard Leibholz, Strukturprobleme der modernen Demokratie, Karlsruhe 1958, S. 221/22
(105) Abendroth, in: „Aus Geschichte und Politik “, S. 281/82 und 297
(106) Student und Politik S. 44
(107) Abendroth, a.a.O S. 292
(108) 0. Bachof, Referat in: Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates (Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, 12) S. 48
(109) Ch. F. Menger, Der Begriff des sozialen Rechtsstaates im Bonner GG. Tübingen 1953, S. 27/28
(110)Abendroth, in: Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer 12.
(111) R. Altmann, Zur Rechtsstellung der öffentlichen Verbände in: Zeitschrift für Politik, Jhg. II (1955) H. 3, S. 20
(112) H. Maack, Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts, Freiburg i. Br. 1956, S. 92
(113) Maack, a.a. 0., S. 237
(114) Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts 1, 3. A. München 1953, S. 369
(115) Arnold Köttgen, die Freiheit der Wissenschaft und die Selbstverwaltung der Universität. in: Bettermann-Nipperdey-Scheuner, Die Grundrecht II, S. 325
(116) Rüdiger Altmann, Zur Rechtsstellung der öffentlichen Verbände, Zeitschrift für Politik, Jhrg. 2, (1955)
(117) Altmann, a.a.O, S. 220
(118) A. Köttgen (Das Grundrecht der Universität, 1959. S. 52/53)
(119) H. Ludwig u .Jan-Baldern Mennicken, Der Stand der Hochschulgesetzgebung (in DUZ 11/6Ü weisen daraufhin, daß eine derartige Zerlegung der Hochschulverwaltung z.B. durch Generalklauseln in Hochschulgesetzen auch komplizierte rechts-technische Probleme aufwirft.
(120) Vgl. Bachof, a.a.O S. 48 und Ch. F. Menger, a.a.O S. 27/28
(121) Vgl. Maunz-Dürig, Anm. 43 zu Art. 20 GG; von Mangoldt-Klein, S. 594, Hamann, Komm., S. 37; grundsätzlich auch A. Köttgen, Deutsches Universitätsrecht, 1933
(122) A. Köttgen, Deutsches Universitätsrecht, 1933, S. 110
(123) A. Köttgen, Das Grundrecht der deutschen Universität, 1959
(124) Karl Renner, Wege der Verwirklichung, 1929, sowie: Der geistige Arbeiter in der gegenwärtigen Gesellschaft, 1926.
(125) Vgl. Alexander Busch, Die Geschichte des Privatdozenten, Stuttgart 1959
(126) Vgl. H. Plessner, Untersuchungen zur Lage der deutschen Hochschullehrer, Bd. II, S. 33 ff.
(127) Anger, Probleme der deutschen Universität, Tübingen 1960
(128) in: Wissenschaft als Beruf, 1919, S. 6
(128) H. Plessner (Hrsg.), Untersuchungen zur Lage der deutschen Hochschullehrer, Göttingen 1956, Bd. II S. 33 ff
(129) a.a.O.
(130) Anger, a.a.O., S. 445
(131) in: Beilage zu „Die Sammlung“ Jhg. 3, Heft 2, März 1947
(132) Dokumente zur Hochschulreform, S. 484
(133) H. Anger, a.a.O, S. 445
(134) H. Anger a.a.O, S. 452
(135) Empfehlungen des Wissenschaftsrates … S. 441
(136) Erklärung vor der Presse am 23. Juni 1961, VDS-info 28.6.61
(137) Empfehlungen des Wissenschaftsrates … . S. 72
(138) a.a.O., S. 73
(139) a.a.O., S. 443
(140) a.a.O., S. 38
(141) Eduard Baumgarten, „Gedanken zur künftigen Hochschule“ und „Kriterien zum Entwurf neuer Universitäten“ in: Zustand und Zukunft der deutschen Universität, Tübingen 1963
(142) Vgl. W. Thieme, Mitbestimmungsrecht an den Universitäten (DUZ 15/16, 11 Jhg.)
(143) Vgl. Alexander Busch, Die Geschichte des Privatdozenten, Stuttgart 1959
(144) Vgl. Schwalbacher Richtlinien, in: Dokumente zur Hochschulreform, S. 274
(145) Vgl. dazu Kapitel VI
(146) Eine Empfehlung des „Blauen Gutachtens“ (1948), in: Dokumente zur Hochschulreform, S. 309
(147) Ein ähnliches Verfahren besteht im italienischen Hochschulwesen
(148) Vgl. „Förderung, nicht Fürsorge“, Ansprache von Ministerialrat Dr. Scheidemann bei der Eröffnung der Hochschulkonferenz in Bad Godesberg am 1. 7. 1957
(149) Bulletin der Bundesregierung, April 1957
(150) Vgl. Kapitel Forschung, Lehre, Studium: Ziele und Schwerpunkte des Studiums, Gesellschaftliche Praxis
(151) Vgl. Kapitel III, Akademische Freiheit und soziale Demokratie
(152) Vgl. De la Fourniére/Borella, Le syndicalisme étudiant, Paris 1957, S. 93 ff.
(153) Vgl. Kapitel „Akademische Freiheit und soziale Demokratie“
(154) Vgl. Kapitel II, Die Hochschule und ihre Arbeitsformen
(155) Vgl. Ringbuch des VDS, Teil 13, S. 1
(156) Vgl. Kapitel, Die Hochschule und ihre Arbeitsformen, „Das Kollegium“.
(157) Vgl. Kapitel Der Lehrkörper der Hochschule, Habilitationsverfahren, (Trennung von) Habilitation und Verleihung der venia legendi an einer bestimmten Fakultät)
(158) Vgl. die institutionelle Lösung, die der Hamburger Studienausschuß für Hochschulreform in seinem „Blauen Gutachten“ empfohlen hat: Hochschulrat aus Vertretern des Staates, der Öffentlichkeit und der Hochschule neben dem Akademischen Senat.
(159) Vgl. „Blaues Gutachten“.
(160) Ernst E. Hirsch, Vom Geist und Recht der Universität, Berlin 1955
(161) Klemens Pleyer, Die Vermögens- und Personalverwaltung der dt. Universitäten Marburg 1955
(162) Hirsch, Vom Geist und Recht der Universität, S. 11 unter Bezugn. a. Gierke u. Forsthoff
(163) Köttgen, Das Grundrecht der Dt. Universität S. 39
(164) Köttgen, a.a.O.
(165) Vgl. R. Reinhardt, Universität und Staat, S. 44
(166) L. Raiser, Die Universität im Staat, S. 35
(167) Zur Problematik der zentralen Wissenschaftsförderung
(168) Vgl. Hirsch, Vom Geist und Recht der Universität, 1955
Quelle: SDS Hochschuldenkschrift „Hochschule in der Demokratie“ erschien 1961. Aus Nachdruck der zweiten Auflage 1972, Verlag Neue Kritik KG Frankfurt, S. 81-109
Anmerkung der Redaktion: Die im Orginialtext durch Sperrschrift hervorgehobenen Worte sind hier in Italic dargestellt.